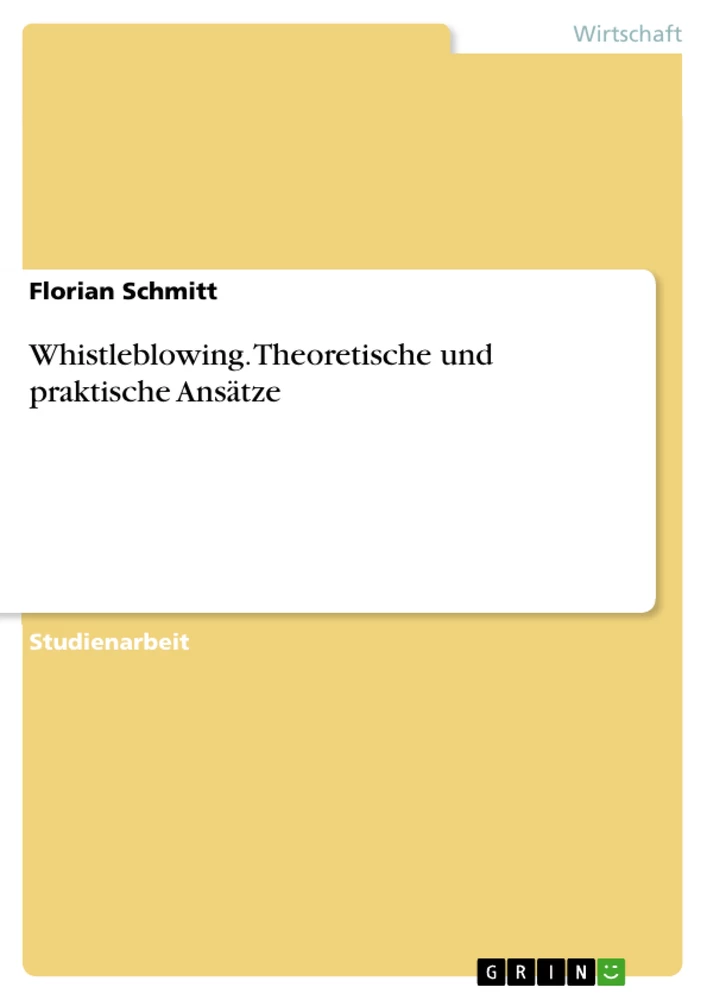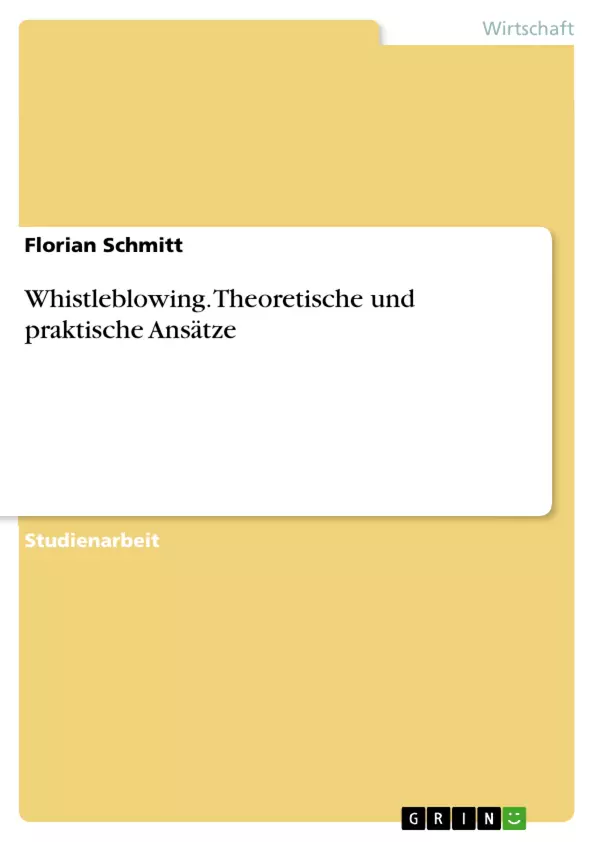Ob illegales oder unethisches und unmoralisches Verhalten am Arbeitsplatz (Suhr, 2017), Geheimnisverrat, Namen wie Edward Snowden und Chelsey Manning oder wie jüngst in den Nachrichten, das Thema Wirecard (Schäfer, 2020): Das Thema ethisches und moralisches Verhalten bzw. die hohe Anzahl und Verbreitung an Verstößen beschäftigt nicht nur die Wissenschaft. Vielmehr ist das Thema gesellschaftsfähig und nur die prominentesten Fälle schaffen es in die Schlagzeilen der Tageszeitungen, Onlineportalen und Nachrichten im Fernsehen. Dabei handelt sich nur um die Fälle, welche aufgedeckt und, auch nur in Teilen, aufgeklärt werden. Oft dienen diese Fälle zur Abschreckung und Warnung für andere „Sünder“. Oft dienen diese Fälle aber auch der Abschreckung für diejenigen, die sich mit Mut und Entschlossenheit dazu entschieden haben, Unrechtmäßiges und Unmoralisches aufzudecken, Beweise zu sammeln und entsprechend zu melden – innerhalb eines Unternehmens oder wie in den bekanntesten Fällen, an eine dritte Stelle wie bspw. Journalisten. Unternehmen, wie auch die gesamte Gesellschaft scheinen oft in den Konflikt zu geraten, bei dem sich der Einzelne zwischen Mitmachen, Melden, Ignorieren oder aktive Ansprache entscheiden kann und muss. Es scheint also angebracht, das Thema und das gesamte beteiligte Ökosystem einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Situation
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Zielsetzung
- 1.4 Vorgehensweise
- 2 Theoretische Vorbetrachtungen
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.1.1 Whistleblowing
- 2.1.2 Begriffsdefinitionen im Whistleblowing Kontext
- 2.2 Status quo: Forschungsstand, Erkenntnisse und Trends
- 2.2.1 Forschungsstand und theoretische Modelle
- 2.2.2 Erkenntnisse aus der Forschung und Ausblick
- 2.2.3 Whistleblowing: Recht, Gesetze und Digitalisierung
- 2.3 Fazit der theoretischen Vorbetrachtung
- 2.1 Begriffsdefinition
- 3 Ansätze für Unternehmen zum Umgang mit ethischen und gesetzlichen Anforderungen
- 3.1 Zielsetzung von Unternehmen
- 3.2 Verhaltenskodex und Social Responsibility
- 3.3 Compliance und Integritätssystem
- 3.4 Unternehmensorganisation und -kultur
- 4 Führungskräfte in der Verantwortung
- 4.1 Ethischer Führungsstil
- 4.2 Ethische Personalauswahl
- 4.3 Personalentwicklung
- 5 Diskussion & Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Whistleblowing und untersucht sowohl theoretische als auch praktische Ansätze zu diesem Thema. Die Arbeit analysiert die Situation und Problematik von Whistleblowing im Kontext von ethischem und moralischem Verhalten am Arbeitsplatz und beleuchtet verschiedene Perspektiven auf das Verhalten von Whistleblowern. Darüber hinaus werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Rolle von Unternehmen im Umgang mit Whistleblowing untersucht.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Whistleblowing
- Forschungsstand, Erkenntnisse und Trends im Bereich Whistleblowing
- Rechtliche Rahmenbedingungen und die Digitalisierung im Kontext von Whistleblowing
- Ansätze für Unternehmen im Umgang mit ethischen und gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Whistleblowing
- Die Rolle von Führungskräften in der Verantwortung im Kontext von Whistleblowing
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in das Thema Whistleblowing ein und beleuchtet die aktuelle Situation und die Problematik des ethischen und moralischen Verhaltens am Arbeitsplatz. Es werden verschiedene Beispiele für Whistleblowing-Fälle genannt und die Bedeutung des Themas für die Gesellschaft und Unternehmen hervorgehoben.
- Kapitel 2: Theoretische Vorbetrachtungen Das Kapitel befasst sich mit der Definition von Whistleblowing und stellt verschiedene Begriffsdefinitionen im Kontext des Themas vor. Des Weiteren werden relevante Forschungsarbeiten und Erkenntnisse aus der Forschung zum Whistleblowing dargestellt. Dabei werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Auswirkungen der Digitalisierung auf Whistleblowing betrachtet.
- Kapitel 3: Ansätze für Unternehmen zum Umgang mit ethischen und gesetzlichen Anforderungen Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten für Unternehmen, mit ethischen und gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Whistleblowing umzugehen. Es werden verschiedene Ansätze wie Verhaltenskodex, Social Responsibility, Compliance und Integritätssystem sowie Unternehmensorganisation und -kultur vorgestellt.
- Kapitel 4: Führungskräfte in der Verantwortung Das Kapitel beleuchtet die Rolle von Führungskräften im Kontext von Whistleblowing. Es werden verschiedene Aspekte wie ethischer Führungsstil, ethische Personalauswahl und Personalentwicklung im Hinblick auf das Thema Whistleblowing diskutiert.
Schlüsselwörter
Whistleblowing, ethisches Verhalten, moralisches Verhalten, Compliance, Corporate Social Responsibility (CSR), Unternehmensorganisation, Führungsstil, Personalauswahl, Personalentwicklung, Recht, Gesetze, Digitalisierung, Forschungsstand, Erkenntnisse, Trends.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Whistleblowing?
Whistleblowing bezeichnet das Aufdecken und Melden von illegalem, unethischem oder unmoralischem Verhalten am Arbeitsplatz an interne oder externe Stellen.
Welche Rolle spielen Compliance-Systeme in Unternehmen?
Compliance-Systeme sollen sicherstellen, dass Gesetze und interne Richtlinien eingehalten werden, und bieten oft geschützte Kanäle für Whistleblower.
Warum haben Whistleblower oft mit negativen Folgen zu kämpfen?
Obwohl sie Unrecht aufdecken, werden sie oft als „Nestbeschmutzer“ wahrgenommen und riskieren berufliche Benachteiligung oder soziale Isolation.
Wie beeinflusst die Digitalisierung das Whistleblowing?
Die Digitalisierung ermöglicht einerseits die anonyme Meldung über Online-Portale, erleichtert aber auch die massenhafte Verbreitung von Beweismaterial (siehe Edward Snowden).
Was ist ein ethischer Führungsstil im Zusammenhang mit Whistleblowing?
Führungskräfte tragen Verantwortung für eine Unternehmenskultur, in der Missstände offen angesprochen werden können, ohne dass Mitarbeiter Repressalien befürchten müssen.
- Quote paper
- Florian Schmitt (Author), 2020, Whistleblowing. Theoretische und praktische Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956166