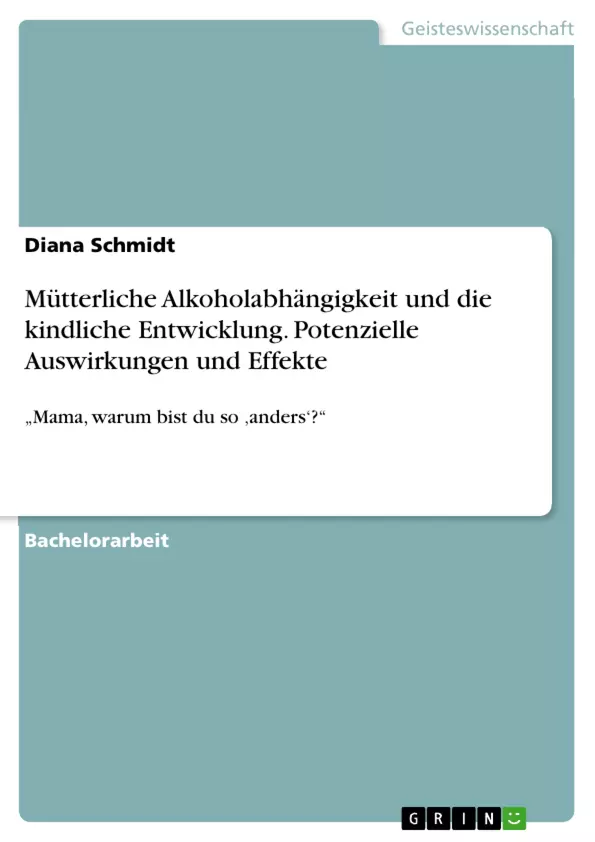Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf Kinder alkoholabhängiger Eltern und untersucht die potenziellen Auswirkungen mütterlicher Alkoholabhängigkeit auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern. Der Begriff der Alkoholabhängigkeit wird im Folgenden synonym verwendet zu den Termini Alkoholkrankheit, Alkoholsucht sowie Alkoholabhängigkeitssyndrom.
Um das Thema im gegebenen Rahmen bearbeitbar zu machen, wurde die Fragestellung weiter spezifiziert auf die postnatalen sozial-emotionalen Auswirkungen des Alkoholkonsums auf die Entwicklung von Kindern, schwerpunktmäßig wird dabei die frühe Kindheit fokussiert. Das Alter wurde nicht explizit eingrenzt, um die Auswirkungen in ihrer Tragweite für die kindliche Entwicklung ganzheitlich zu betrachten. Dabei werden die Auswirkungen väterlicher Alkoholabhängigkeit nicht explizit angeführt. Vielmehr bezieht sich die Ausarbeitung primär auf die Entwicklung von Kindern, die mit einer alkoholabhängigen leiblichen Mutter im gemeinsamen Haushalt aufwachsen, obgleich sich einige Kapitel aufgrund der Literatur auf elterliche Abhängigkeit allgemein beziehen.
Methodologisch ist diese Arbeit in eine qualitative Erhebung eingebettet. Sie nähert sich der Thematik problemorientiert-linear an, indem sie zunächst die direkten und indirekten Entwicklungsrisiken des Aufwachsens von Kindern mit einer alkoholabhängigen Mutter anhand diverser Erklärungsansätze erläutert. Die potenziellen Auswirkungen mütterlicher Alkoholabhängigkeit auf die Kinder werden im Sinne der Fragestellung im Weiteren dargestellt und bewertet.
Anschließend werden im theoriebasierten Teil Risiko- und Schutzfaktoren aufgeführt, die die Entwicklung der Kinder maßgeblich bestimmen und die Intensität der Auffälligkeiten und Störungen im Entwicklungsverlauf modifizieren. Abschließend werden ausgewählte Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Soziale Arbeit beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die direkten Auswirkungen – Alkoholkonsum in der Schwangerschaft
- Erklärungsansätze der indirekten Auswirkungen mütterlicher Abhängigkeit
- Belastungsfaktoren für die kindliche Entwicklung
- Die sozial-emotionale Entwicklung in den ersten Lebensjahren
- Das Bindungsverhalten von Kindern aus alkoholbelasteten Familien
- Merkmale einer alkoholbelasteten Familie
- Familienregeln und Alkoholismus in dem System Familie
- Die Co-Abhängigkeit in der Familie
- Die Rollenmodelle der Kinder
- Belastungsfaktoren für die kindliche Entwicklung
- Folgen der (in-)direkten Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder
- Die Rollenmodelle der Kinder und deren Entwicklungsrisiken
- Verhaltensauffälligkeiten
- Die Transmission der Alkoholabhängigkeit
- Risiko- und Schutzfaktoren von Kindern
- Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Soziale Arbeit
- Methodisches Vorgehen
- Qualitative Sozialforschung
- Methodologische Vorüberlegungen
- Erhebungsinstrumente
- Leitfadeninterview
- Problemzentriertes Interview
- Auswertungsmethode
- Einführung und Vorbereitung in die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- Kategorienbildung
- Ergebnisdarstellung und Diskussion
- Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die potenziellen Auswirkungen mütterlicher Alkoholabhängigkeit auf die kindliche Entwicklung. Ziel ist es, die sozial-emotionalen Folgen in der frühen Kindheit zu beleuchten und Interventionsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit aufzuzeigen. Die Arbeit stützt sich auf qualitative Forschung und ein Einzel-Interview.
- Direkte und indirekte Auswirkungen mütterlichen Alkoholkonsums auf Kinder
- Belastungsfaktoren und Entwicklungsrisiken in alkoholbelasteten Familien
- Rollenmodelle von Kindern in Familien mit alkoholabhängigen Müttern
- Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung
- Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Relevanz des Themas mütterlicher Alkoholabhängigkeit und deren Auswirkungen auf Kinder. Sie verortet die Problematik im Kontext der Sozialen Arbeit, betont die hohe Anzahl betroffener Kinder und die wachsende Aufmerksamkeit für dieses Thema. Die Arbeit spezifiziert die Fragestellung auf die postnatalen sozial-emotionalen Auswirkungen, fokussiert auf die frühe Kindheit und verwendet eine qualitative Forschungsmethodik. Die methodische Vorgehensweise wird kurz skizziert, wobei die qualitative Erhebung und die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring hervorgehoben werden.
Die direkten Auswirkungen – Alkoholkonsum in der Schwangerschaft: Dieses Kapitel wird sich vermutlich mit den direkten Auswirkungen des Alkoholkonsums der Mutter während der Schwangerschaft auf das Kind befassen. Es wird wahrscheinlich auf pränatale Schäden, das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) und andere Entwicklungsstörungen eingehen, die durch den Alkoholkonsum während der Schwangerschaft verursacht werden. Die Folgen für die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes werden vermutlich detailliert beschrieben. Statistische Daten und wissenschaftliche Studien werden wahrscheinlich herangezogen werden, um die Tragweite dieser direkten Auswirkungen zu verdeutlichen.
Erklärungsansätze der indirekten Auswirkungen mütterlicher Abhängigkeit: Dieses Kapitel wird vermutlich verschiedene Erklärungsansätze für die indirekten Auswirkungen mütterlicher Alkoholabhängigkeit auf die kindliche Entwicklung beleuchten. Es werden wahrscheinlich Faktoren wie die Qualität der Mutter-Kind-Bindung, die familiäre Atmosphäre, die soziale Umwelt und die Rolle des Kindes in der Familie untersucht. Die Auswirkungen auf die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes werden im Vordergrund stehen. Es ist zu erwarten, dass verschiedene theoretische Modelle und empirische Befunde herangezogen werden, um die komplexen Zusammenhänge zwischen mütterlicher Alkoholabhängigkeit und der kindlichen Entwicklung zu erklären. Verschiedene Aspekte der familiären Dynamik, wie z.B. die Co-Abhängigkeit anderer Familienmitglieder, werden vermutlich ebenfalls eine Rolle spielen.
Folgen der (in-)direkten Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder: Dieses Kapitel wird die konkreten Folgen der direkten und indirekten Auswirkungen der mütterlichen Alkoholabhängigkeit auf die Entwicklung der Kinder zusammenfassen. Es wird vermutlich auf Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Probleme, Lernschwierigkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen eingehen. Die Langzeitfolgen für die betroffenen Kinder werden diskutiert. Der Einfluss der Rollenmodelle in der Familie auf die Entwicklung und die damit verbundenen Risiken werden betrachtet. Es ist zu erwarten, dass verschiedene Studien und Forschungsergebnisse präsentiert werden, die diese Folgen belegen.
Die Transmission der Alkoholabhängigkeit: Dieses Kapitel wird sich vermutlich mit der Frage befassen, inwiefern Alkoholabhängigkeit vererbt oder zumindest familiär weitergegeben wird. Es wird wahrscheinlich genetische Faktoren, aber auch die Rolle von Lernprozessen und der sozialen Umgebung erörtern. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von alkoholabhängigen Eltern selbst alkoholabhängig werden, wird diskutiert werden, sowie Faktoren die dieses Risiko beeinflussen können.
Risiko- und Schutzfaktoren von Kindern: Dieses Kapitel wird die Faktoren analysieren, die das Risiko für negative Folgen der mütterlichen Alkoholabhängigkeit für die Kinder erhöhen oder verringern. Es werden sowohl individuelle als auch Umweltfaktoren wie z.B. das soziale Umfeld, die Unterstützung durch andere Familienmitglieder, oder die Qualität der frühkindlichen Betreuung diskutiert werden. Der Fokus wird auf den Faktoren liegen, die die Resilienz von Kindern in diesen herausfordernden Situationen fördern.
Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel wird verschiedene Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit für Kinder aus alkoholbelasteten Familien vorstellen. Es wird vermutlich auf präventive Maßnahmen, therapeutische Interventionen und die Arbeit mit der gesamten Familie eingehen. Es ist zu erwarten, dass verschiedene Beratungsansätze, Therapiemethoden und Unterstützungsprogramme detailliert beschrieben und kritisch evaluiert werden. Der Fokus wird auf der praktischen Umsetzung und der Effektivität der verschiedenen Maßnahmen liegen.
Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Arbeit. Es werden die gewählte Forschungsmethode (qualitative Sozialforschung), die methodologischen Vorüberlegungen, sowie die konkreten Erhebungsinstrumente (Leitfadeninterview, problemzentriertes Interview) erläutert. Der methodische Ansatz wird im Detail dargestellt und seine Eignung für die Beantwortung der Forschungsfrage wird begründet.
Auswertungsmethode: Dieses Kapitel befasst sich mit der Auswertung der gesammelten Daten. Es erläutert die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring als gewählte Auswertungsstrategie und beschreibt den Prozess der Kategorienbildung detailliert.
Schlüsselwörter
Mütterliche Alkoholabhängigkeit, kindliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung, Risiko- und Schutzfaktoren, Alkoholismus, Familienstrukturen, Co-Abhängigkeit, Interventionsmöglichkeiten, Soziale Arbeit, Qualitative Sozialforschung, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Auswirkungen mütterlicher Alkoholabhängigkeit auf die kindliche Entwicklung
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen mütterlicher Alkoholabhängigkeit auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern in der frühen Kindheit. Sie beleuchtet sowohl die direkten Auswirkungen pränataler Exposition als auch die indirekten Folgen der familiären Situation.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den direkten und indirekten Auswirkungen mütterlichen Alkoholkonsums, den Belastungsfaktoren und Entwicklungsrisiken in betroffenen Familien, den Rollenmodellen der Kinder, Risiko- und Schutzfaktoren und möglichen Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit. Der Fokus liegt auf der postnatalen Entwicklung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethodik. Die Datenerhebung erfolgt mittels Leitfaden- und problemzentrierten Interviews. Die Auswertung der Daten basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, direkten Auswirkungen (pränataler Alkoholkonsum), indirekten Auswirkungen (familiäre Belastungsfaktoren), Folgen für die kindliche Entwicklung, Transmission der Alkoholabhängigkeit, Risiko- und Schutzfaktoren, Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit, methodischem Vorgehen und Auswertungsmethode, Ergebnisdarstellung und Diskussion sowie Reflexion des methodischen Vorgehens.
Welche direkten Auswirkungen werden betrachtet?
Die direkten Auswirkungen beziehen sich auf den Alkoholkonsum während der Schwangerschaft und dessen Folgen wie das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) und andere Entwicklungsstörungen. Körperliche und geistige Entwicklungsstörungen werden betrachtet.
Welche indirekten Auswirkungen werden untersucht?
Die indirekten Auswirkungen umfassen die Folgen der familiären Situation, wie z.B. die Qualität der Mutter-Kind-Bindung, die familiäre Atmosphäre, die sozialen Umstände und die Rolle des Kindes in der Familie. Aspekte der Co-Abhängigkeit werden ebenfalls thematisiert.
Welche Folgen für die kindliche Entwicklung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Probleme, Lernschwierigkeiten und Schwierigkeiten im sozialen Bereich als mögliche Folgen. Langzeitfolgen werden ebenfalls diskutiert. Der Einfluss der Rollenmodelle in der Familie auf die Entwicklung und die damit verbundenen Risiken werden betrachtet.
Wie wird die Transmission der Alkoholabhängigkeit betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Vererbung und familiäre Weitergabe der Alkoholabhängigkeit, indem sie genetische Faktoren, Lernprozesse und soziale Einflüsse berücksichtigt. Das Risiko für Kinder alkoholabhängiger Eltern, selbst alkoholabhängig zu werden, wird analysiert.
Welche Risiko- und Schutzfaktoren werden genannt?
Die Arbeit identifiziert sowohl individuelle als auch umweltbezogene Risiko- und Schutzfaktoren. Individuelle Faktoren, sowie das soziale Umfeld, die Unterstützung durch Familienmitglieder und die Qualität der frühkindlichen Betreuung, werden betrachtet.
Welche Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert präventive Maßnahmen, therapeutische Interventionen und die Arbeit mit der gesamten Familie als Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit. Verschiedene Beratungsansätze, Therapiemethoden und Unterstützungsprogramme werden beschrieben und evaluiert.
Welche qualitative Methode wird zur Auswertung verwendet?
Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wird zur Auswertung der Interviewdaten verwendet. Der Prozess der Kategorienbildung wird detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Diana Schmidt (Author), 2018, Mütterliche Alkoholabhängigkeit und die kindliche Entwicklung. Potenzielle Auswirkungen und Effekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956411