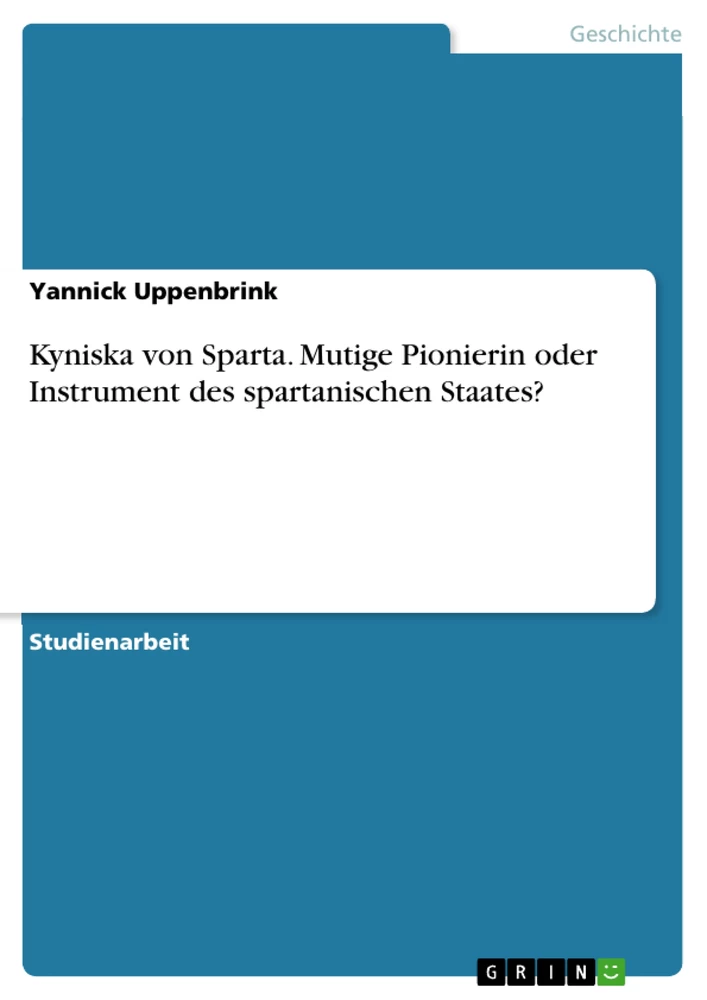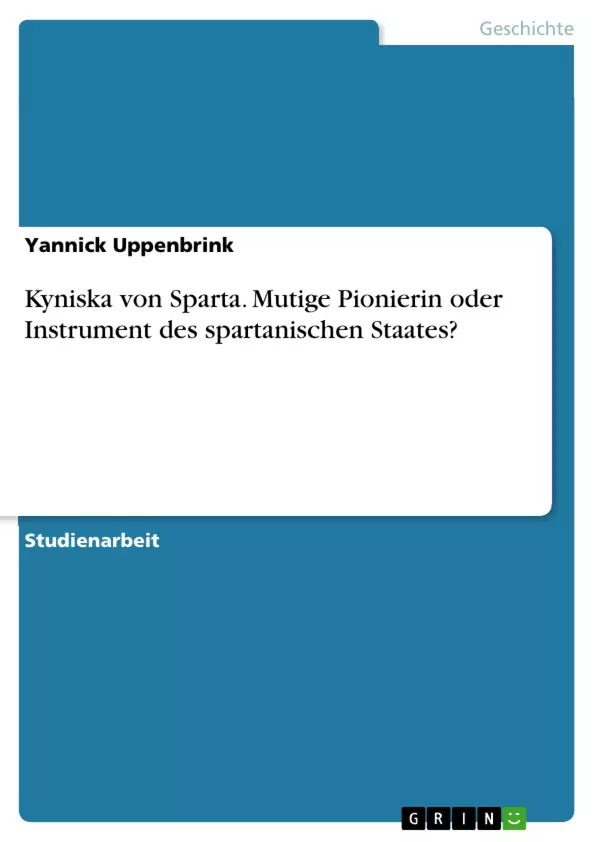Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Fall der Kyniska von Sparta, die den ersten Sieg einer Frau bei den olympischen Spielen im Jahr 396 v. Chr. erringen und ihren Erfolg vier Jahre später wiederholen konnte. Im Zentrum soll dabei folgende Fragestellung stehen: Unter welchen Umständen konnte Kyniska von Sparta den ersten Olympiasieg einer Frau im Jahr 396 v. Chr. erringen und welche Rolle spielte hierbei ihre königliche Familie, insbesondere ihr königlicher Bruder Agesilaos II.?
Nach einem kurzen Überblick über die zentrale Forschungsliteratur, soll zunächst auf den Zeitgeist, die politischen Verhältnisse und Hintergründe der Spiele sowie im Speziellen die Sonderrolle Spartas in der Griechischen Welt zu jener Zeit eingegangen werden. Im zweiten Teil soll auf Basis einiger epigraphischer Quellen sowie derer antiker Autoren Kyniskas Sieg mit besonderem Fokus auf den Motiven der Teilnahme an den antiken Olympischen Agonen dargelegt und diskutiert werden. Ziel der Arbeit ist es, schlussendlich zu klären, ob von einem Sieg aus persönlicher Motivation und somit von einer mutigen Pionierin gesprochen werden kann oder ob vielmehr die königliche Verwandtschaft Kyniskas, insbesondere ihr Bruder Agesilaos II., jene zur Teilnahme an den Agonen gedrängt und als Instrument für seine politischen Motive missbraucht hat. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Die Sonderrolle Spartas
- Das Verhältnis Spartas zu Olympia
- Die Spartaner und die Olympischen Spiele
- Die Rolle des spartanischen Bruder-Königs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Fall der Kyniska von Sparta, der ersten Frau, die im Jahr 396 v. Chr. bei den Olympischen Spielen siegte. Sie analysiert die Umstände ihres Triumphs und die Rolle ihrer königlichen Familie, insbesondere ihres Bruders Agesilaos II., dabei.
- Die Bedeutung Spartas in der griechischen Welt im 4. Jahrhundert v. Chr.
- Die Rolle der spartanischen Königsfamilie im Kontext der Olympischen Spiele
- Die Motive der Teilnahme an den antiken Olympischen Agonen
- Die Frage der persönlichen Motivation Kyniskas im Vergleich zu möglichen politischen Einflussnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach den Umständen von Kyniskas Olympiasieg und der Rolle ihrer königlichen Familie.
Das Kapitel "Forschungsstand" bietet einen Überblick über die bestehende Forschungsliteratur zum Thema Sparta, Olympia und dem Verhältnis der beiden Geschlechter in der spartanischen Gesellschaft.
Im Kapitel "Die Sonderrolle Spartas" wird das Verhältnis Spartas zu Olympia und die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten vom 7. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr. analysiert. Dabei wird insbesondere auf die Rolle Spartas bei der Gestaltung der Olympischen Spiele und den Bruch im Peloponnesischen Krieg eingegangen.
Das Kapitel "Die Rolle des spartanischen Bruder-Königs" befasst sich mit der Rolle von Agesilaos II. im Kontext der Olympischen Spiele und der möglichen Motivation Kyniskas Teilnahme an den Agonen.
Schlüsselwörter
Olympia, Sparta, Kyniska, Agesilaos II., Olympiasieg, Frauen in der Antike, Politische Motivation, Persönliche Motivation, Sport und Politik, Historische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Kyniska von Sparta?
Kyniska war eine spartanische Prinzessin und die erste Frau, die einen Sieg bei den antiken Olympischen Spielen (im Wagenrennen 396 v. Chr.) errang.
Warum durfte Kyniska an den Olympischen Spielen teilnehmen?
Beim Wagenrennen wurde nicht der Lenker, sondern der Besitzer der Pferde als Sieger geehrt. Da Kyniska die Besitzerin war, konnte sie den Sieg erringen, obwohl Frauen die Teilnahme sonst untersagt war.
Welche Rolle spielte ihr Bruder Agesilaos II.?
Es wird diskutiert, ob Agesilaos seine Schwester zur Teilnahme drängte, um zu beweisen, dass Siege im Wagenrennen nur von Reichtum und nicht von männlicher Tugend abhängen.
War Kyniska eine Pionierin oder ein Instrument der Politik?
Die Arbeit untersucht, ob sie aus persönlichem Mut handelte oder als politisches Werkzeug ihres Bruders missbraucht wurde, um den spartanischen Staat zu repräsentieren.
Was war das Besondere an der Erziehung spartanischer Frauen?
Im Gegensatz zu anderen griechischen Stadtstaaten genossen spartanische Frauen mehr Freiheiten und nahmen an sportlichen Übungen teil, was Kyniskas Erfolg begünstigte.
Wie oft siegte Kyniska in Olympia?
Kyniska konnte den Erfolg im Wagenrennen mit dem Viergespann zweimal erringen: im Jahr 396 v. Chr. und erneut vier Jahre später im Jahr 392 v. Chr.
- Quote paper
- Yannick Uppenbrink (Author), 2018, Kyniska von Sparta. Mutige Pionierin oder Instrument des spartanischen Staates?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956784