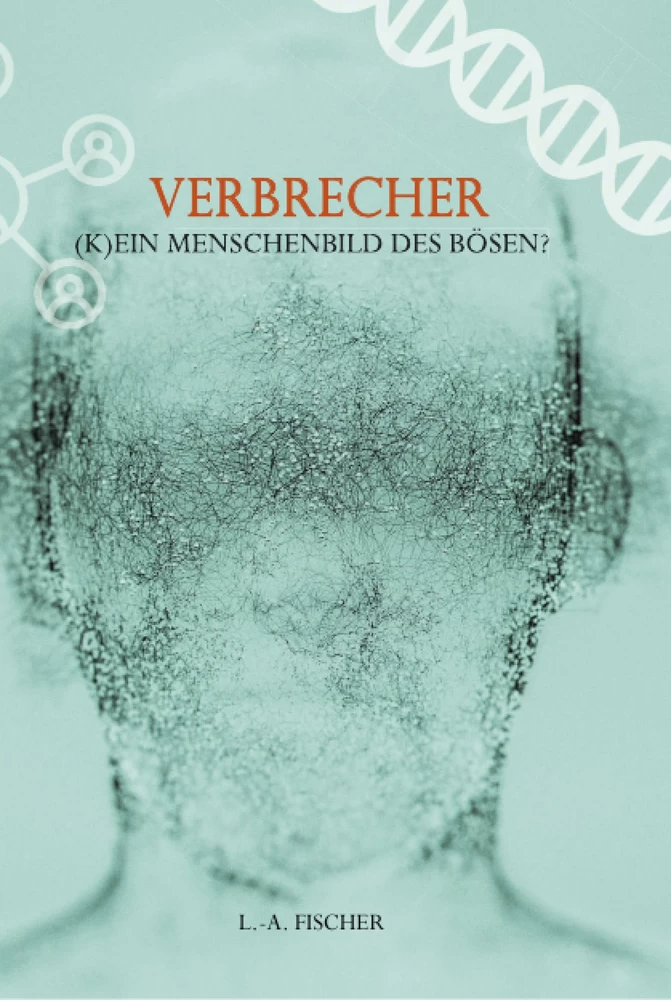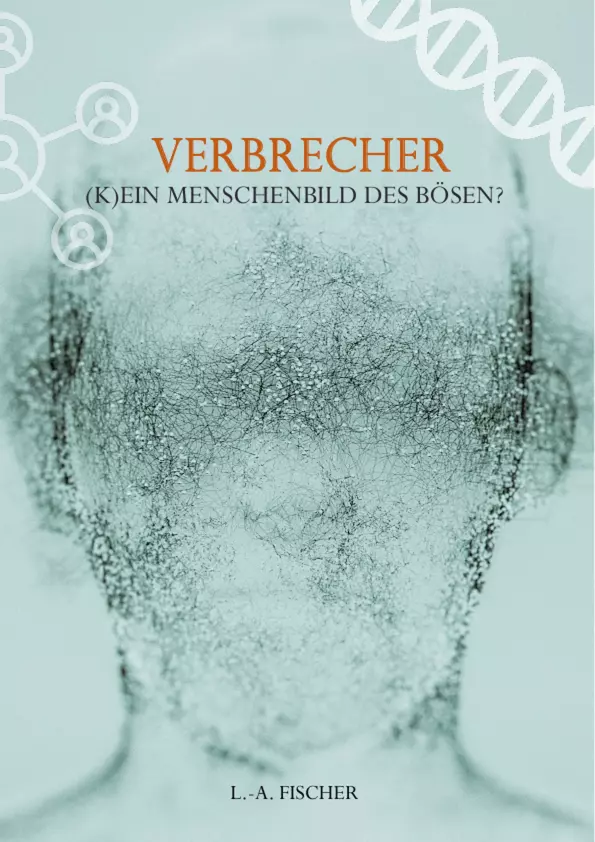Ziel dieser Masterarbeit ist es, der Frage nachzugehen, ob Mord unter Menschen eine Folge gesellschaftlicher Irrwege ist – und in Grenzen resozialisierbar – oder ob es sich um ein biologisches Erbe handelt.
Zudem wird hinterfragt, inwiefern Serienmörder eine Personifikation des Bösen widerspiegeln und anthropologischen Theorien des reinen und guten Herzens widersprochen werden kann.
Dabei soll ein Blick hinter die Fassaden ermöglicht werden, um einerseits die Gefühle, Gedanken und Absichten von Serienmördern zu analysieren und andererseits die Theorien, Forschungen und Streitigkeiten der Disziplinen kritisch zu hinterfragen und mit einem kleinen Funken Hoffnung zu versöhnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das verbrecherische Böse? – eine Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau und Ziele
- 2. Ein theoretischer Einblick – die Saat des Boshaften
- 2.1 Verbrecherische Menschenbilder
- 2.2 Die Anthropologie des Guten und des Bösen
- 2.3 Serienmörder – ein Rätsel des Bösen
- 3. Als Mörder geboren oder zum Mörder gemacht?
- 3.1 Der geborene Verbrecher
- 3.1.1 L'Uomo delinquente di Cesare Lombroso
- 3.1.2 Die evolutionären Wurzeln von Gewalt und Verbrechen
- 3.1.3 Zwillings- und Adoptionsstudien
- 3.1.4 Das Mörder-Gen – Utopie oder Realität?
- 3.1.5 Gehirn eines Mörders – Vermessung des Bösen?
- 3.2 Biografien – hinter der Fassade der Wirklichkeit
- 3.2.1 Risiko Bindungsstörung?
- 3.2.2 Mörderische Sozialisationshintergründe
- 3.2.3 Edmund Emil Kemper III
- 3.2.3.1 Kindheit und familiärer Hintergrund
- 3.2.3.2 Prägende Einflüsse – ein Erklärungsversuch
- 3.3 Eine biosoziale Perspektive
- 3.3.1 Das Phänomen der Resilienz
- 3.3.2 Zusammenspiel von Umwelt und Genetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Entstehung von Serienmord aus anthropologischer, kriminologischer und sozialpädagogischer Perspektive. Sie hinterfragt die Debatte um den "geborenen" versus "gemachten" Mörder und analysiert das Zusammenspiel von genetischen Faktoren, biographischen Erfahrungen und gesellschaftlichen Einflüssen. Die Arbeit strebt nach einem differenzierten Verständnis der Thematik, ohne dabei simplifizierende Erklärungen zu liefern.
- Anthropologische Betrachtung des Guten und des Bösen
- Kriminologische Theorien zur Erklärung von Kriminalität
- Die Rolle von Genetik und Umwelt bei der Entstehung von Gewalt
- Analyse von Biografien serieller Täter
- Das Konzept der Resilienz und biosoziale Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das verbrecherische Böse? – eine Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Serienmordes ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Ursprung des Bösen und seiner Rolle bei der Entstehung von Gewaltverbrechen. Es verdeutlicht die historische Perspektive auf Mord und Gewalt und hebt die besondere Faszination und Angst hervor, die der Serienmord in der Gesellschaft auslöst. Das Kapitel legt den Fokus auf die moralische Relativierung der Schuld und die Bedeutung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Es differenziert zwischen verschiedenen Arten von Mord und skizziert die zentrale Frage der Arbeit: Ist Mord eine Folge gesellschaftlicher Missstände oder ein biologisches Erbe?
2. Ein theoretischer Einblick – die Saat des Boshaften: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene kriminologische Theorien und Menschenbilder im Kontext von Kriminalität. Es beginnt mit der klassischen Schule und deren utilitaristischem Menschenbild, geht dann über zu den positivistischen Ansätzen der italienischen kriminalanthropologischen Schule (Lombroso), der französischen kriminalsoziologischen Schule (Durkheim, Merton) und der Marburger Schule (von Liszt). Es werden Lerntheorien (Sutherland, Bandura), Sozialisationstheorien (Parsons, Bales, Kohlberg), Labeling-Theorien und Kontrolltheorien diskutiert, um die Komplexität der Ursachen kriminellen Verhaltens aufzuzeigen. Schließlich wird die Frage nach dem Ursprung von Gut und Böse aus verschiedenen Perspektiven (Theologie, Philosophie, Pädagogik) betrachtet, um ein grundlegendes Verständnis für die Thematik zu schaffen.
3. Als Mörder geboren oder zum Mörder gemacht?: Dieses Kapitel untersucht die aktuelle Debatte um die Ursachen von Serienmord. Es beleuchtet biologische Theorien, wie die kriminalanthropologische Theorie Lombrosos und die Rolle der Evolution, sowie genetische Ansätze (MAOA-Gen) und die Ergebnisse von Zwillings- und Adoptionsstudien. Der Fokus liegt auf der Frage, ob ein "Mörder-Gen" existiert und ob biologische Faktoren allein ausreichen, um Kriminalität zu erklären. Im Gegenzug werden biographische Aspekte, die Bedeutung der Bindungstheorie (Bowlby, Ainsworth), die Rolle traumatischer Kindheitserfahrungen und die Analyse des Falls von Edmund Emil Kemper III präsentiert. Das Kapitel schließt mit einer biosozialen Perspektive ab, die das Zusammenspiel von genetischen und umweltbedingten Faktoren sowie das Phänomen der Resilienz berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Serienmord, Kriminalität, Anthropologie, Menschenbild, Gut und Böse, Genetik, Umwelt, Biosoziale Perspektive, Resilienz, Bindungstheorie, Sozialisation, Kriminalitätstheorien, Cesare Lombroso, MAOA-Gen, Edmund Emil Kemper III, Biographische Analyse, Prävention.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Das verbrecherische Böse?
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Entstehung von Serienmord aus anthropologischer, kriminologischer und sozialpädagogischer Perspektive. Sie beleuchtet die komplexe Frage, ob Serienmörder „geboren“ oder „gemacht“ sind, und analysiert das Zusammenspiel von genetischen Faktoren, biographischen Erfahrungen und gesellschaftlichen Einflüssen.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit eingenommen?
Die Arbeit betrachtet Serienmord aus anthropologischer, kriminologischer und sozialpädagogischer Sicht. Sie untersucht verschiedene Theorien zur Erklärung von Kriminalität, von der klassischen Schule bis hin zu modernen biosozialen Modellen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse von Biografien serieller Täter und dem Konzept der Resilienz.
Welche Theorien werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert diverse kriminologische Theorien, darunter die klassische Schule, der Positivismus (Lombroso), die französische kriminalsoziologische Schule (Durkheim, Merton), die Marburger Schule (von Liszt), Lerntheorien (Sutherland, Bandura), Sozialisationstheorien (Parsons, Bales, Kohlberg), Labeling-Theorien und Kontrolltheorien. Darüber hinaus werden biologische Theorien, die Bindungstheorie (Bowlby, Ainsworth) und biosoziale Modelle betrachtet.
Welche Rolle spielen genetische Faktoren?
Die Arbeit untersucht die Rolle von genetischen Faktoren, insbesondere das MAOA-Gen, und bewertet die Ergebnisse von Zwillings- und Adoptionsstudien. Sie hinterfragt die Hypothese eines „Mörder-Gens“ und diskutiert, inwiefern biologische Faktoren allein die Entstehung von Serienmord erklären können.
Welche Bedeutung haben biographische Faktoren?
Biographische Aspekte, wie traumatisierende Kindheitserfahrungen und die Bedeutung der Bindungstheorie, spielen eine zentrale Rolle. Die Analyse des Falls von Edmund Emil Kemper III dient als Beispiel für den Einfluss von familiärem Hintergrund und prägenden Einflüssen.
Wie wird das Konzept der Resilienz behandelt?
Die Arbeit berücksichtigt das Konzept der Resilienz, also die Fähigkeit, trotz schwieriger Lebensumstände psychisch gesund zu bleiben. Es wird untersucht, wie Resilienz das Zusammenspiel von genetischen und umweltbedingten Faktoren beeinflusst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung in die Thematik des Serienmordes, Kapitel 2 gibt einen theoretischen Überblick über verschiedene kriminologische Theorien und Menschenbilder, und Kapitel 3 untersucht die Debatte um „geborene“ versus „gemachte“ Mörder und analysiert das Zusammenspiel von biologischen und biographischen Faktoren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Serienmord, Kriminalität, Anthropologie, Menschenbild, Gut und Böse, Genetik, Umwelt, Biosoziale Perspektive, Resilienz, Bindungstheorie, Sozialisation, Kriminalitätstheorien, Cesare Lombroso, MAOA-Gen, Edmund Emil Kemper III, Biographische Analyse, Prävention.
- Arbeit zitieren
- L.-A. Fischer (Autor:in), 2020, Verbrecher. (K)Ein Menschenbild des Bösen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956816