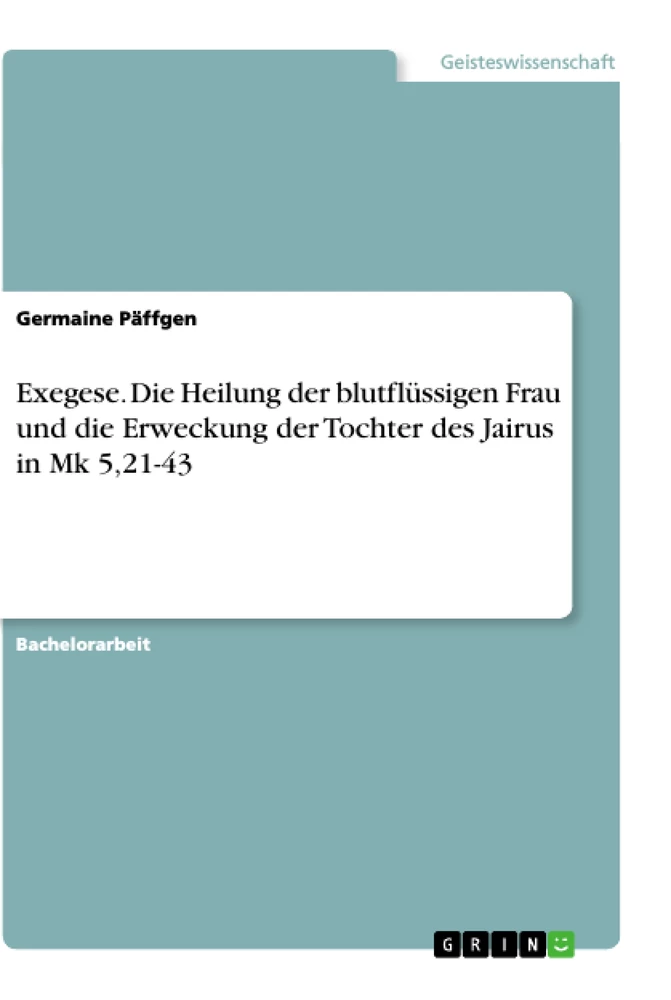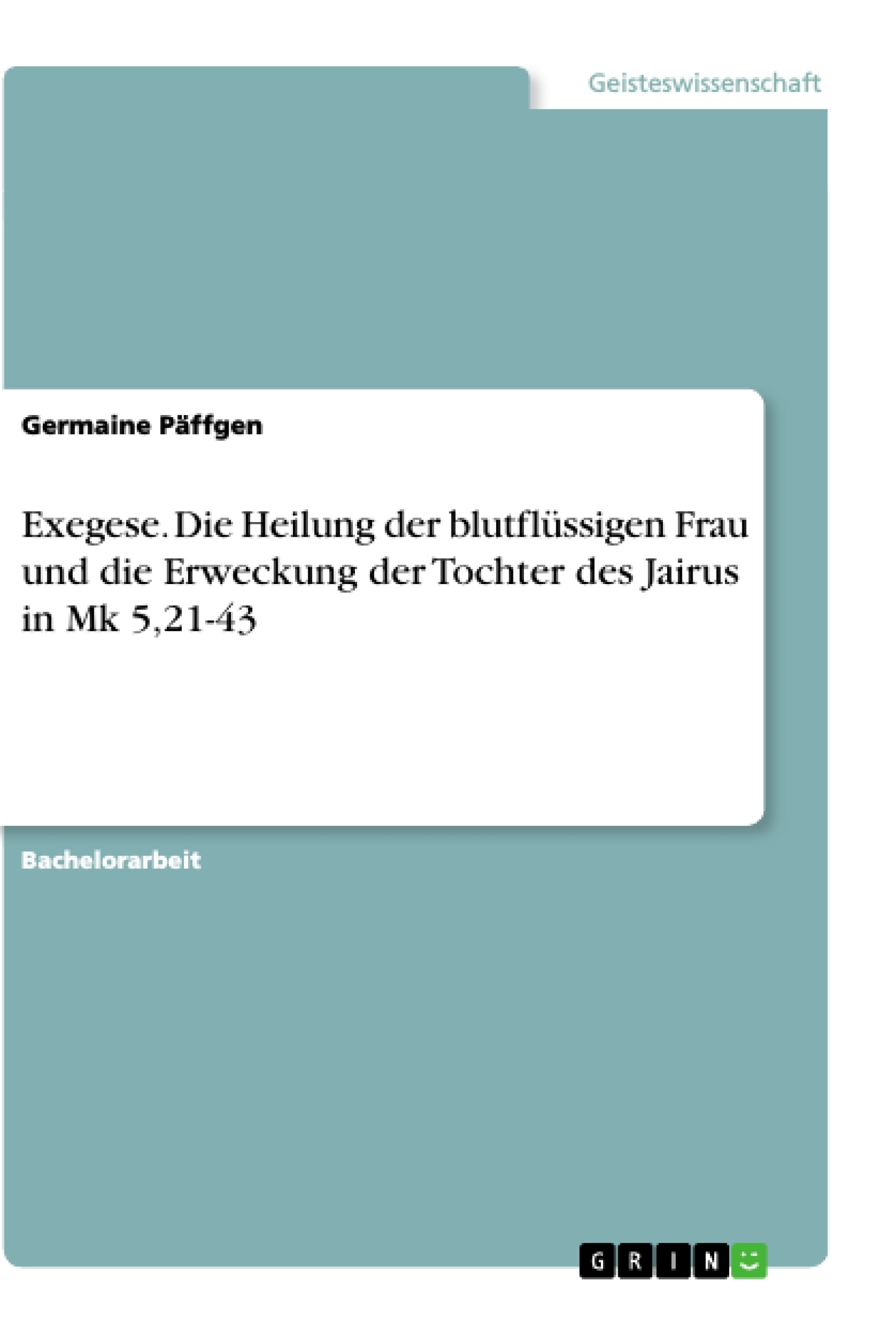Thema dieser Arbeit ist die Exegese der Perikope Mk 5,21-43 – die Heilung der Tochter des Jairus und die Heilung einer blutflüssigen Frau. Für die Auswahl des Textes war zunächst das Markusevangelium als Beispiel für eine narrative biblische Theologie, die in exegetischen Recherchen häufig anzutreffen ist und großes Interesse weckt, bestimmend. Aufgrund der weiblichen Gestalten fällt die Perikope auf und regt dazu an, sich auch der Frage nach der Rolle der Frau innerhalb des Markusevangeliums zu nähern, wobei dieser Aspekt nur geringfügig in die Arbeit einfließt, aber dennoch mit ein Grund dafür war, die Auswahl zu treffen.
Zudem lud neben dem theologischen Interesse der psychologische Charakter der Perikope zu einer näheren Beschäftigung mit dem Doppeldrama ein.
Ziel der Arbeit ist es, die Perikope Mk 5,21-43 mithilfe einer historisch-kritischen Analyse zu verstehen und zu deuten, um dessen theologische Gestalt zu erfassen, und sich der Bibel, besonders dem Markusevangelium, als einem geschichtlichen Ort anzunähern.
Aufgrund der nicht in vollem Umfang zufriedenstellenden Kenntnisse der griechischen Sprache wird von einer eigenen Übersetzung des Textes abgesehen und stattdessen auf die Einheitsübersetzung zurückgegriffen.
Eine synchrone Bearbeitung eröffnet den Hauptteil, indem eine syntaktische und eine semantische Analyse durchgeführt wird, um den Text in seine Sinnabschnitte zu gliedern. Im Anschluss wird eine Form- und Gattungskritik vorgenommen. Dazu wird der Text hinsichtlich des Sitzes im Leben erörtert. Zudem wird verdeutlicht, aus welcher Situation heraus er entstanden ist.
Darauf folgt die diachrone Betrachtungsweise des Textes. Dazu zählen die Motiv- und Traditionskritik sowie die Redaktionskritik.
Eine Einzelauslegung erhellt schließlich die Bedeutung der einzelnen Verse, um infolgedessen eine abschließende theologische Gesamtwertung vorzunehmen und Perspektiven für die gegenwärtige Bedeutung des Textes aufzuzeigen.
Der Abschnitt über die Wirkungsgeschichte zeigt letztlich einen kurzen Einblick über die Bedeutung der Perikope im Laufe der Kirchengeschichte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Synchrone Textanalyse
- Synchrone Literarkritik
- Syntaktische Analyse
- Grammatikalische Syntaktik
- Stilistische Syntaktik
- Semantische Analyse
- Textsemantik
- Gliederung
- Form- und Gattungskritik
- Die Frage nach dem genus litterarium
- „Sitz im Leben“
- Patternanalyse nach Gerd Theißen
- Diachrone Analyse
- Motiv- und Traditionskritik
- Überlieferungs- und Redaktionskritik
- Synoptischer Vergleich
- Einzelauslegung
- Theologische Kritik
- Wirkungsgeschichte
- Literaturverzeichnis
- Materialblätter
- Tabellarische Darstellung der Pronominalverweisung
- Tabellarische Darstellung der Konjunktionen
- Semantische Oppositionen und Parallelen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Perikope Mk 5,21-43 mithilfe einer historisch-kritischen Analyse zu verstehen und zu deuten, um deren theologische Gestalt zu erfassen. Dabei wird der Fokus auf die Bedeutung der Perikope als geschichtlicher Ort, insbesondere im Kontext des Markusevangeliums, gelegt.
- Die synchrone und diachrone Analyse der Perikope Mk 5,21-43
- Die Rolle der Frau im Markusevangelium
- Die Bedeutung der Heilungswunder im Markusevangelium
- Die theologischen Implikationen der Perikope
- Die Wirkungsgeschichte der Perikope in der Kirchengeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer ausführlichen synchrone Textanalyse der Perikope Mk 5,21-43, die eine syntaktische und semantische Analyse umfasst. Hier werden die einzelnen Sinnabschnitte des Textes identifiziert und analysiert, um einen tieferen Einblick in die Struktur und Bedeutung des Textes zu gewinnen. Im Anschluss wird eine Form- und Gattungskritik durchgeführt, die den Sitz im Leben der Perikope und deren Entstehungsbedingungen beleuchtet.
Die diachrone Analyse befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Perikope, indem sie die Motiv- und Traditionskritik sowie die Redaktionskritik einbezieht. Der Vergleich mit anderen synoptischen Evangelien soll Aufschluss über die Überlieferung und die Redaktionsgeschichte des Textes geben.
Eine Einzelauslegung der einzelnen Verse dient der tieferen Interpretation der Bedeutung des Textes. Hier werden auch theologische Aspekte der Perikope beleuchtet, die wiederum Perspektiven für die gegenwärtige Bedeutung des Textes eröffnen. Der Abschnitt über die Wirkungsgeschichte vermittelt schließlich einen kurzen Einblick in die Rezeption der Perikope im Laufe der Kirchengeschichte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Heilungswunder, der Rolle der Frau im Markusevangelium, der synoptischen Evangelien, der literarkritischen Analyse, der theologischen Interpretation, der Wirkungsgeschichte, der Perikope Mk 5,21-43, der biblischen Exegese und der Geschichte der Kirchengeschichte. Dabei werden wichtige Methoden der historischen und literarischen Analyse eingesetzt, um die Entstehung und Bedeutung des Textes zu erschließen.
- Citation du texte
- Germaine Päffgen (Auteur), 2019, Exegese. Die Heilung der blutflüssigen Frau und die Erweckung der Tochter des Jairus in Mk 5,21-43, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956826