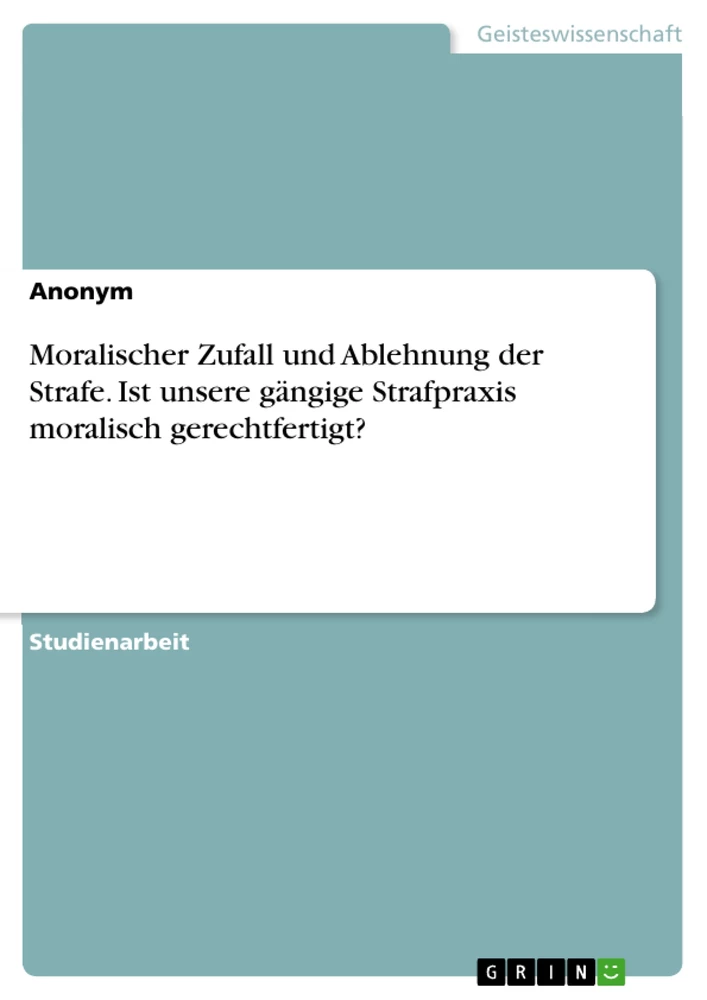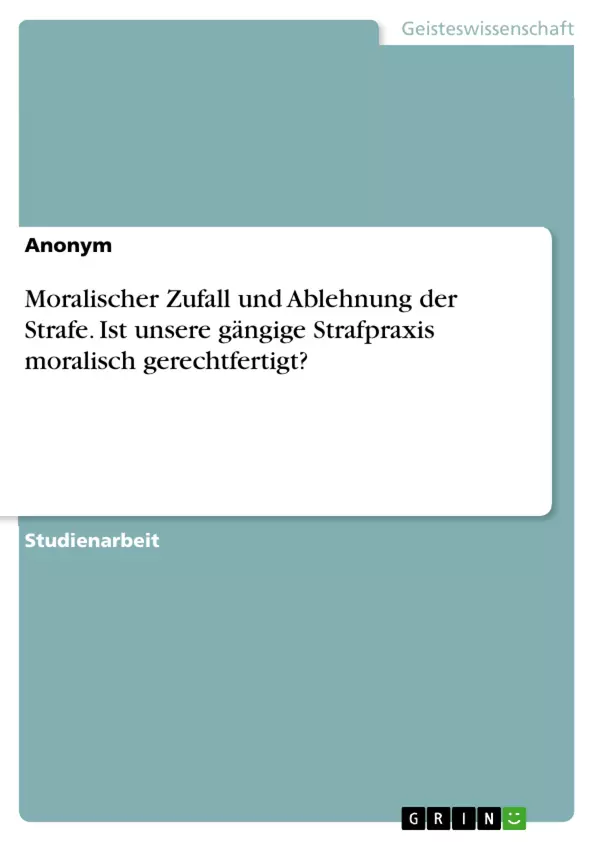Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage: Ist unsere gängige Strafpraxis moralisch gerechtfertigt? Das gegenwärtige Strafrecht in Deutschland kennt zwei Arten der Strafe: Freiheitsstrafen und Geldstrafen. Im Allgemeinen verstehen wir unter Strafe die Zufügung eines Übels als Reaktion auf eine unerwünschte Handlung. Dem Bestraften geschieht etwas Unangenehmes und der Strafende muss jemandem ein Übel zufügen. Deshalb muss es eine gute Begründung dafür geben, dass der Staat zum Strafen berechtigt ist.
Die Sichtweise des amerikanischen Philosophen Michael J. Zimmerman zum Thema der Rechtfertigung staatlicher Strafen gibt Anlass zum Nachdenken. In seinem Buch „The Immorality of Punishment“ argumentiert er dafür, die Strafpraxis vollkommen abzuschaffen, da staatliches Strafen nicht zu rechtfertigen und stets unmoralisch sei. Seinen Ausführungen zufolge darf niemals irgendjemand für irgendein Verbrechen bestraft werden.
Er begründet seine These damit, dass niemand für etwas verantwortlich gemacht werden kann, wenn es sich seiner Kontrolle entzieht und damit dem Zufall unterliegt. Damit spricht er sich gegen die Existenz des moralischen Zufalls aus und hält an einem extremen Kontrollprinzip fest.
Obwohl seine Argumentation schlüssig ist, wird seine These von vielen nicht akzeptiert, da es den meisten Menschen nicht recht ist, die staatliche Strafpraxis vollkommen abzuschaffen. Deshalb muss geprüft werden, ob Zimmermans Annahmen auch so getroffen werden können. Seine These gründet sich auf die Annahme, dass das sogenannte Kontrollprinzip uneingeschränkt anzuwenden und die Existenz des moralischen Zufalls abzulehnen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Position Michael J. Zimmerman
- 2.1 Argumentation in Stufen
- 2.2 Das Argument des moralischen Zufalls
- 2.3 Situationsbezogener Zufall
- 3 Die Debatte um den moralischen Zufall
- 3.1 Moralischer Zufall
- 3.2 Absurdität des Kontrollprinzips
- 3.3 Diskussion der Lösungsansätze
- 4 Zufall Wahrscheinlichkeit und Kontrolle
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Argumentation des amerikanischen Philosophen Michael J. Zimmerman, der in seinem Buch „The Immorality of Punishment“ für die Abschaffung der Strafpraxis plädiert. Sein Hauptargument ist, dass staatliches Strafen niemals moralisch gerechtfertigt sei, da niemand für etwas verantwortlich gemacht werden kann, wenn es sich seiner Kontrolle entzieht. Dabei steht Zimmermans Kritik an der Existenz des moralischen Zufalls im Zentrum der Argumentation.
- Das Argument des moralischen Zufalls und dessen Auswirkungen auf die Strafpraxis
- Die Unterscheidung zwischen resultatsbezogenem und situationsbezogenem Zufall in der Argumentation Zimmermans
- Die philosophischen Implikationen des Kontrollprinzips und seine Grenzen
- Die Problematik des moralischen Zufalls in Bezug auf Schuld und Verantwortlichkeit
- Alternative Lösungsansätze für die Frage nach der Rechtfertigung staatlicher Strafen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit setzt sich mit Michael J. Zimmermans Argumentation gegen die Strafpraxis auseinander. Zimmerman argumentiert, dass staatliches Strafen immer unmoralisch sei, da es auf dem Konzept des moralischen Zufalls basiert.
- Position Michael J. Zimmerman: Dieses Kapitel analysiert Zimmermans Argumentation in seinem Buch „The Immorality of Punishment“. Er stellt zwei Argumente vor, die den Schluss zulassen, dass staatliche Strafen niemals moralisch gerechtfertigt sein können.
- Argumentation in Stufen: Hierbei werden die beiden Hauptargumente Zimmermans vorgestellt. Er argumentiert sowohl gegen das Argument der Unwissenheit als auch gegen das Argument des moralischen Zufalls.
- Das Argument des moralischen Zufalls: Dieses Kapitel erläutert die zwei Kategorien des moralischen Zufalls, die Zimmerman unterscheidet: Resultatsbezogener Zufall und Situationsbezogener Zufall.
- Situationsbezogener Zufall: Hierbei wird die Bedeutung des situationsbezogenen Zufalls für Zimmermans Argumentation erläutert. Er argumentiert, dass selbst ein nicht versuchtes Verbrechen genauso zu strafen sei wie ein erfolgreich begangenes Verbrechen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Debatte um den moralischen Zufall und seine Auswirkungen auf die Rechtfertigung staatlicher Strafen. Zentrale Begriffe sind hierbei: Strafrecht, moralischer Zufall, Kontrollprinzip, resultatsbezogener Zufall, situationsbezogener Zufall, Schuld, Verantwortlichkeit, Rechtfertigung, Strafpraxis, Abschaffung.
Häufig gestellte Fragen
Warum lehnt Michael J. Zimmerman staatliches Strafen ab?
Zimmerman argumentiert, dass Strafe unmoralisch ist, da niemand für Handlungen verantwortlich gemacht werden kann, die sich seiner Kontrolle entziehen und somit dem Zufall unterliegen.
Was ist der "moralische Zufall"?
Moralischer Zufall beschreibt Situationen, in denen das moralische Urteil über eine Person von Faktoren abhängt, die sie nicht kontrollieren kann (z. B. ob ein Schuss trifft oder durch einen Windstoß abgelenkt wird).
Was unterscheidet resultatsbezogenen von situationsbezogenem Zufall?
Resultatsbezogener Zufall betrifft den Ausgang einer Tat, während situationsbezogener Zufall die Umstände betrifft, in denen sich eine Person befindet (z. B. ob man überhaupt in Versuchung gerät, ein Verbrechen zu begehen).
Was besagt das Kontrollprinzip?
Das Kontrollprinzip besagt, dass wir moralisch nur für das verantwortlich sind, was wir tatsächlich kontrollieren können. Zimmerman vertritt eine extreme Form dieses Prinzips.
Sollte ein versuchtes Verbrechen genauso bestraft werden wie ein vollendetes?
Nach Zimmermans Logik des situationsbezogenen Zufalls gäbe es keinen moralischen Unterschied zwischen dem Versuch und der Tat, da der Erfolg oft vom Zufall abhängt – letztlich lehnt er jedoch die Strafe für beides ab.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Moralischer Zufall und Ablehnung der Strafe. Ist unsere gängige Strafpraxis moralisch gerechtfertigt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957056