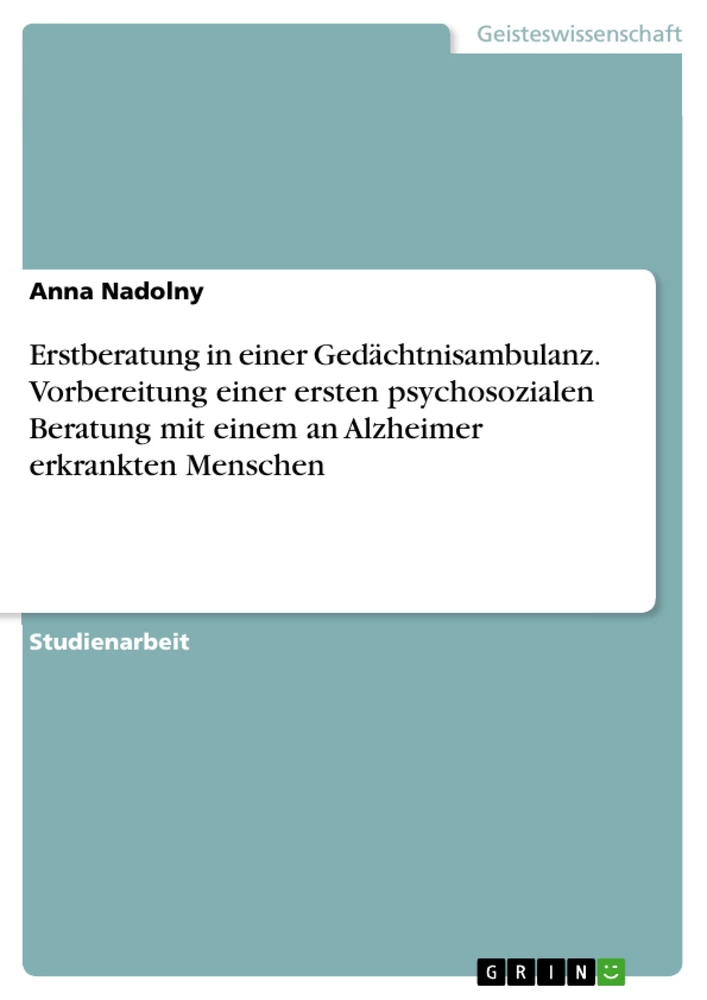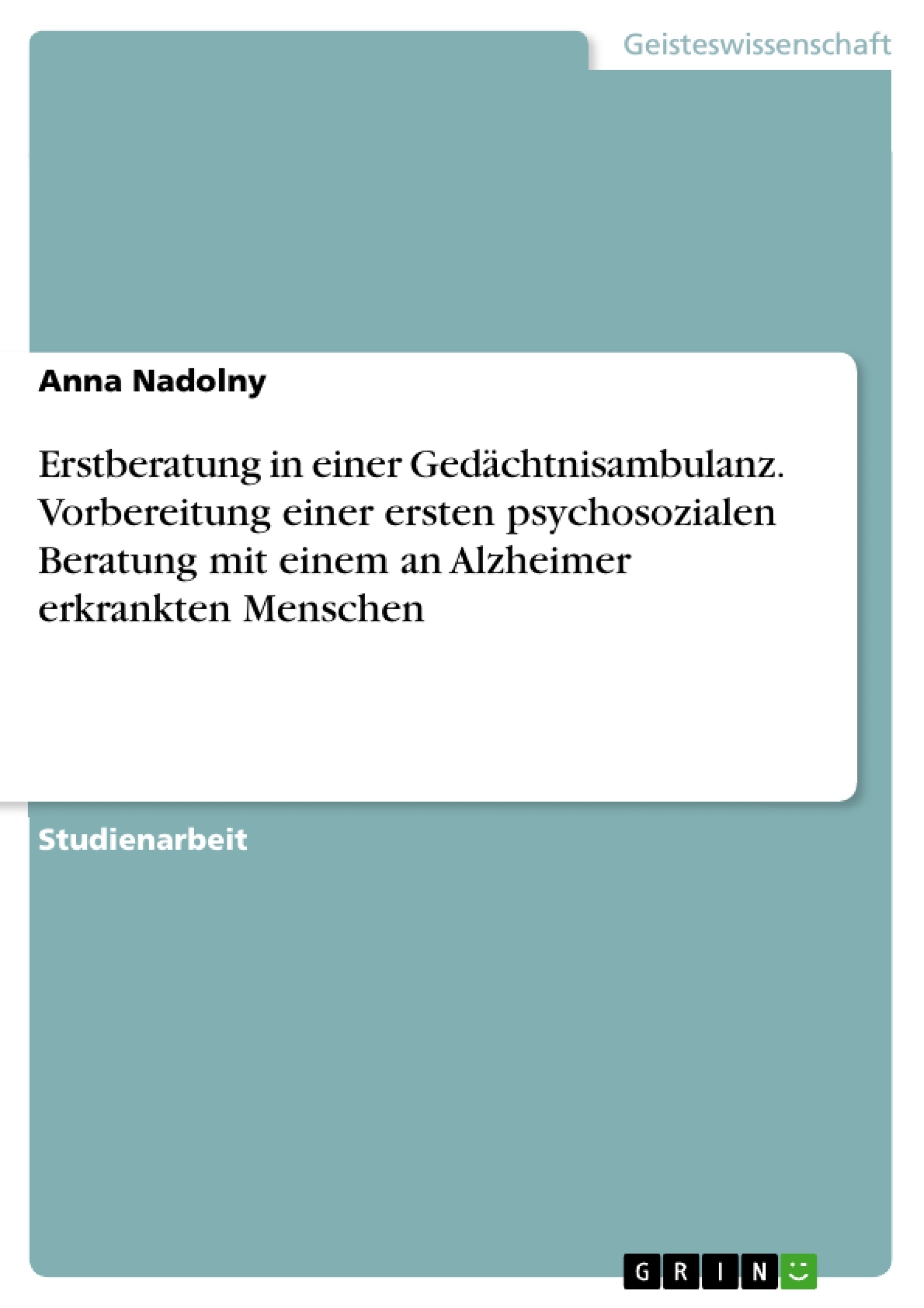In dieser Hausarbeit wird ein Fallbeispiel geschildert, in dem es um ein Erstberatungsgespäch mit einem an Alzheimer erkrankten Menschen geht. Es wird dabei zuerst der individuelle Fall geschildert und auf familiäre und soziale Umstände eingegangen. Bei der Beratung im Rahmen der Diagnosestellung geht es vordergründig um die Beratung und den Informationsaustausch. Wichtig ist zu besprechen, worauf sich Betroffene und Angehörige einstellen müssen, welche Angebote es gibt (Therapien und Gruppen) und auch Informationsmaterial bereitzustellen. Außerdem sollten Informationen über das "wohnortnahe Hilfesystem" und konkrete Ansprechpartner bereitgestellt werden.
Nachdem der Patient, Hermann B., 58 Jahre alt und seit nun 20 Jahren innerhalb einer Firma als Versicherungsinformatiker tätig, über Beschwerden wie Schlafmangel und Nervosität sowie in beruflicher Hinsicht über Konzentrationsprobleme und Überforderung bei seinem Hausarzt klagte, wurde er mit Verdacht auf Demenz an die Gedächtnisambulanz überwiesen, um die Symptome innerhalb einer Diagnostik abzuklären.
Auch scheint das Familiensystem bereits unter Herr B.s Symptomen beziehungsweise seiner persönlichen "Veränderung" zu leiden. Die Ehefrau berichtet über Vergesslichkeit und darüber, dass er in Gesprächen oft den Faden verliere. Außerdem sei er antriebslos und seine Stimmung sehr schwankend. Am Sozialen lebe nehme er kaum noch teil und meide Kinobesuche oder Treffen mit Freunden. Früher habe ihm all das große Freude bereitet.
Inhaltsverzeichnis
- Die zu bedenkenden Umstände des Falles
- Nicht-medikamentöse psychosoziale Behandlungsmöglichkeiten
- Aspekte für das erste und die folgenden Beratungsgespräche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Vorbereitung einer ersten psychosozialen Beratung eines Patienten mit Alzheimer-Erkrankung in einer Gedächtnisambulanz. Ziel ist es, den Ablauf der ersten Beratung unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen eines Patienten mit Demenz aufzuzeigen und verschiedene Aspekte der psychosozialen Betreuung zu beleuchten.
- Die spezifischen Herausforderungen der Diagnosefindung und der Kommunikation mit dem Patienten
- Die Bedeutung von psychosozialen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Demenz
- Die Rolle der Familie und des sozialen Umfelds in der Betreuung von Menschen mit Demenz
- Die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Ressourcen des Patienten bei der Planung der Behandlung
- Die Nutzung verschiedener Therapieansätze zur Verbesserung der Lebensqualität des Patienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die zu bedenkenden Umstände des Falles
Dieses Kapitel beschreibt den Fall des Patienten Herrn B. und seine anfänglichen Symptome wie Schlafmangel, Nervosität und Konzentrationsschwierigkeiten. Es beleuchtet die Auswirkungen der Krankheit auf seine Familie und den schwierigen Umgang mit der Diagnose.
Nicht-medikamentöse psychosoziale Behandlungsmöglichkeiten
Dieser Abschnitt befasst sich mit verschiedenen psychosozialen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Demenz. Hier werden die Bedeutung einer individuellen Therapieplanung, verschiedene Therapieformen wie Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Verhaltenstherapie sowie deren Vorteile für den Patienten und seine Angehörigen erläutert. Die Bedeutung der Gesprächsgruppen für den Austausch und die Unterstützung für den Patienten und seine Familie wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Seminararbeit behandelt die Vorbereitung einer ersten psychosozialen Beratung eines Patienten mit Alzheimer-Erkrankung in einer Gedächtnisambulanz. Die zentralen Schlüsselwörter sind Demenz, Alzheimer-Erkrankung, psychosoziale Beratung, Gedächtnisambulanz, Diagnosefindung, Kommunikation, Behandlungsmöglichkeiten, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächsgruppen, Familie, soziales Umfeld, Ressourcen, individuelle Bedürfnisse und Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen zur Erstberatung bei Alzheimer
Was ist das Ziel einer Erstberatung in einer Gedächtnisambulanz?
Das Ziel ist die Aufklärung über die Diagnose, der Informationsaustausch über Krankheitsverlauf und Hilfesysteme sowie die psychosoziale Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen.
Welche Symptome können auf eine beginnende Demenz hinweisen?
Häufige Anzeichen sind zunehmende Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme, Orientierungslosigkeit in Gesprächen, Antriebslosigkeit und starke Stimmungsschwankungen.
Welche nicht-medikamentösen Behandlungen gibt es?
Dazu zählen Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Verhaltenstherapie sowie die Teilnahme an Gesprächsgruppen für Patienten und Angehörige.
Wie wichtig ist das soziale Umfeld bei einer Alzheimer-Diagnose?
Das soziale Umfeld ist entscheidend, da die Angehörigen oft die Hauptlast der Betreuung tragen. Eine frühzeitige Einbindung in Beratungsgespräche hilft, das Familiensystem zu stabilisieren.
Was versteht man unter einem "wohnortnahen Hilfesystem"?
Es umfasst lokale Angebote wie Pflegedienste, Tagespflegeeinrichtungen, Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, die den Alltag der Betroffenen unterstützen.
- Citar trabajo
- Anna Nadolny (Autor), 2020, Erstberatung in einer Gedächtnisambulanz. Vorbereitung einer ersten psychosozialen Beratung mit einem an Alzheimer erkrankten Menschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957828