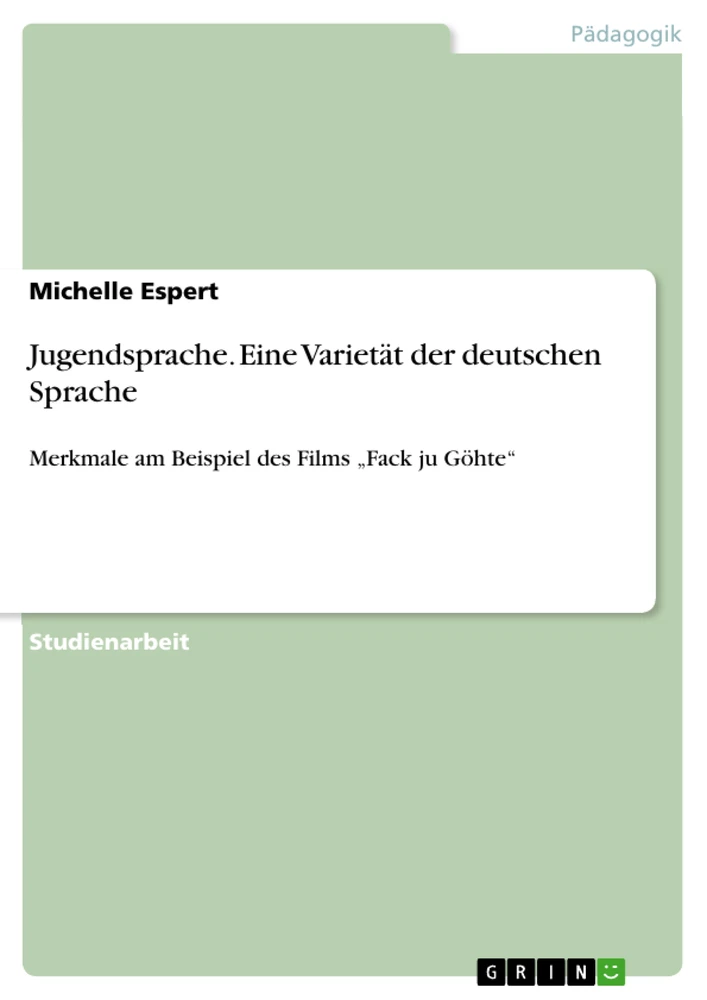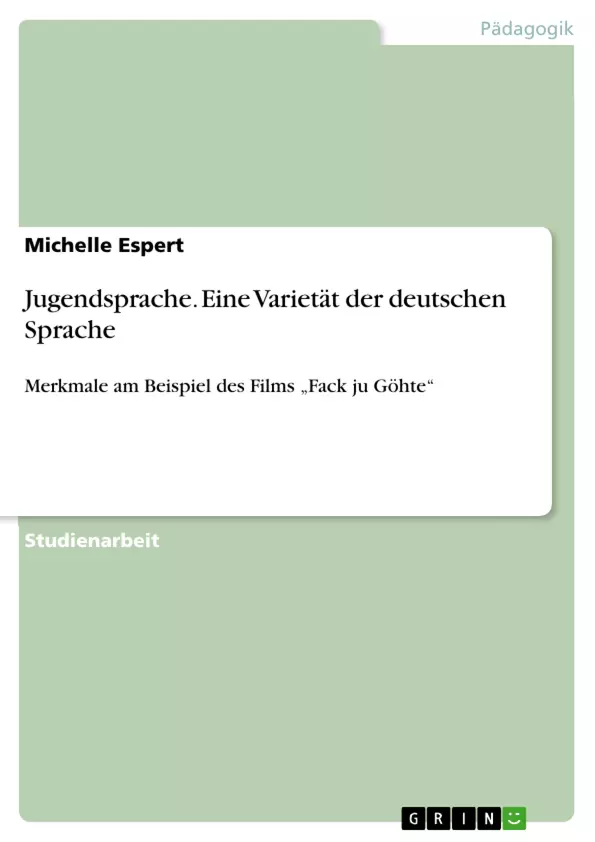Die Konfrontation mit sprachlichen Varietäten findet man sowohl im Alltag als auch in der Schule, da auch dort oft unterschiedliche Stilarten der gesprochenen Sprache vertreten sind. Sollte man demnach die verschiedenen Varietäten in den Unterricht einbauen, um das Sprachbewusstsein zu fördern? Wie lässt sich das Thema „Jugendsprache“ konkret in den Unterricht einbeziehen?
Im ersten Teil dieser Arbeit wird zunächst mit der Definition des Terminus Varietät begonnen und anschließend werden die Termini Soziolekt und Jugendsprache geschichtlich genauer eingeordnet und definiert. Danach werden die linguistischen Merkmale der Jugendsprache anhand Gesprächsbeispielen aus dem Film „Fack ju Göthe“ genauer betrachtet und herausgearbeitet.
Im Anschluss wird ein Bezug zum Unterricht geschaffen. Der Stellenwert von Varietäten bzw. der Jugendsprache im Bildungsplan wird veranschaulicht, Themen und Ziele für den Unterricht werden festgehalten und zum Schluss bietet die Arbeit methodische Beispiele zur Umsetzung des Themas Jugendsprache in den Unterricht.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Varietät – eine kurze Einordnung
2.1 Standardsprache
2.2 Soziolekt
3. Jugendsprache
3.1 Herkunft und Entwicklung der Jugendsprache
3.2 Merkmale am Beispiel von Ausschnitten des Film’s „Fack ju Göhte“
3.2.1 Die phonologische Ebene
3.2.2 Die lexikalische Ebene
3.2.3 Die morphologische Ebene
3.2.4 Die syntaktische Ebene
4. Jugendsprache im Deutschunterricht
4.1 Stellenwert der Jugendsprache im Bildungsplan
4.2 Themen und Ziele zur methodischen Umsetzung im Deutschunterricht
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Michelle Espert (Author), 2019, Jugendsprache. Eine Varietät der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957921