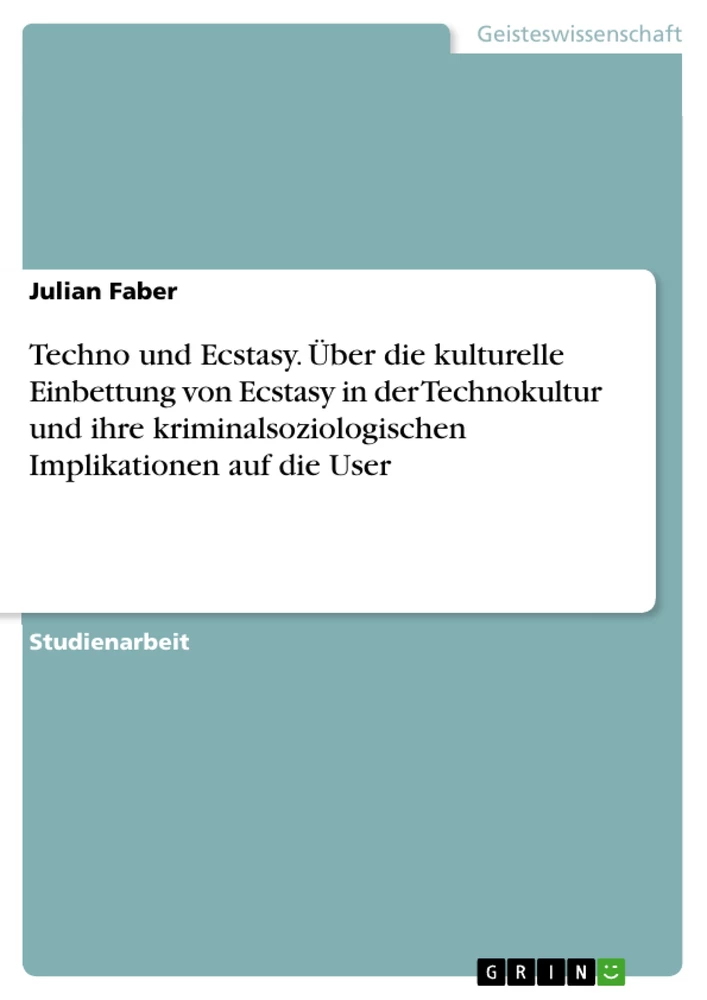Die große Fragestellung dieser Arbeit lautet: Ist der Ecstasy-Konsum als Phänomen einer Teilmenge von Anhängern der Technokultur als soziales Problem zu verstehen? Innerhalb des vorgegebenen Rahmens kann in der Beantwortung freilich kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Deshalb zerfällt die große Fragestellung konkret in mehrere Aspekte, welche sich wie folgt ausgestalten: Welche Gefahren und Risiken werden dem Ecstasy-Konsum in der Technokultur bezüglich Selbst- und Fremdschädigung zugeschrieben? Ist der Ecstasy-Konsum in diesem Kontext als Suchtverhalten zu deuten? Warum genau ist der Ecstasy-Konsum innerhalb der Techno-Kultur so attraktiv und warum lassen sich die User auch vor dem Hintergrund einer strafbaren Handlung nicht davon abhalten? Und nicht zuletzt: Ist davon auszugehen, dass die Delinquenz des Ecstasy-Konsums dazu führt, dass deviantes und/oder delinquentes Verhalten zunehmend auch innerhalb der Alltagswelt in Erscheinung tritt?
Die Summe dieser Fragen zielt darauf ab zu klären, ob die Technokultur das ernstzunehmende Potential besitzt den Lebensweg vornehmlich junger Menschen durch delinquente Kulturelemente wie den Rauschmittelkonsum entscheidend zu prägen und so kriminelle Karrieren zu determinieren. Der Bedeutungszenit des Techno ist offenbar überschritten und ein Großteil der ihm gewidmete soziologische Aufmerksamkeit hat sich dieser Entwicklung angepasst. [...] Die mit ausführlichsten und gleichzeitig aktuellsten Beiträge zur deutschen Technokultur, welche zur Beantwortung dieser Fragen maßgeblich herangezogen werden sind die explorativen und empirischen Studien der Trierer Forschungsgruppen um Roland Eckert (2000) und Ronald Hitzler (2001) sowie die kriminalsoziologischen Untersuchungen von Hartmut Klöckner (2001). Ihre Erkenntnisse werden mit jenen einiger weiterer Autoren und (soweit diese vorliegen) mit aktuellen Daten abgeglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Thematische Einleitung
- 1.2 Methodik, Aufbau und Ziele dieser Arbeit
- 2. Ecstasy, MDMA, XTC
- 2.1 Begriffsklärung
- 2.2 Pharmakologische Eigenschaften
- 2.3 Anzahl der User
- 3. Erlebniswelt Techno
- 3.1 Soziodemographische Merkmale des Techno-Publikums
- 3.2 Habitus, Normen und Wertvorstellungen
- 3.2.1 Distinktion
- 4. Bedeutung und kulturelle Einbettung von Ecstasy …
- 4.1 Konsummotive und -kontext
- 4.2 Gefahren und Suchtpotential
- 5. Techno: (Noch) Subkultur?
- 6. Erklärungsansatz: Individualisierungstheorem
- 7. Konklusion
- 8. Literaturverzeichnis
- 9. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob der Ecstasy-Konsum innerhalb der Technokultur als soziales Problem betrachtet werden kann. Sie beleuchtet die Gefahren und Risiken des Ecstasy-Konsums, untersucht die Attraktivität des Ecstasy-Konsums innerhalb der Technokultur und analysiert, ob der Ecstasy-Konsum zu devianten oder delinquenten Verhaltensweisen führt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, ob die Technokultur junge Menschen in eine kriminelle Karriere führen kann.
- Die Gefahren und Risiken des Ecstasy-Konsums für die Selbst- und Fremdschädigung.
- Die Frage, ob der Ecstasy-Konsum in diesem Kontext als Suchtverhalten verstanden werden kann.
- Die Attraktivität des Ecstasy-Konsums innerhalb der Technokultur.
- Der Zusammenhang zwischen dem Ecstasy-Konsum und delinquentem Verhalten.
- Die Bedeutung der Technokultur für die Entwicklung junger Menschen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und den methodischen Ansatz der Arbeit dar. Sie beleuchtet den Begriff des sozialen Problems und erläutert die spezifischen Ziele der Analyse.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Rauschmittel Ecstasy, indem es die Begriffsklärung, die pharmakologischen Eigenschaften und die Anzahl der User im Detail beleuchtet.
Kapitel 3 beschreibt die Erlebniswelt Techno, indem es die soziodemographischen Merkmale des Techno-Publikums und die prägenden Normen und Wertvorstellungen beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht die Bedeutung und kulturelle Einbettung von Ecstasy in der Technokultur. Es analysiert die Konsummotive und -kontexte sowie die Gefahren und das Suchtpotential von Ecstasy.
Kapitel 5 befasst sich mit der Frage, ob die Technokultur noch als Subkultur gelten kann.
Kapitel 6 präsentiert das Individualisierungstheorem als Erklärungsansatz für das Phänomen von Techno und Rauschmittelkonsum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Technokultur, des Ecstasy-Konsums, der Kriminalsoziologie, dem Individualisierungstheorem und der Subkulturforschung. Sie analysiert die gesellschaftlichen Implikationen des Ecstasy-Konsums und die Frage, ob die Technokultur ein soziales Problem darstellt.
Häufig gestellte Fragen
Ist Ecstasy-Konsum in der Technokultur ein soziales Problem?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und beleuchtet die Risiken der Selbstschädigung sowie die kulturelle Akzeptanz der Droge innerhalb dieser spezifischen Szene.
Warum ist Ecstasy in der Techno-Szene so attraktiv?
Die pharmakologische Wirkung (Entaktogen) passt ideal zum gemeinschaftlichen Erleben und dem Wunsch nach Entgrenzung und Ausdauer beim Tanzen.
Führt Ecstasy-Konsum zwangsläufig zu kriminellen Karrieren?
Die Arbeit analysiert, ob die Delinquenz des Drogenbesitzes auf andere Lebensbereiche ausstrahlt oder ob der Konsum meist auf die "Erlebniswelt Techno" beschränkt bleibt.
Was besagt das Individualisierungstheorem in diesem Kontext?
Es erklärt den Drogenkonsum als Versuch junger Menschen, in einer komplexen, individualisierten Welt Identität und intensive Gemeinschaftserlebnisse zu konstruieren.
Wie wird das Suchtpotential von Ecstasy eingeschätzt?
Die Studie diskutiert die psychische Abhängigkeit und die neurotoxischen Gefahren bei Langzeitkonsum im Vergleich zur subjektiven Wahrnehmung der User.
- Citar trabajo
- Julian Faber (Autor), 2020, Techno und Ecstasy. Über die kulturelle Einbettung von Ecstasy in der Technokultur und ihre kriminalsoziologischen Implikationen auf die User, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/957960