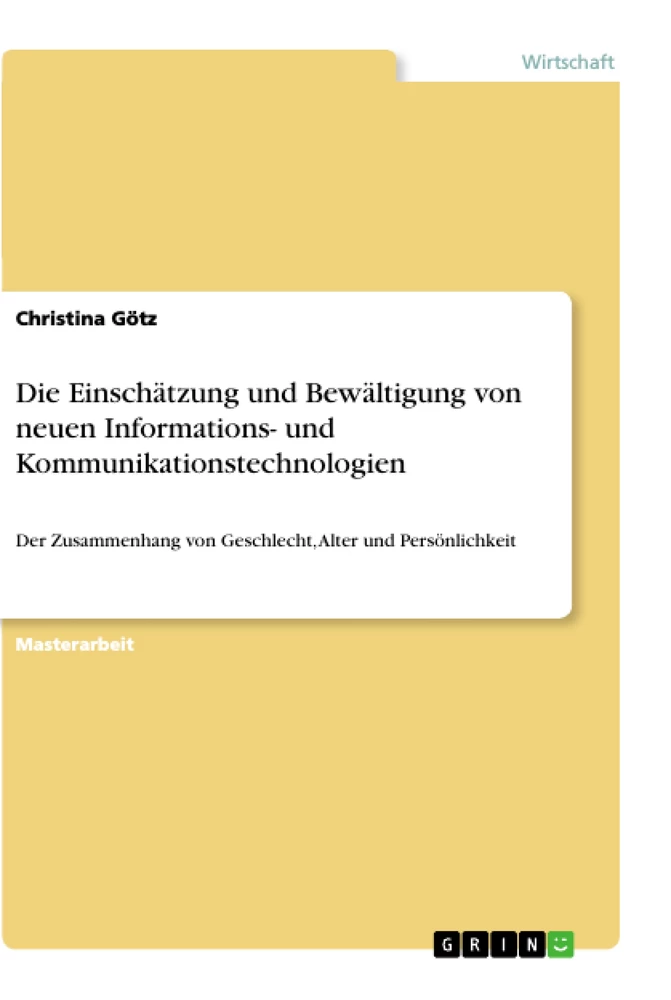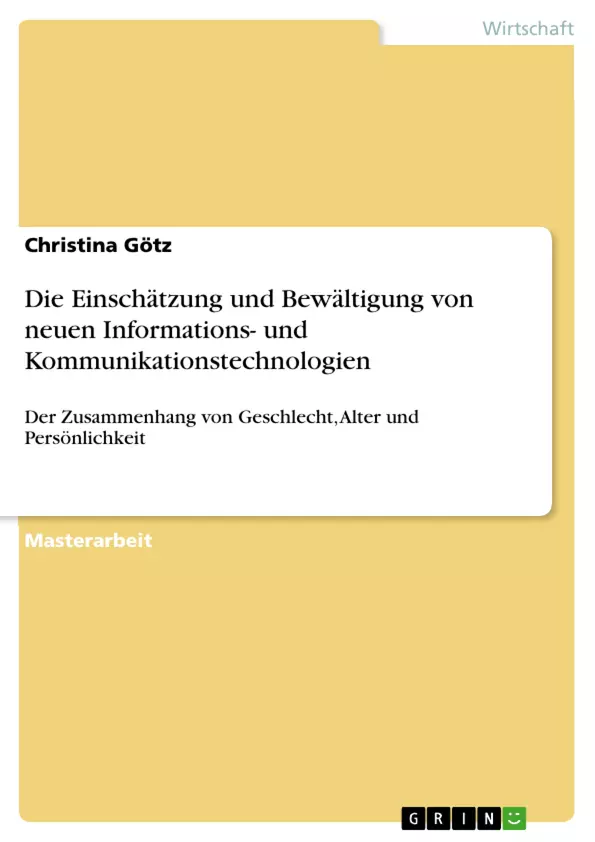Ziel der Arbeit ist es, das Ausmaß des durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ausgelösten Stresses sowie dessen Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Unternehmen darzustellen. Aus Unternehmenssicht werden oft nur die Vorteile der Digitalisierung und des damit verbundenen Anstiegs des Stresslevels, der kurzfristig zu einem Leistungsanstieg führen kann, beachtet. Allerdings kann die Belastung der Mitarbeiter langfristig eine Vielzahl an Folgen haben, die sowohl die Beschäftigten als auch die Arbeitgeber negativ treffen können. Deshalb wird in dieser Arbeit zunächst eine theoretische Basis geschaffen, um das Phänomen Technostress im betrieblichen Umfeld messen zu können.
Anschließend wird die Wahrnehmung und Bewältigung des digitalen Stresses untersucht. Dabei sollen besonders die individuellen Faktoren, die das Technostressniveau beeinflussen, herausgearbeitet werden. An dieser Stelle sollen keine Kausalaussagen über die Nutzung von digitalen Technologien und den körperlichen und 3 psychologischen Folgen getroffen werden, sondern lediglich Unterschiede und Zusammenhänge zwischen den demografischen sowie den persönlichen Eigenschaften und der Wahrnehmung der Technostressoren und Technostress Inhibitoren aufgezeigt werden.
Um zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen geben zu können, werden die erhobenen Daten zum einen hinsichtlich der demografischen Merkmale differenziert. Hier wird auf die Ergebnisse der Studien von Maier (2014) und Maier, Laumer & Eckhardt (2015) zurückgegriffen, in denen Differenzen zwischen Arbeitnehmern unterschiedlichen Alters und Geschlechts aufgezeigt werden konnten. Aber auch bezüglich der Persönlichkeit der Mitarbeiter gibt es Unterschiede bei der Technostresswahrnehmung und -bewältigung. Für Unternehmen ist andererseits eine Differenzierung in Bezug auf die Ausbildung und die Technologiekompetenz wichtig, um zielgerichtete Maßnahmen zur Technostressvermeidung und -reduktion einleiten zu können
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau
- 2. Theoretische Einordnung der Fragestellung
- 2.1 Das Konstrukt Stress
- 2.1.1 Transaktionales Stressmodell
- 2.1.2 Arbeitspsychologisches Stressmodell
- 2.1.3 Folgen von Stress
- 2.2 Technostress
- 2.2.1 Definitorische Einordnung
- 2.2.2 Ursachen und Entstehung von Technostress
- 2.3 Stressbewältigung - Coping
- 2.3.1 Definition von Stressbewältigung
- 2.3.2 Stressbewältigungsstrategien
- 2.4 Persönlichkeitsmodell der Big Five
- 2.5 Aktueller Stand der Forschung
- 3. Hypothesenableitung
- 3.1 Fragestellung 1
- 3.2 Fragestellung 2
- 3.3 Fragestellung 3
- 3.4 Fragestellung 4
- 4. Forschungsdesign und Methoden
- 4.1 Fragebogenentwicklung
- 4.2 Datenerhebung und Stichprobe
- 4.3 Methodik der Datenauswertung
- 4.3.1 Deskriptive Statistik
- 4.3.2 Faktorenanalyse
- 4.3.3 Reliabilitätsanalyse
- 4.3.4 Berechnung von Einflussgrößen
- 4.3.5 Regressionsanalyse
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Fragestellung 1
- 5.1.1 Prüfung der Voraussetzungen
- 5.1.2 Faktorenanalyse
- 5.1.3 Reliabilitätsanalyse
- 5.1.4 Deskriptive Statistik
- 5.2 Fragestellung 2
- 5.2.1 Prüfung der Voraussetzungen
- 5.2.2 Ungepaarter t-Test
- 5.2.3 Kruskal-Wallis-Rangvarianz-Analyse und Post-Hoc-Test
- 5.3 Fragestellung 3
- 5.3.1 Prüfung der Voraussetzungen
- 5.3.2 Zusammenhangsanalysen
- 5.4 Fragestellung 4
- 5.4.1 Prüfung der Voraussetzungen
- 5.4.2 Multiple Regressionsanalyse
- 5.4.3 Pearson Produkt-Moment-Korrelation
- 6. Diskussion und Implikationen für zukünftige Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Einschätzung und Bewältigung von Technostress und deren Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und Persönlichkeit. Ziel ist es, die Wahrnehmung und Bewältigung von Technostress zu messen und Unterschiede hinsichtlich demografischer Merkmale und Persönlichkeitsfaktoren zu identifizieren.
- Messung der Wahrnehmung und Bewältigung von Technostress
- Einfluss demografischer Faktoren (Geschlecht, Alter) auf Technostress
- Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Technostress
- Identifikation weiterer Einflussfaktoren auf Technostress
- Ableitung von Implikationen für zukünftige Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit: Dieses einleitende Kapitel beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, die Einschätzung und Bewältigung von Technostress und deren Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und Persönlichkeit zu untersuchen. Der Aufbau der Arbeit wird detailliert dargestellt, um dem Leser einen klaren Überblick über die Struktur und den Ablauf der Forschungsarbeit zu geben. Es wird die methodische Vorgehensweise skizziert und die einzelnen Kapitel kurz vorgestellt.
2. Theoretische Einordnung der Fragestellung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende theoretische Grundlage für die Arbeit. Es werden verschiedene Stressmodelle, insbesondere das transaktionale Stressmodell und arbeitspsychologische Modelle, vorgestellt und deren Relevanz für das Verständnis von Technostress erläutert. Der Begriff Technostress wird definiert und seine Ursachen sowie Entstehung werden detailliert beschrieben. Weiterhin wird das Konzept der Stressbewältigung (Coping) behandelt, verschiedene Strategien vorgestellt und das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit (Big Five) im Kontext von Technostress eingeordnet. Abschließend wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema zusammengefasst und die Forschungslücke, die diese Arbeit schließt, hervorgehoben.
3. Hypothesenableitung: Aufbauend auf der theoretischen Grundlage werden in diesem Kapitel die Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit formuliert. Die zentralen Forschungsfragen untersuchen die Messbarkeit der Wahrnehmung von Technostressoren und -inhibitoren, Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewältigung von Technostress in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bildung, sowie weitere Einflussfaktoren und den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Technostress. Für jede Forschungsfrage werden spezifische Hypothesen formuliert, die im empirischen Teil der Arbeit überprüft werden.
4. Forschungsdesign und Methoden: In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign und die angewandten Methoden detailliert beschrieben. Es wird die Entwicklung des verwendeten Fragebogens erläutert, die Stichprobenerhebung und -beschreibung dargelegt sowie die methodischen Vorgehensweisen der Datenauswertung (deskriptive Statistik, Faktorenanalyse, Reliabilitätsanalyse, Regressionsanalyse) ausführlich dargestellt. Die Kapitel beschreibt die statistischen Verfahren, die zur Analyse der Daten verwendet werden, und begründet die Auswahl dieser Methoden.
Schlüsselwörter
Technostress, Stressbewältigung, Coping, Persönlichkeit (Big Five), Geschlecht, Alter, demografische Faktoren, Fragebogen, Faktorenanalyse, Regressionsanalyse, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Technostress, Bewältigung und Einflussfaktoren
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Wahrnehmung und Bewältigung von Technostress und deren Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und Persönlichkeit. Ziel ist die Messung von Technostress und die Identifizierung von Unterschieden basierend auf demografischen Merkmalen und Persönlichkeitsfaktoren.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Messbarkeit der Wahrnehmung von Technostressoren und -inhibitoren, Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewältigung von Technostress in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bildung, sowie weitere Einflussfaktoren und den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Technostress. Spezifische Hypothesen zu diesen Fragen werden formuliert und empirisch überprüft.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Stressmodelle, darunter das transaktionale Stressmodell und arbeitspsychologische Modelle. Der Begriff Technostress wird definiert und seine Ursachen sowie Entstehung detailliert beschrieben. Das Konzept der Stressbewältigung (Coping) und verschiedene Bewältigungsstrategien werden behandelt. Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit (Big Five) wird im Kontext von Technostress eingeordnet, und der aktuelle Forschungsstand wird zusammengefasst.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Datenerhebung erfolgt mittels eines eigens entwickelten Fragebogens. Die Datenanalyse umfasst deskriptive Statistik, Faktorenanalyse, Reliabilitätsanalyse und Regressionsanalyse. Die Auswahl der statistischen Verfahren wird ausführlich begründet.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit; 2. Theoretische Einordnung der Fragestellung; 3. Hypothesenableitung; 4. Forschungsdesign und Methoden; 5. Ergebnisse (inkl. detaillierter Auswertung der einzelnen Forschungsfragen); 6. Diskussion und Implikationen für zukünftige Forschung.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Datenanalyse für jede Forschungsfrage. Dies beinhaltet die Prüfung statistischer Voraussetzungen, die Anwendung von Verfahren wie t-Tests, Kruskal-Wallis-Test, Korrelationsanalysen und Regressionsanalysen, sowie die Interpretation der Ergebnisse.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das letzte Kapitel diskutiert die Ergebnisse im Kontext der theoretischen Grundlagen und leitet Implikationen für zukünftige Forschung ab. Es werden die Grenzen der Studie reflektiert und mögliche Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Technostress, Stressbewältigung, Coping, Persönlichkeit (Big Five), Geschlecht, Alter, demografische Faktoren, Fragebogen, Faktorenanalyse, Regressionsanalyse, empirische Forschung.
- Quote paper
- Christina Götz (Author), 2019, Die Einschätzung und Bewältigung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958071