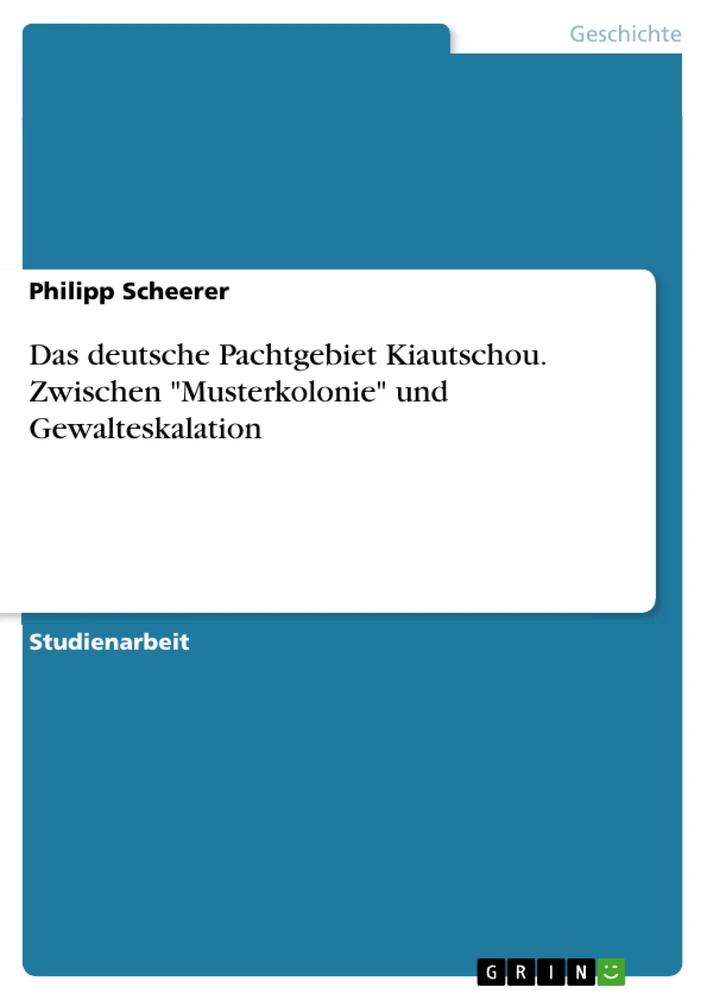In dieser Arbeit wird das von China an Deutschland verpachtete Gebiet "Kiautschou" genauer untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob es sich eher um eine Musterkolonie oder eine Gewalteskalation handelt.
Ausgehend von der Analyse des Handbuchs für das Schutzgebiet Kiautschou, in dem alle geltenden Verordnungen aufgeführt sind, sowie einiger überlieferter Schreiben geht diese Arbeit der Fragestellung nach, in welchem Maß das Konzept der deutschen ‚Musterkolonie‘ in China die Wahrnehmung kolonialer Gewalt beeinflusste.
Dabei wird zuerst auf den historischen Kontext eingegangen, um die Rahmenbedingungen, sprich das imperialistische Interesse der westlichen Mächte in China sowie das deutsche Vorgehen bei der Erlangung ihrer Musterkolonie, zu umreißen. Anschließend sollen wesentliche Aspekte des Handbuchs für das Schutzgebiet Kiautschou hinsichtlich der Gewaltanwendung und dessen Zweck in der ‚Musterkolonie‘ analysiert werden, bevor die Realität der kolonialen Gewalt anhand überlieferter Telegramme zwischen chinesischen Beamten und der militärischen Führung im ‚Marine-Hauptsitz‘ Qingdao dargestellt wird.
Die aus der Gegenüberstellung dieser Perspektiven gewonnenen Erkenntnisse sollen schließlich Auskunft darüber geben, inwiefern das Ziel, in Kiautschou eine ‚Musterkolonie‘ zu errichten, die Wahrnehmung kolonialer Gewalt beeinflusste. Aufgrund der Komplexität der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Thematik und des umfangreichen Literatur- und Quellenbestandes liegt der Fokus der Untersuchung auf den Anfangsjahren bis 1900, in denen das Konzept der ‚Musterkolonie‘ entstanden ist. Des Weiteren eigenen sich die ausgewählten Quellen gut für eine derartige Untersuchung, da mit dem Handbuch eine Art Überblick über die Marine-Akten, die die „Hauptquelle zur jüngsten deutschen Militärgeschichte“ sind, während die erhaltenen Telegramme den Gegenpol zu der deutschen Herrschaftsperspektive bilden. Auf diese Weise soll mit den einseitig tradierten Bildern einer ‚Musterkolonie‘ aus deutscher Sicht und eines „imperialistischen Aggressionsaktes“ aus chinesischer Perspektive gebrochen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- China im Zeitalter des Imperialismus
- China als Beuteobjekt fremder Staaten
- Das deutsche Pachtgebiet Kiautschou
- Koloniale Gewalt in Kiautschou
- Fazit Zwischen Musterkolonie und Gewalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Ausmaß, in dem das Konzept der deutschen „Musterkolonie“ in Kiautschou die Wahrnehmung kolonialer Gewalt beeinflusste. Sie analysiert den historischen Kontext des imperialistischen Interesses der Westmächte in China und das deutsche Vorgehen bei der Errichtung der Kolonie. Die Analyse des Handbuchs für das Schutzgebiet Kiautschou und überlieferter Telegramme soll unterschiedliche Perspektiven auf die koloniale Gewalt beleuchten.
- Der deutsche Imperialismus in China und die Errichtung der „Musterkolonie“ Kiautschou.
- Die Anwendung kolonialer Gewalt im deutschen Pachtgebiet Kiautschou.
- Die Wahrnehmung kolonialer Gewalt aus deutscher und chinesischer Perspektive.
- Der Einfluss des Konzepts der „Musterkolonie“ auf die Wahrnehmung kolonialer Gewalt.
- Analyse des Handbuchs für das Schutzgebiet Kiautschou als Quelle.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt Qingdao als ehemalige deutsche Kolonie. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Konzepts der „Musterkolonie“ auf die Wahrnehmung kolonialer Gewalt und skizziert die Methodik der Arbeit, die auf der Analyse des Handbuchs für das Schutzgebiet Kiautschou und überlieferten Telegrammen basiert. Der Fokus liegt auf den Anfangsjahren bis 1900.
China im Zeitalter des Imperialismus: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang Chinas von einer Blütezeit im 18. Jahrhundert zu einem Objekt des Imperialismus im 19. Jahrhundert. Es beleuchtet die inneren Unruhen in China und das Eingreifen europäischer Mächte, insbesondere Großbritanniens, das durch den Opiumhandel und die darauf folgenden Opiumkriege zur wirtschaftlichen Abhängigkeit Chinas führte. Der sinozentrische Widerstand gegen die eurozentrische Expansion wird hervorgehoben, und die „ungleichen Verträge“ mit ihren Konsequenzen für China werden erläutert.
Koloniale Gewalt in Kiautschou: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Text nur kurz angerissen ist) würde im vollständigen Text die koloniale Gewalt im deutschen Pachtgebiet Kiautschou detailliert untersuchen. Es würde die konkreten Maßnahmen der deutschen Kolonialmacht, die Reaktionen der chinesischen Bevölkerung und die Auswirkungen auf die Gesellschaft analysieren. Der Fokus läge auf der Diskrepanz zwischen dem Ideal der „Musterkolonie“ und der Realität der kolonialen Herrschaft.
Schlüsselwörter
Kiautschou, Musterkolonie, Kolonialismus, Imperialismus, China, Deutschland, Qing-Dynastie, koloniale Gewalt, Opiumkriege, ungleiche Verträge, Handbuch für das Schutzgebiet Kiautschou, Marine, wirtschaftliche Abhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Wahrnehmung kolonialer Gewalt in Kiautschou
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Konzepts der deutschen „Musterkolonie“ in Kiautschou auf die Wahrnehmung kolonialer Gewalt. Sie analysiert den historischen Kontext des deutschen Imperialismus in China und beleuchtet die Diskrepanz zwischen dem Ideal der „Musterkolonie“ und der Realität der kolonialen Herrschaft.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse basiert auf dem Handbuch für das Schutzgebiet Kiautschou und überlieferten Telegrammen. Der Fokus liegt auf den Anfangsjahren der deutschen Kolonie bis 1900.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den deutschen Imperialismus in China, die Errichtung und die Anwendung kolonialer Gewalt im deutschen Pachtgebiet Kiautschou, die Wahrnehmung kolonialer Gewalt aus deutscher und chinesischer Perspektive, und den Einfluss des Konzepts der „Musterkolonie“ auf diese Wahrnehmung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über China im Zeitalter des Imperialismus, ein Kapitel über koloniale Gewalt in Kiautschou, und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und Methodik. Das Kapitel über China beleuchtet den Übergang Chinas zu einem Objekt des Imperialismus, die Rolle des Opiumhandels und die „ungleichen Verträge“. Das Kapitel über Kiautschou analysiert die koloniale Gewalt im Detail (im vorliegenden Auszug nur kurz angerissen).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kiautschou, Musterkolonie, Kolonialismus, Imperialismus, China, Deutschland, Qing-Dynastie, koloniale Gewalt, Opiumkriege, ungleiche Verträge, Handbuch für das Schutzgebiet Kiautschou, Marine, wirtschaftliche Abhängigkeit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Ausmaß zu untersuchen, in dem das Konzept der „Musterkolonie“ die Wahrnehmung kolonialer Gewalt in Kiautschou beeinflusste. Sie analysiert den historischen Kontext und verschiedene Perspektiven auf die koloniale Gewalt.
Welche Kapitelzusammenfassung wird angeboten?
Es gibt Kapitelzusammenfassungen zur Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsmethodik), zu China im Zeitalter des Imperialismus (Chinas Übergang zu einem Objekt imperialistischer Begierde) und zu kolonialer Gewalt in Kiautschou (detaillierte Analyse, im Auszug nur angedeutet).
- Quote paper
- Philipp Scheerer (Author), 2017, Das deutsche Pachtgebiet Kiautschou. Zwischen "Musterkolonie" und Gewalteskalation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958113