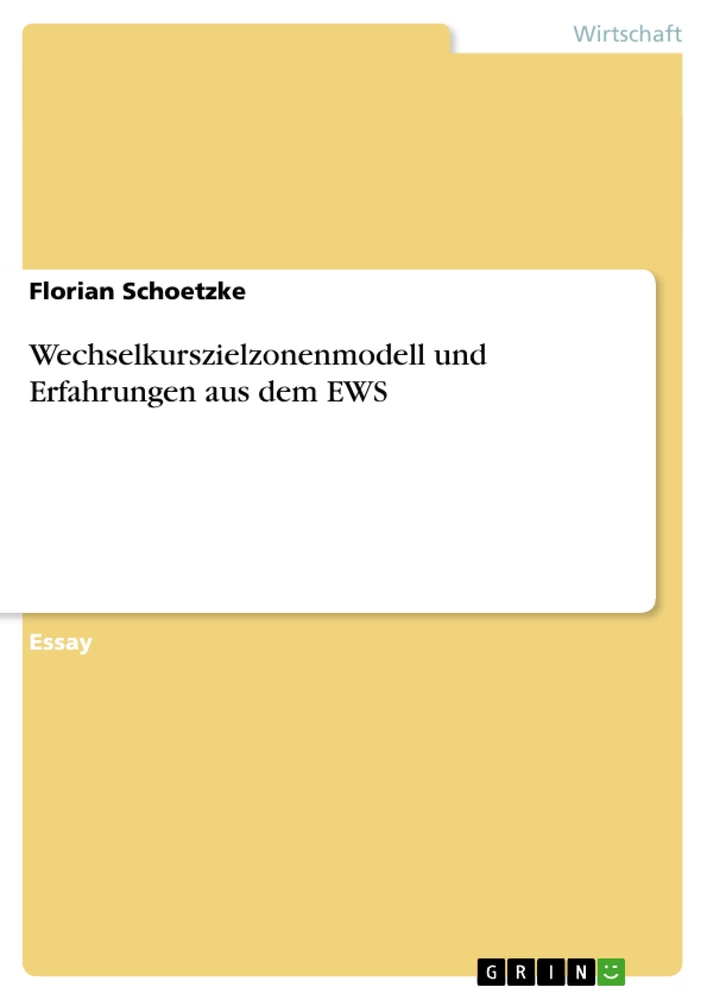Im folgendem wird die Funktionalität eines Wechselkurszielzonenmodells diskutiert.
Ein Wechselkurzzielzonenmodell soll die Vorteile des Regimes fester und des Regimes flexibler Wechselkurse kombinieren und gleichermaßen die entsprechenden Einflussmöglichkeiten des Staates auf monetäre Schocks von beiden Regimen vereinen. Im Unterschied zu einem Festkursregime sind die Schwankungsmargen für den Wechselkurs groß bemessen, so dass die Volatilität der Geldnachfrage ihren Niederschlag in Wechselkursbewegungen finden kann. Die Zielzone begrenzt aber den Spielraum für Wechselkursschwankungen und schließt damit fundamentale Veränderungen der ,,terms of trade", soweit sie monetär bestimmt sind, aus. Die Glaubwürdigkeit solch eines Systems wird durch die begrenzte Flexibilität der nominalen Wechselkurse und dem Versprechen der Stabilisierung innerhalb einer Bandbreite bestimmt.
Man darf in diesem Zusammenhang die Devisenmarktinterventionsstrategien zur Stabilisierung der Wechselkurse nicht mit Wechselkurszielzonensystemen verwechseln. Die Gemeinsamkeit besteht lediglich darin, dass die Notenbank durch Käufe bzw. Verkäufe von Fremdwährungen den Wechselkurs beeinflusst. Der Unterschied besteht aber darin, dass Devisenmarktinterventionen oft erst einsetzen, wenn der Kurs von vorgegebenen Zielvorstellungen abweicht. Zielzonen dagegen verlangen Interventionen bevor ein Überschreiten des Zielwerts (d.h. Bandbreite) auftritt. Dies können Interventionen nur sicherstellen, wenn sie nach dem Schock unverzüglich einsetzen.
Ich stelle im folgenden das Wechselkurszielzonenmodell von Krugman (1991) vor.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Funktionalität eines Wechselkurszielzonenmodells
- Devisenmarktinterventionsstrategien
- Das Wechselkurszielzonenmodell von Krugman (1991)
- Gütermarkt
- Geldmarkt
- Devisenmarkt
- Zentrale Annahmen im Modell von Krugman
- Die Wechselkursveränderungen innerhalb der Zielzone
- Rationale Erwartungen seitens der Akteure
- Kernaussage der S-Kurve
- Empirische Überprüfung des Modells
- Verteilung des Wechselkurses zwischen den beiden Bandgrenzen
- Korrelation der Zinsdifferenz zwischen inländischen und ausländischen Zins
- Widerlegung der Annahmen Krugmans in der Literatur
- Vollkommene Glaubwürdigkeit der Bandgrenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert das Wechselkurszielzonenmodell und untersucht dessen Funktionsweise. Dabei werden sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Erfahrungen aus dem Europäischen Währungssystem (EWS) herangezogen. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile des Modells aufzuzeigen und dessen Eignung als Instrument der Stabilitätspolitik zu beurteilen.
- Funktionalität des Wechselkurszielzonenmodells
- Devisenmarktinterventionen und deren Rolle
- Das Modell von Krugman (1991) und dessen zentrale Annahmen
- Empirische Überprüfung des Modells und dessen Gültigkeit
- Kritik und Weiterentwicklungen des Modells in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der Fragestellung, die die Funktionsweise des Zielzonenmodells beleuchtet. Anschließend wird die Funktionalität des Modells im Detail diskutiert, wobei die Vorteile und die Nachteile eines festen und flexiblen Wechselkursregimes gegenübergestellt werden. Der Autor erläutert, wie Zielzonenmodelle die Vorteile beider Regime vereinen können, während gleichzeitig die Einflussmöglichkeiten des Staates auf monetäre Schocks erhöht werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Devisenmarktinterventionen und Zielzonensystemen. Im weiteren Verlauf wird das Wechselkurszielzonenmodell von Krugman (1991) vorgestellt, wobei die zentralen Annahmen des Modells sowie die Auswirkungen auf die Geldmenge und den Wechselkurs analysiert werden. Die Bedeutung rationaler Erwartungen seitens der Marktteilnehmer wird ebenfalls beleuchtet. Abschließend werden die empirischen Ergebnisse des Modells anhand von Beispielen aus dem EWS diskutiert. Dabei werden die Schwächen des Modells und die Widersprüche zu den empirischen Beobachtungen aufgezeigt. Der Autor zeigt auf, dass die Annahmen Krugmans in der Literatur widerlegt wurden und dass die Entwicklung der Geldmenge nicht immer dem angenommenen Random Walk folgt. Schließlich wird die Bedeutung der Glaubwürdigkeit der Bandgrenzen für die Funktionsweise des Modells hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Wechselkurszielzonenmodell, Europäisches Währungssystem (EWS), Devisenmarktinterventionen, Krugman-Modell, rationale Erwartungen, empirische Überprüfung, Glaubwürdigkeit, Geldmenge, Wechselkurs, Zinsdifferenz, Bandgrenzen, Stabilitätspolitik
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Wechselkurszielzonenmodell?
Es ist ein System, das feste und flexible Wechselkurse kombiniert, indem es Schwankungsmargen (Bandbreiten) festlegt, innerhalb derer der Kurs variieren darf.
Wie funktioniert das Krugman-Modell (1991)?
Krugman zeigt auf, dass allein die Erwartung von Interventionen an den Bandgrenzen den Wechselkurs stabilisiert (der sogenannte "Honeymoon-Effekt").
Was ist der Unterschied zu Devisenmarktinterventionen?
Zielzonen erfordern oft präventive Interventionen, bevor ein Grenzwert überschritten wird, während normale Interventionen oft erst bei Abweichungen einsetzen.
Welche Rolle spielte das EWS für diese Modelle?
Das Europäische Währungssystem (EWS) diente als praktisches Beispiel, um die Theorie der Zielzonen und deren Glaubwürdigkeit empirisch zu überprüfen.
Warum wurde Krugmans Modell in der Literatur kritisiert?
Empirische Daten zeigten oft keine S-Kurve, und die Annahme vollkommener Glaubwürdigkeit der Bandgrenzen erwies sich in der Realität als oft nicht haltbar.
- Citar trabajo
- Florian Schoetzke (Autor), 2001, Wechselkurszielzonenmodell und Erfahrungen aus dem EWS, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9586