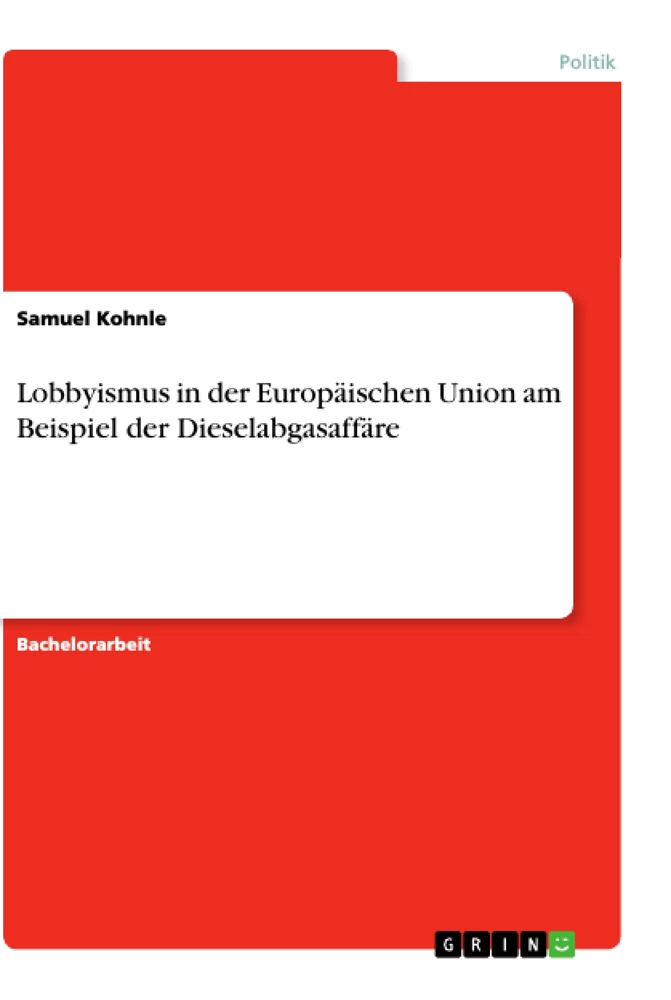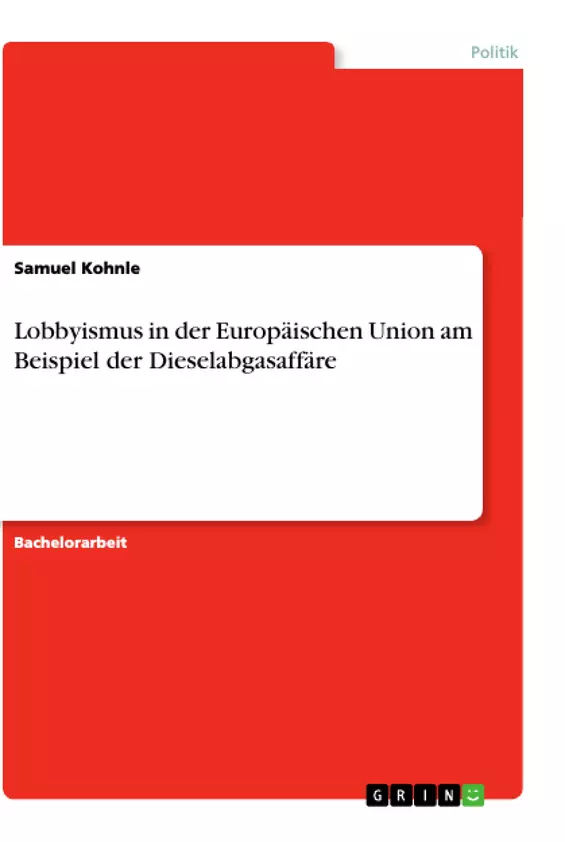In der Bachelorabschlussarbeit soll das Phänomen der Interessenvertretung auf Ebene der Europäischen Union einer intensiven Untersuchung unterzogen werden. Dabei eröffnet sich ein breites Spektrum möglicher Untersuchungsgegenstände, welches durch die Fokussierung auf die Dieselabgasaffäre im deutsch-europäischen Kontext limitiert werden soll.
Im Vorfeld der Untersuchung wird eine Annäherung an das Phänomen der Interessenvertretung erfolgen. Dazu zählt einerseits die theoretische Erschließung der beiden zentralen Paradigmen der Interessenvertretungstheorie, genauer gesagt Korporatismus und Pluralismus. Zudem wird das Phänomen der Interessenvertretung allgemein in Bezug auf Entstehung, Entwicklung und Abgrenzung zu Lobbyismus genauer behandelt. Die theoretischen Vorarbeiten abschließend werden in idealtypischer Konstruktion mithilfe des Politikzyklusmodells die Einflussmöglichkeiten im politischen Entscheidungsfindungsprozess dargelegt. Hierbei soll außerdem auf die drei zentralen Organe der EU, die Europäische Kommission, der Europäischer Rat und das Europäische Parlament eingegangen werden. Damit wird die bereits oben erwähnte zentrale Forschungsfrage um weitere Forschungsfragen ergänzt: Was ist Interessenvertretung im Allgemeinen und wie funktioniert Interessenvertretung auf europäischer Ebene?
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Teil 1: Theoretische Annäherungen an das Thema der Interessenvertretung.
- Thema und Fragestellung
- Relevanz
- Lobbyismus/Interessenvertretung – Definition, Abgrenzung und Forschungsstand
- Historischer Abriss
- Definition und Abgrenzung
- Akteure
- Adressaten
- Funktionen und Anforderungen
- Gegenwärtiger Forschungsstand
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Politikwissenschaftliche Einordnung von Interessenvertretung
- Pluralismus
- Korporatismus
- Die Europäische Union zwischen Pluralismus und Korporatismus?
- Der Policy-Zyklus
- Der akteurszentrierte Institutionalismus
- Netzwerkanalyse
- Das methodische Vorgehen
- Einzelfallstudie
- Dokumentenanalyse
- Institutionelle Rahmenbedingungen und Institutionen der EU
- Der Rat der Europäischen Union
- Die Europäische Kommission
- Das Europäische Parlament
- Das Komitologieverfahren
- Teil 2: Analyse der Dieselabgasaffäre und der RDE-Gesetzgebung
- EU-Abgasnorm
- Erste Phase: Die Asymmetrie strengerer Grenzwerte und schlechterer Luftqualität
- Abriss der ersten Phase der Dieselabgasaffäre
- Lobbyinduzierte Entwicklungen der ersten Phase
- Beurteilung lobbyinduzierter Entwicklungen der Agenda-Setting und Policy-Formation-Phase aus demokratietheoretischer Perspektive
- Agenda-Setting
- Policy Formation
- Demokratietheoretische Einordnung
- Zweite Phase: Bekanntwerden der Manipulation in der Öffentlichkeit und die RDE-Gesetzgebung
- Abriss der zweiten Phase der Dieselabgasaffäre
- Lobbyinduzierte Entwicklungen der zweiten Phase
- Beurteilung lobbyinduzierter Entwicklungen der Policy-Formation-Phase aus demokratietheoretischer Perspektive
- Policy Formation
- Demokratietheoretische Einordnung
- Konklusion
- Die Rolle von Lobbyismus in der EU-Gesetzgebung
- Die Bedeutung von Interessenvertretung im Kontext der Dieselabgasaffäre
- Die Auswirkungen von Lobbyismus auf die demokratische Legitimation der EU
- Die Analyse von Agenda-Setting und Policy-Formation-Prozessen
- Die Einordnung der Dieselabgasaffäre aus demokratietheoretischer Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Interessenvertretung im Kontext der Europäischen Union, wobei die Dieselabgasaffäre als exemplarisches Fallbeispiel dient. Ziel ist es, den Einfluss von Lobbyismus auf den Gesetzgebungsprozess der EU im Bereich der Umwelt- und Verkehrspolitik zu untersuchen und die Auswirkungen auf die demokratische Legitimation der Europäischen Union zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen der Interessenvertretung. Es werden verschiedene Definitionen und Abgrenzungen des Begriffs „Lobbyismus“ vorgestellt, die relevanten Akteure und Adressaten analysiert sowie die Funktionen und Anforderungen an eine effiziente Interessenvertretung dargestellt. Darüber hinaus werden verschiedene theoretische Ansätze zur Analyse von Interessenvertretung beleuchtet, darunter der Pluralismus, der Korporatismus und der akteurszentrierte Institutionalismus. Der Fokus liegt auf der Einordnung der Europäischen Union in diesen Kontext und der Darstellung des Policy-Zyklus als analytisches Modell. Schließlich wird das methodische Vorgehen der Arbeit erläutert, welches auf einer Einzelfallstudie mit Fokus auf die Dieselabgasaffäre basiert.
Der zweite Teil der Arbeit analysiert die Dieselabgasaffäre in zwei Phasen: die Phase der Agenda-Setting und Policy-Formation sowie die Phase des Bekanntwerdens der Manipulation in der Öffentlichkeit und der daraus resultierenden RDE-Gesetzgebung. Die Arbeit untersucht dabei den Einfluss von Lobbyismus auf die Entwicklung der EU-Abgasnorm, die Asymmetrie zwischen strengeren Grenzwerten und schlechterer Luftqualität sowie die Auswirkungen auf die demokratische Legitimation der Europäischen Union. Die Analyse stützt sich auf eine umfassende Dokumentenanalyse und bezieht sich auf relevante wissenschaftliche Literatur.
Schlüsselwörter
Interessenvertretung, Lobbyismus, EU-Gesetzgebung, Dieselabgasaffäre, RDE-Gesetzgebung, Umweltpolitik, Verkehrspolitik, Agenda-Setting, Policy-Formation, Pluralismus, Korporatismus, akteurszentrierter Institutionalismus, Policy-Zyklus, Demokratie, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Lobbyismus die Dieselabgasaffäre in der EU?
Die Arbeit untersucht, wie Interessenvertreter auf die Festlegung von Grenzwerten und die RDE-Gesetzgebung (Real Driving Emissions) eingewirkt haben.
Was ist der Unterschied zwischen Korporatismus und Pluralismus?
Dies sind zwei Paradigmen der Interessenvertretung: Pluralismus setzt auf freien Wettbewerb der Interessen, Korporatismus auf die Einbindung fester Verbände in staatliche Entscheidungen.
Was ist das "Politikzyklusmodell"?
Ein Modell, das den politischen Prozess in Phasen wie Agenda-Setting, Policy-Formation und Implementierung unterteilt, um Einflussmöglichkeiten zu analysieren.
Welche EU-Organe sind Hauptadressaten für Lobbyisten?
Die Europäische Kommission, der Europäische Rat und das Europäische Parlament sind die zentralen Zielpunkte für Interessenvertretung.
Gefährdet Lobbyismus die demokratische Legitimation der EU?
Die Arbeit analysiert diese Frage aus demokratietheoretischer Perspektive, insbesondere im Hinblick auf asymmetrische Einflussmöglichkeiten der Industrie.
- Quote paper
- Samuel Kohnle (Author), 2020, Lobbyismus in der Europäischen Union am Beispiel der Dieselabgasaffäre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958877