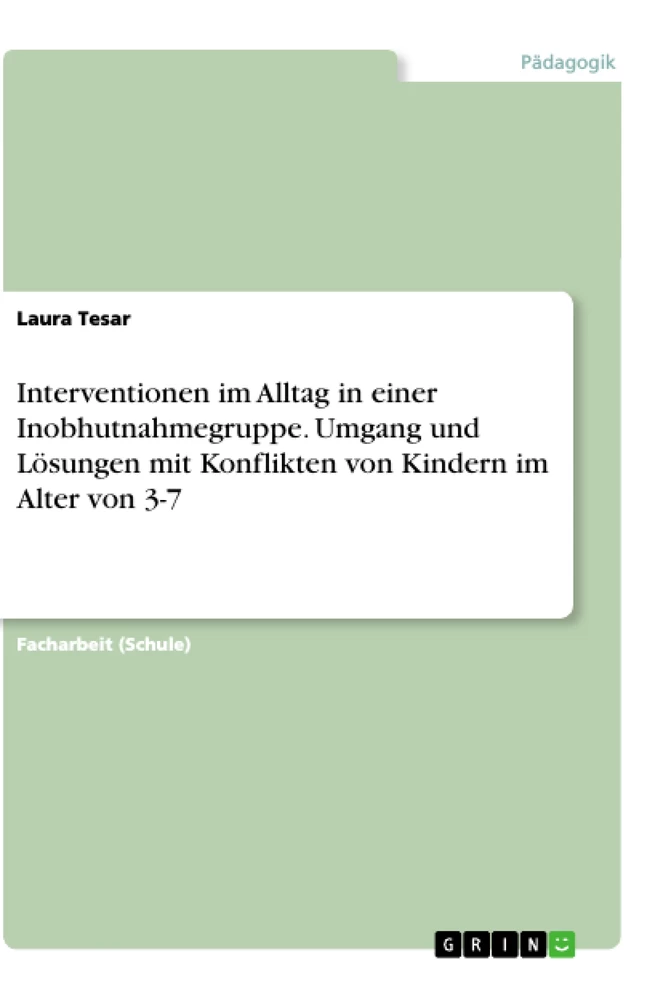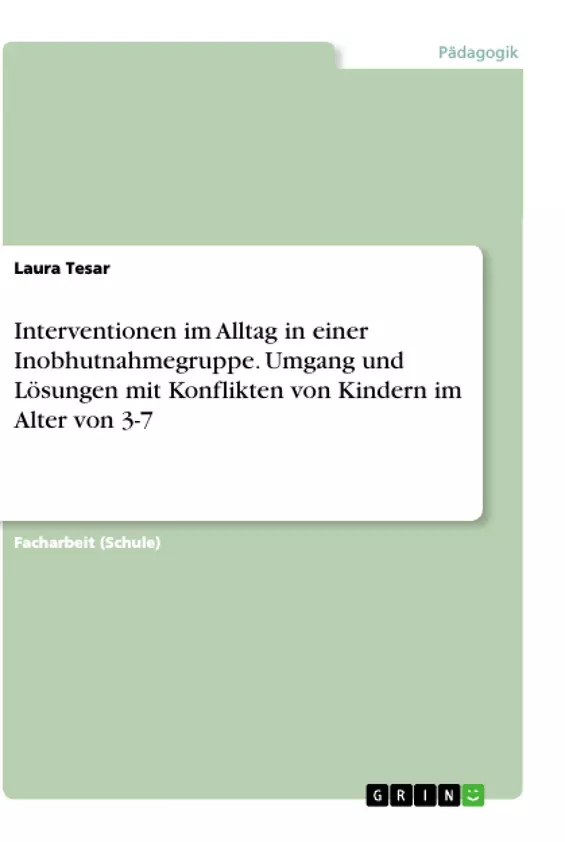Das Ziel der Arbeit ist es zu zeigen, wie Intervention in einer Inobhutnahmegruppe von 3-7-jährigen bei Konflikten gelingen kann und wie Lösungen aussehen können. Konflikte gibt es in jedem Lebensbereich und in jeder Altersgruppe. Auch in der Inobhutnahme treten täglich Konflikte zwischen den Kindern auf. Die Kinder befinden sich in einer aktuellen Lebenskrise, da sie aus ihrem gewohnten Umfeld und ihren Familien genommen wurden. Die Gründe für die Inobhutnahme sind meist ganz unterschiedlich, somit bringt jedes Kind eine andere Vorgeschichte mit sich.
Durch die teilweise traumatischen Erfahrungen die die Kinder bereits machen mussten, weisen sie unter anderem Entwicklungsverzögerungen, mangelnde soziale- und emotionale Kompetenzen und erhöhtes Aggressionspotential auf. Zu dem besteht eine Unzufriedenheit im Kind, da es nicht mehr bei seinen Bezugspersonen, meist den Eltern, wohnen kann. Die bestehende Trauer wandelt sich dann oft in Wut und Aggression um, woraus dann Konflikte entstehen. Die Konflikte werden von den Kindern sowohl verbal als auch körperlich ausgetragen. Sie gehören zum Alltag der Kinder, während sich in Regeleinrichtungen nur selten Konflikte in diesem Ausmaß beobachten lassen. Den Kindern fällt es meist schwer sich Hilfe bei einem Pädagogen zu holen bevor der Konflikt eskaliert.
Sie verbinden einen Konflikt meist mit etwas negativem und werden als schmerzhaftes und unangenehmes Erlebnis wahrgenommen. Oftmals bauen die Kinder ihre Wut und Frustration über die aktuelle Situation mit einem körperlichen Konflikt gegen ein anderes Kind oder einen Pädagogen ab. Dies verhilft den Kindern allerdings nicht zu einer Besserung ihres persönlichen Empfindens, sondern es entstehen weitere negative Gefühle und Erfahrungen.
Das Ziel dabei ist es, den Kindern zu zeigen, dass Konflikte auch ohne körperliche Auseinandersetzungen ausgetragen werden können und sie eine Chance für Änderungen sind. Die Kinder sollen erkennen, dass es in Ordnung ist wütend zu sein, es aber andere Möglichkeiten als eine Auseinandersetzung gibt um seinen Ärger Luft zu machen. Des Weiteren werden den Kindern Bewältigungsstrategien aufgezeigt um mit ihrer Wut und Aggression umzugehen und diese nicht durch Konflikte miteinander abzubauen.
Inhaltsverzeichnis
- Definition Konflikt
- Definition Aggression
- Ursachen von Konflikten
- Missverständnisse in der Kommunikation
- Zusammensetzung der Gruppe
- Nachahmung erlernter Verhaltensweisen
- Auswirkungen von Konflikten
- Positive Auswirkungen auf die Kinder
- Negative Auswirkungen auf die Kinder
- Oppositionell- aggressive Kinder
- Vorbeugen von Konflikten aufgrund neugewonnener Kompetenzen
- Emotionale Kompetenz und Empathie
- Emotionale Kompetenz und Verhaltensauffälligkeiten
- Zielgruppe
- Ziele für einzelne Kinder
- Heilpädagogischer Umgang mit Gewalt und Konflikten im Clemens-Maria-Kinderheim
- Pädagogisches Verhalten in Konfliktsituationen
- Bereits durchgeführte Methoden und Angebote im Umgang mit Konflikten
- Liedeinführung „Das Lied von den Gefühlen“
- Die „Autorunde“
- Die „Wutampel“
- Methoden in der Gesprächsführung durch ein gezieltes Beispiel
- Reflexion und Evaluation
- Reflexion der Situation und Evaluation der Ziele
- Weitere geplante Methoden der Konfliktbewältigung
- Schnur- Spiel
- Schimpfen erlaubt
- Der Wutball
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Dokument analysiert die Ursachen und Auswirkungen von Konflikten im Kontext eines Kinderheims. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Strategien zur Vorbeugung und Bewältigung von Konflikten, die durch die spezifischen Bedürfnisse der Kinder im Kinderheim entstehen.
- Definition und Abgrenzung von Konflikten und Aggression
- Analyse der Ursachen von Konflikten in der Zielgruppe
- Entwicklung von pädagogischen Konzepten zur Konfliktbewältigung
- Vorstellung und Evaluation praktischer Methoden im Umgang mit Konflikten
- Zielsetzung und Reflexion der erarbeiteten Methoden und Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die besondere Situation der Kinder im Kinderheim und die Entstehung von Konflikten in dieser Umgebung. Anschließend werden die Begriffe „Konflikt“ und „Aggression“ definiert und die Ursachen von Konflikten näher betrachtet. Dabei werden Kommunikationsprobleme, die Zusammensetzung der Gruppe und die Nachahmung erlernter Verhaltensweisen als wichtige Faktoren analysiert.
Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit den positiven und negativen Auswirkungen von Konflikten auf Kinder, wobei die Besonderheiten von oppositionell-aggressiven Kindern hervorgehoben werden. In Kapitel 6 werden Möglichkeiten zur Vorbeugung von Konflikten durch die Förderung emotionaler Kompetenz und Empathie sowie die Vermeidung von Verhaltensauffälligkeiten beleuchtet.
Kapitel 7 und 8 beschreiben die Zielgruppe des Projekts und die individuellen Ziele, die mit den Maßnahmen erreicht werden sollen. Die Kapitel 9 und 10 fokussieren auf den heilpädagogischen Umgang mit Gewalt und Konflikten im Clemens-Maria-Kinderheim und stellen bereits durchgeführte Methoden wie „Das Lied von den Gefühlen“, die „Autorunde“ und die „Wutampel“ vor. Die Kapitel 11 und 12 schließlich reflektieren die durchgeführten Maßnahmen und stellen weitere geplante Methoden zur Konfliktbewältigung vor.
Schlüsselwörter
Konflikte, Aggression, Kinderheim, emotionale Kompetenz, Empathie, Verhaltensauffälligkeiten, Pädagogik, Konfliktbewältigung, Interventionen, Methoden, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Warum kommt es in Inobhutnahmegruppen häufig zu Konflikten?
Die Kinder befinden sich in einer Lebenskrise, haben oft traumatische Erfahrungen hinter sich und leiden unter der Trennung von ihren Bezugspersonen, was sich in Wut und Aggression äußert.
Welche pädagogischen Ziele werden bei der Konfliktbewältigung verfolgt?
Ziel ist es, den Kindern gewaltfreie Bewältigungsstrategien aufzuzeigen, ihre emotionale Kompetenz zu fördern und ihnen zu vermitteln, dass Konflikte Chancen für Veränderungen sind.
Was ist die „Wutampel“?
Die Wutampel ist eine visuelle Methode, die Kindern hilft, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu steuern, bevor ein Konflikt eskaliert.
Welche Rolle spielt Empathie bei der Vorbeugung von Konflikten?
Durch die Förderung von Empathie lernen Kinder, die Gefühle anderer zu verstehen, was die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen und körperlichen Auseinandersetzungen verringert.
Was versteht man unter heilpädagogischem Umgang mit Gewalt?
Es beschreibt ein gezieltes pädagogisches Verhalten in Krisensituationen, das auf Deeskalation, Reflexion und dem Erlernen neuer Verhaltensmuster basiert.
Welche neuen Methoden zur Konfliktbewältigung werden geplant?
Dazu gehören das „Schnur-Spiel“, das gezielte Zulassen von Schimpfen in geschütztem Rahmen und der Einsatz eines „Wutballs“ zum Stressabbau.
- Arbeit zitieren
- Laura Tesar (Autor:in), 2017, Interventionen im Alltag in einer Inobhutnahmegruppe. Umgang und Lösungen mit Konflikten von Kindern im Alter von 3-7, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958992