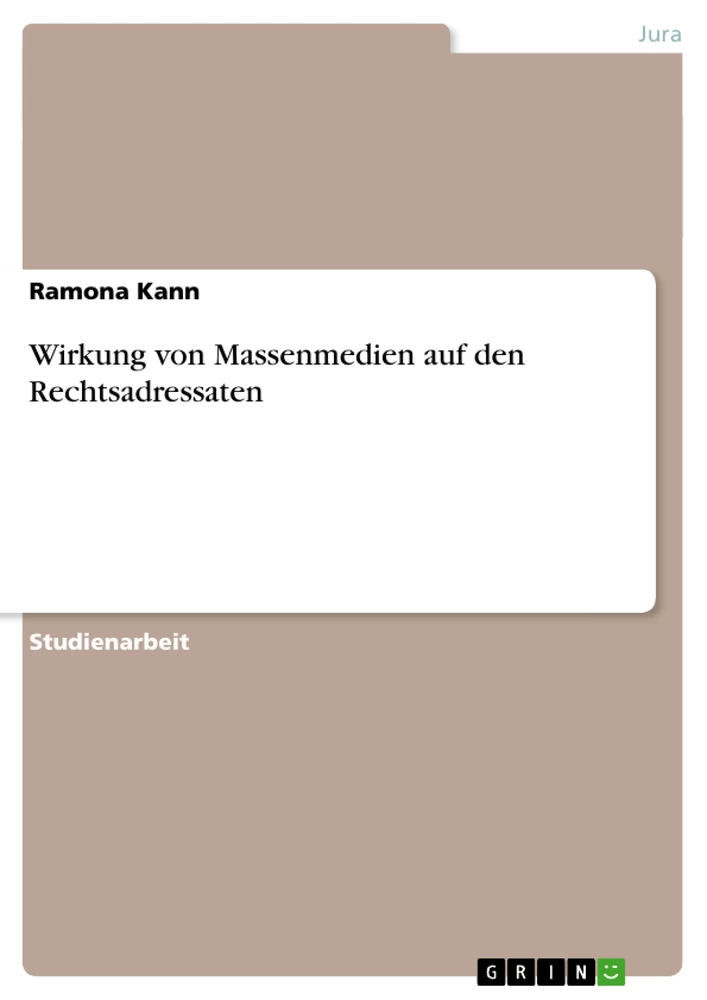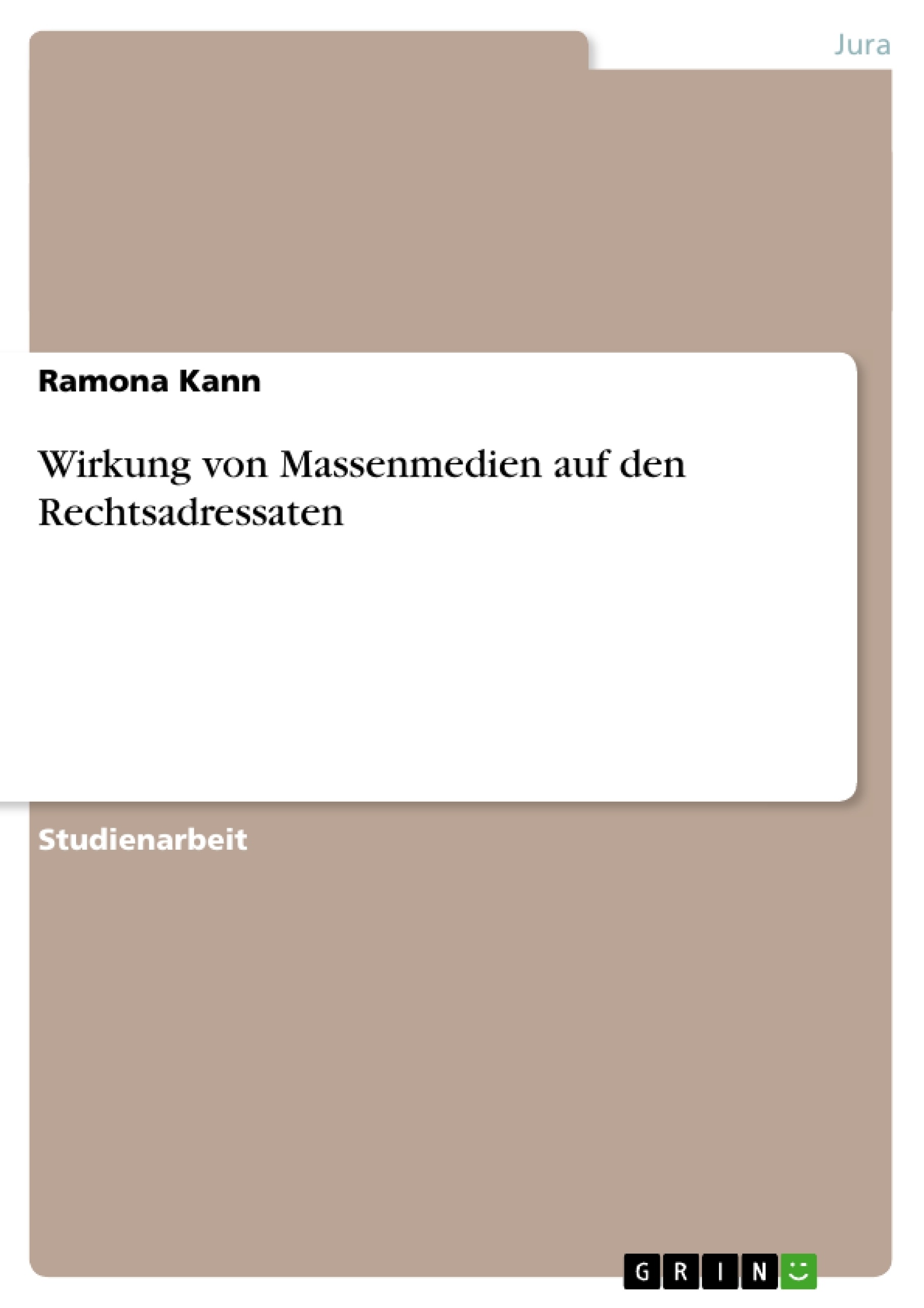Inhaltsverzeichnis
1. Wirkung von Massenmedien auf Rechtsadressaten
2. Grundlagen der Medienwirkungsforschung
3. Gewaltdarstellung in den Medien
3.1 Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
3.2 Auswirkungen auf Erwachsene
3.3 Abgrenzung: reale / fiktive Gewalt
3.4 Abstumpfung des Rechtsbewußtseins durch Mediengewalt?
4. Information durch Medien
4.1 Information - Erschaffung eines Weltbildes?
4.2 Das Bild des Rechts in den Medien
4.3 Wachstum des Rechtsbewußtseins durch Medieninformation?
5. Medien formen Recht - Recht formt Medien
5.1 Das Zensurproblem - Pressefreiheit kontra Menschenwürde
5.2 Recht vor dem Auge der Öffentlichkeit
6. Medien in der Zukunft - Internet und Co.
7. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
WIRKUNG VON MASSENMEDIEN AUF RECHTSADRESSATEN
1. Problemstellung
Massenmedien werden in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger, immer zahlreicher und nehmen so auch Einfluß auf uns. Dies geschieht in vielen Bereichen der Gesellschaft und des täglichen Lebens. Im Folgenden soll nun die Wirkung der Massenmedien auf den Menschen als Rechtsadressaten herausgestellt werden. Wie sehr beeinflussen Medien unser Rechtsverständnis tatsächlich? Wie stark kann ethisches Verhalten medienverursacht sein? Diesen und ähnlichen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden.
2. Grundlagen der Medienwirkungsforschung
Schon zu Beginn unseres Jahrhunderts, also mit der Einführung des Rundfunks, begannen Wissenschaftler, sich mit der Massenkommunikation zu befassen. Daß Massenmedien generell auf uns wirken, mag niemand bestreiten. Doch bei dem Versuch, Art und Ausmaß dieser Wirkung zu erforschen, stößt die Wissenschaft noch heute oft an ihre Grenzen. Faßt man den Wirkungsbegriff eng, beinhaltet er den Wechsel im Verhalten und Erleben nach Kontakt mit dem entsprechenden Medium, welcher zu Auswirkungen führt, die sich im Verhalten, im Wissen, bei Meinungen, im emotionalen, im tiefenpsychologischen sowie in weiteren Bereichen bemerkbar machen können. Die Abgrenzung fällt hier oft schwer, da Veränderungen in einem Bereich häufig Wirkungen auf die anderen Bereiche mit sich ziehen. Immer hat man jedoch ein einflußnehmendes Medium als Kommunikator (Stimulum), das beim Rezipienten eine Reaktion - aktiver oder passiver Art - hervorruft. Unter diesem Gesichtspunkt scheint es irritierend, daß im Zusammenhang mit Massenmedien so häufig von „Massen kommunikation “ geredet wird. Massenkommunikation scheint nämlich auf den ersten Blick einseitig, weil keine direkte und gegenseitige Beeinflussung von Kommunikator und Rezipient stattfindet. Die von amerikanischen Kommunikationsforschern entwickelte Theorie des „Two-Step-Flow of Communications“ besagt jedoch, daß nur ein kleiner Teil der Bevölkerung die Information von den Massenmedien direkt abnimmt und diese dann in seinem sozialen Umfeld in Umlauf bringt. Dieser zweistufige Prozeß vereint Kommunikation mit der Massenkommunikation. Abgesehen davon müssen auch die Medien wiederum auf Bedürfnisse und Geschehnisse in der Gesellschaft reagieren, z.B. können sie auf Aktionen politischer Gruppierungen oder Einzelpersonen mit Sanktionen reagieren. So ist bei näherer Betrachtung die Bezeichnung „Massen kommunikation “ durchaus berechtigt.
Lange nahm man an, daß Medien das Verhalten unmittelbar beeinflussen. Ihnen wurde vorgeworfen, zu Vermassung, Verdummung und dem Verlust von Individualität in der Gesellschaft zu führen, da die Inhalte undifferenziert und direkt auf die Massen wirkten. Dem ist jedoch entgegenzusetzen, daß vielen die Möglichkeit zur Entwicklung von Individualität und Vielfalt durch die Informationen und Inhalte der Medien, die ihnen bisher nicht zugänglich waren, erst ermöglicht wird. Die Chancengleichheit wird dadurch erhöht. Tatsächlich haben sich durch die Informationsvielfalt der letzten Jahrzehnte die Bildungschancen und Gelegenheiten zu interkulturellem Kontakt erheblich verbessert. Aber auch als „escape“, Entspannung vom Alltag, Unterhaltung, Mittel zur Kontrolle der Umwelt und zur persönlichen Identitätsfindung werden Medien in Gebrach genommen. So wird individuell nach vielen Kriterien selektiert. Es bleibt die Frage, wie sehr sich ein solch hoher Medienkonsum auswirkt. Die mit den Medien oftmals in Verbindung gebrachten Veränderungen einer Verstumpfung und Vereinheitlichung sowie der Entstehung von Vorurteilen führen leicht zu der These, daß all dies medienverursacht sei. Bei näherer Betrachtung stellt man jedoch fest, daß die Medien nicht die Ursache dieser ohnehin vorhandenen Merkmale sind, sondern diese lediglich verstärken und aufgreifen können. Wie der einzelne auf die Medien reagiert, ist in hohem Maße abhängig von seiner individuellen Persönlichkeitsstruktur, die ihn zu entsprechender Selektion und gegebenenfalls auch Reaktion veranlaßt. Die Leistung der Massenkommunikation liegt somit in erster Linie darin, Informationen zu vermitteln und dabei die Neugier nach weiteren Informationen zu wecken. So werden überhaupt erst Voraussetzungen geschaffen, sich Einstellungen und Meinungen zu bestimmten Themen der Öffentlichkeit bilden zu können. Der Rezipient gewinnt zwar auf diese Weise eine gewisse Vorstellung von der Realität, doch Einstellungen und Meinungen selbst bildet er erst innerhalb der Auseinandersetzung mit den vorgegebenen Themen, er bekommt sie nicht durch die Medien direkt vermittelt. Diese geben mithin vor, worüber man nachzudenken und zu kommunizieren hat, welche Themen in der Öffentlichkeit relevant sind; sie schreiben jedoch nicht unmittelbar vor, was man zu denken hat. Dieses Prinzip wird „Agenda-Setting“ genannt. Das „Agenda-Setting“ verdeutlicht, wie sehr in der Vergangenheit die Wirkungen der Medien überschätzt wurden. Doch auch zu unterschätzen sind sie nicht, denn immerhin kommt es bei den im Diskurs stehenden Themen schnell zu einem öffentlichen Meinungsklima, dem sich der einzelne nur schwer entziehen kann. Damit bleibt es immerhin bei einer mittelbaren Beeinflussung von Einstellungen durch die Massenmedien. Wie dies gerade im Rechtsbereich aussieht, soll nun untersucht werden.
3. Gewaltdarstellung in den Medien
Krimis, Actionthriller, Prügelszenen sind an der Tagesordnung in Kino und TV. Stars Wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone verdanken ihre Popularität ebenfalls Gewaltfilmen. In den Nachrichten Berichte von Kriegen und Verbrechen - gleichzeitig häufen sich Gewalttaten und Terroranschläge. Gewalt im Alltag durch Gewalt in den Medien? Hierüber gibt es verschiedene, sich teilweise widersprechende Theorien, die bisher nicht zufriedenstellend verifiziert werden konnten. Somit wird Bildschirmgewalt entweder als gefährlich, harmlos oder sogar positiv eingestuft.
3.1 Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
Am labilsten und so auch am empfänglichsten für Gewaltszenen auf dem Bildschirm scheinen Kinder und Jugendliche. Bereits in den siebziger Jahren verbrachte der über vierzehnjährige Rundfunkteilnehmer fast zwei Stunden pro Tag vor der Mattscheibe, am Wochenende waren es fast 3-4 Stunden. Heutzutage hat das Angebot durch die privaten Rundfunksender und Video drastisch zugenommen, und man muß davon ausgehen, daß sich der Fernsehkonsum der Bevölkerung erhöht hat. Die Programmzuschauer werden außerdem immer jünger. Durch die Fülle von Krimis, Western, Actionfilmen und auch gewaltgeladenen Zeichentricks muß bei jungen Zuschauern der Eindruck entstehen, man könne Probleme und Konflikte nur mit Gewalt lösen. Besonders häufig sehen Kinder im sogenannten Vorabendprogramm fern, einer Zeit, die nicht unbedingt für Kinder konzipiert ist. Aber auch die Kindersendezeiten auf den Privaten sind oft angefüllt mit aktionsgeladenen Gewaltszenen. Der kleine Junge, der sich im Wartezimmer mit einer Holzeisenbahn und einem schwarzen Spielzeugauto wilde Verfolgungsjagden liefert und dabei erzählt, wie toll „Michael“ ist, daß „Michael“ ein sprechendes Auto hat und daß auch die „Power Rangers“ ganz toll sind, macht schon ein wenig nachdenklich. Genau wie ein anderer Junge, der - obwohl antiautoritär erzogen - mit Vorliebe seine kleine Schwester schlägt. Diverse Untersuchungen ergaben, daß die Zunahme des Medienkonsums und die Zunahme von Gewalt auf dem Bildschirm verbunden ist mit einem gleichzeitigen Anstieg der Jugendkriminalität. Bei Kindern, die einer künstlich vermehrten Mediengewalt ausgesetzt waren, stellte man später eine erhöhte Aggressionsquote fest. Das würde auch die sogenannte Stimulationstheorie bestätigen, nach welcher besonders Kinder und Jugendliche durch Gewaltfernsehen aggressiv aufgeladen werden, und das Gesehene später imitieren. Trotzdem hatte man immer wieder Probleme die Medienwirkungen zu untersuchen, ohne dabei äußere Faktoren außer acht zu lassen. Dies gelang jedoch in einer Studie des Zentrums für Massenkommunikationsforschung, in welcher das Medienverhalten von einhundert aggressiven und nicht aggressiven Jungen zwischen zwölf und fünfzehn Jahren in Slums des nordöstlichen Englands untersucht wurde. Man entwarf eine Methode, die alle nur möglichen Einflüsse und Lebensumstände der Jugendlichen mitberücksichtigte. Das Ergebnis dieser Untersuchung ergab, daß sowohl Aggression als auch Nichtaggression als Anpassung an die Umgebung der Jungen zu sehen war. Interessanterweise gab es zwischen den aggressiven und den nicht-aggressiven Jugendlichen keine Unterschiede hinsichtlich ihrer Zuwendung zu Gewalt darstellenden Medieninhalten. In einer anderen Untersuchung zwischen jugendlichen Straftätern und etwa der gleichen Anzahl Nichtdelinquenten ergab sich ein ähnliches Bild: die Jugendlichen unterschieden sich zwar darin, wie sie das Fernsehprogramm aufnahmen und verarbeiteten, nicht aber so sehr in ihrer Konsummenge oder Programmwahl. Es fällt auf, daß viele der straffällig gewordenen Jugendlichen aus sozial zerrütteten Arbeiterfamilien kamen, somit vor einem von Deprivation und Entwurzelung geprägten Hintergrund aufwuchsen. Ein intaktes Familienleben schützt Kinder weitgehend gegen Gefahren durch Gewalt in den Medien. Probleme ergeben sich jedoch für diejenigen, welche ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst, zu ihren Spielgefährten und ihren Eltern haben.Das Fernsehen stellt für Kinder eine Autorität dar. Je alltäglicher und vertrauter ihnen die Umgebung oder das Milieu der dargestellten Handlung ist, um so leichter übernehmen sie, was sie sehen, werden zu Nachahmern. Sie sind aber auch um so beunruhigter, je mehr sie sich mit dem Gesehenen auf Grund seiner Vertrautheit identifizieren können. Insgesamt wird deutlich, daß das Medienverhalten im Kontext zu seiner Umwelt gesehen werden muß, damit es einen Sinn ergibt. Die Medien sind nicht allein für das Verhalten verantwortlich, können dieses aber je nach den äußeren Gegebenheiten stark beeinflussen. Die jungen Menschen suchen Abwechslung, wollen sich anpassen, mit dem Leben klarkommen. All dies kann zu kriminellen Handlungen oder auch einem Leben innerhalb der Phantasiewelt des Fernsehens führen. Eine wichtige Unterstützung, damit das nicht geschieht können Eltern und Freunde bieten. Kinder sollten lernen, wie sie mit dem Gesehenen umzugehen haben, wie sie das Fernsehen zum Lernen nutzen können. Hilfestellung leisten ihnen die Eltern, wenn sie die Kinder nicht allein Fernsehen lassen und ihnen als Ratgeber zur Seite stehen. Findet diese Tatsache mehr Beachtung, kann auch die Gewalt in den Medien Kinder und Jugendliche nicht mehr in dem Maße beeinflussen, wie es unter bestimmten Bedingungen immer noch geschieht.
3.2 Auswirkungen auf Erwachsene
Auch von Erwachsenen werden die Massenmedien vielfach genutzt. Fraglich ist, wie folgenschwer Gewalt auf dem Bildschirm hier ist. Nach der Katharsis- theorie erfüllt das Fernsehen in Bezug auf aggressives Verhalten der Rezipienten eine Ventilfunktion. Dadurch können eigene Aggressionen abgebaut werden, indem eine Identifikation mit der dargestellten Brutalität stattfindet, die auf eigene aggressive Handlungen verzichten läßt. Nach der Habitualisierungs- theorie gewöhnt sich der Fernsehzuschauer an Gewaltakte auf dem Bildschirm. Durch diese ständige Wiederholung wird die Reaktionsintensität reduziert, was ebenfalls zu einer Verminderung eigener Aggressionsakte führt. Eine gegensätzliche Erklärung hierzu vertritt die Inhibitionstheorie: nach ihr werden durch Mediengewalt Hemmungen, sogenannte Aggressionsängste verstärkt. Diese These führt jedoch ebenfalls zu einem Ausbleiben realer Aggressionen. Die genannten Theorien gleichen sich somit trotz unterschiedlicher Argumentation in ihrem Ergebnis. Dem entgegen steht die bereits erwähnte Stimulationstheorie, nach welcher die Medien die Gewaltbereitschaft verstärken und es hinterher zu imitierten Aggressionshandlungen kommen kann, die sich eingeprägt haben und nun jederzeit abrufbar sind. Jenes gilt aber bei Erwachsenen nicht in gleichem Maße wie bei Kindern und Jugendlichen. So kann es sein, daß dieselbe Gewaltszene für den einen Fernsehzuschauer ein Ventil bedeutet, an einem anderen wirkungslos vorüberzieht, weil er bereits derart abgestumpft ist, ein dritter aggressives Verhalten lernt und vierter dieses auch noch in die Tat umsetzt. Auch bei Erwachsenen müssen daher die Persönlichkeitsstruktur und das soziale Umfeld berücksichtigt werden. Dies gelingt jedoch in Laborexperimenten kaum. Ebensowenig läßt sich aus ihnen auf eine Langzeitwirkung schließen. Aber auch wenn eine Nachahmungsgefahr besteht, ist diese doch das geringere Problem. Eine andere Gefahr besteht darin, daß die Mediengewalt auch die Einstellungen über Normalität prägt und für die Entstehung von Vorurteilen sorgt: der Täter und die Tat sind immer begleitet von typischen Klischees, Handlungen spielen im Drogengewerbe oder im Rotlichtmilieu, der Täter ist männlich und oft ein Ausländer. Diese Festlegung auf äußere Attribute führt mehr und mehr zu eine Verzerrung der Realität. Durch das Abtöten der Sensibilität werden Standards und Werte vermindert, was zu einer Legitimierung des von der Norm abweichenden Verhaltens führt. Die Bereitschaft Unrecht und Gewalt zu akzeptieren steigt proportional und kann in bestimmten Fällen ebenfalls in abweichendem Verhalten enden. Dennoch hat jene Kriminalität einen höheren Stellenwert, welche seitens der Massenmedien das Bild „ des Kriminellen“ prägt. Kriminalitätsberichterstattung und Gewalt in den Medien ist daher weniger wegen ihrer Wirkung auf potentielle Straftäter gefährlich, sondern primär wegen ihrer Wirkung auf den sogenannten Normalbürger. Bei jenem ist die Gefahr, daß er selbst kriminell wird, gering, doch muß man befürchten, daß er andere zu Kriminellen macht: vorschnell und ohne Nachzudenken übernimmt er das ihm gelieferte Bild in einer Welt, in der er scheinbar niemandem mehr trauen kann. Damit gelangt man auch hier zu keinem einheitlichen Ergebnis, weil jeder die Medieninhalte individuell aufnimmt und verarbeitet. Doch man darf nicht leugnen, daß die Tendenz zu einer gewaltbereiteren Gesellschaft und einer Gesellschaft, in der Gewalt als Normalität empfunden wird, gegeben ist.
3.3 Abgrenzung: reale / fiktive Gewalt
Im Mittelpunkt der Forschung steht bei der Gewaltfrage in der Regel die fiktive Gewalt aus Fernsehspielen und Krimis. Reale Gewaltszenen, wie sie tagtäglich auf dem Bildschirm in Form von Nachrichten und Dokumentationen erscheinen, werden hierbei vernachlässigt. Gerade die reale Gewalt ist es aber, die zumindest auf Erwachsene in starkem Maße wirkt. Und die gerade deshalb besonders stark wirkt, weil man sie nicht irgendwelchen Phantasien von Drehbuchautoren und Regisseuren unterschiebt, sondern weil sie uns Realität weismachen will. Nur wenig Untersuchen trennen zwischen realer und fiktiver Gewalt, daher ist völlig ungeklärt, ob nicht gerade die sich real zeigende Gewalt eine wichtige Sozialisationsfunktion erfüllt. Berichte über Krieg, Unfälle, Verbrechen und Attentate schrecken die Bevölkerung auf und vermitteln Angstgefühle. Bei der fiktiven Gewalt ist dies weniger der Fall, weil man sich dort der Fiktion bewußt ist. Um so eher nimmt man andere Berichte für wahr. Gerade heutzutage häufen sich Horrormeldungen, Geschichten, denen sonst kaum jemand Beachtung schenken würde, werden von unseriösen Fernsehmagazinen und Zeitschriften kunstvoll aufbereitet - und dem gutgläubigen Zuschauer als Realität verkauft. Gerade in den letzten Monaten wurden Skandale solcher Art bekannt, und es ist längst kein Geheimnis mehr, mit welchen „Tricks“ die Sensationspresse heute arbeitet. Darin besteht die eigentliche Gefahr: Realität und Fiktion werden mehr und mehr vermischt, so daß der Zuschauer den Überblick verliert. Die Presse stellt eine Autorität dar, der man nur zu leicht Glauben schenkt, wenn sie vorgibt, was wahr und was falsch ist. Diese Tatsache hat damit Teil an der Realitätsverzerrung der heutigen Zeit. Natürlich kann und darf man dem nicht in der Weise entgegenwirken, daß man in den Medien künstlich eine „heile Welt“ schafft., indem man jede Gewaltdarstellung vom Bildschirm verbannt. Dies würde ebenfalls zu einer Realitätsverzerrung in die entgegengesetzte Richtung führen. Man darf vor der ansteigenden Gewalt der heutigen Zeit nicht die Augen verschließen. Man muß jedoch ebenfalls achtgeben, daß man sie nicht überall wittert und ihr nicht die Reichweite zugesteht, die sie nicht hat. So etwas könnte zu einer allgemeinen Resignationshaltung führen. Der richtige Kompromiß für reale Gewaltdarstellung in den Medien wäre gefunden, wenn Berichterstattung seriös, etwa auf der Basis normaler Nachrichtensendungen gesendet würde, weder verharmlosend noch verherrlichend oder reißerisch. Der Zuschauer selbst muß lernen, das Gesehene und Gehörte richtig zu deuten und zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden.
3.4 Abstumpfung des Rechtsbewußtseins durch Mediengewalt?
Die Auswirkungen von Gewalt in den Medien kann man schwer verallgemeinernd feststellen. Zu viele Begleitumstände und -faktoren müssen hierbei berücksichtigt werden. Dennoch ist eine Tendenz zu allgemeiner Abstumpfung und Verwilderung der Gesellschaft erkennbar. Der einzelne versucht, durch Medienkonsum eigene Aggressionen oder die Langeweile des Alltags zu kompensieren. Dabei wird ihm eine immer normaler scheinende, gewaltvolle Realität vor Augen geführt, die er - ist er labil genug - leicht imitiert, aber zumindest vorschnell akzeptiert. Konflikte scheinen mit Gewalt am einfachsten zu lösen sein. So kann das Rechtsbewußtsein des einzelnen von Medien beeinflußt werden, es stumpft ab, sofern man sich nicht dagegen zu wehren weiß. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, welche auch noch aus instabilen Verhältnissen kommen, ist die Gefahr groß, daß sie sich bei der Suche nach einer Autorität und nach ihrer Identität zu leicht von den Medien nachhaltig beeinflussen lassen. Hier wird der Ruf laut nach einem verantwortungsbewußten Umgang mit Massenmedien und nach mehr Verantwortung seitens der Medien selbst, denn auf diese Weise könnte man den Problemen, welche die Mediengewalt darstellt, ein wenig entgegenwirken.
4. Information durch Medien
Zuvor wurde festgestellt, daß eine wichtige Aufgabe der Medien in der Vermittlung von Informationen liegt. Die Tageszeitung gehört in den meisten Haushalten zur morgendlichen Pflichtlektüre, abends schaltet jeder die Nachrichten ein, um „auf dem Laufenden“ zu bleiben. Massenmedien stellen heutzutage die Hauptinformationsquelle für die Bevölkerung dar.
4.1 Information - Erschaffung eines Weltbildes?
Die Bedeutung der Medien und ihrer Informationsvermittlung hat sich im Laufe der Jahre drastisch geändert. Ein Beispiel, an welchem sich dieser Prozeß plastisch verdeutlichen läßt, ist die Sichtweise des Medienforschers Karl Steinbuch. In seinem 1968 veröffentlichten Buch „Die informierte Gesellschaft“ glaubt er, daß gerade durch das Fernsehen eine völlig neue Qualität des Menschseins ermöglicht werde, der völlig informierte Bürger. Bereits 1978 erschien vom selben Autor ein Buch mit dem Titel „Maßlos informiert - die Enteignung unseres Denkens“. Darin stellt er die These auf, daß der Mensch durch das Fernsehen von der Erkenntnis der Wirklichkeit abgehalten werde. Steinbuchs pessimistische Haltung gipfelt 1988 mit dem „Zeitgeist in der Hexenschaukel“. Darin wirft er dem Fernsehen und sonstigen Medien vor, Verfälschungsinstitutionen der Wirklichkeit zu sein. Die Bedeutung der Informationsvermittlung kehrt Steinbuch damit in nur zwanzig Jahren ins Gegenteil um. Doch auch hier darf nicht zu hart geurteilt werden. Sicher gibt es gerade im medialen Bereich Manipulation, wie im vorhergehenden Kapitel am Beispiel von reißerischen Magazinbeiträgen verdeutlicht. Dennoch darf man nicht leugnen, daß gerade das Fernsehen ein reichhaltiges und leicht erreichbares Angebot an Informationen und kulturellen Inhalten vermittelt, daß es auf diese Weise auch zu einer Mobilisierung des Interesses führt: Der Rezipient verfolgt das Erfahrene weiter, auch anhand von Zeitungen und Zeitschriften, deren Auflagen steigen. Die Wirkung all dieser Informationen bleibt dennoch im oberflächlichen Bereich. Viele Bürger flüchten sich daher auch in die Isolation. Das visuelle Medium dient häufig mehr Entspannungs- und Unterhaltungsinteressen als Bildungsbedürfnissen. Hier kommt wieder die Persönlichkeitsstruktur des einzelnen zum Tragen: wie jeder letztendlich die Medien nutzt, ist seine Entscheidung. Die Oberflächlichkeit der Informationsvermittlung wird besonders deutlich bei Jugendlichen. Sie erhoffen sich durch das Fernsehen wesentliche Kenntnisse, die ihnen auch schulische Vorteile einbringen. In der Tat belegt eine Bochumer Untersuchung, daß die Kenntnisse über das politische Geschehen bei Jugendlichen mit der Höhe des Fernsehkonsums zunehmen. Diese sind jedoch nur punktuell. Einen Beitrag zum Verstehen politischer Grundstrukturen und Gesamtzusammenhänge leistet das Fernsehen jedoch nicht. Derart lehrreich wie einst euphorisch erhofft und teilweise wohl immer noch vermutet sind die Medien also nicht. Doch bergen sie Gefahren? Die Flut der visuellen Eindrücke durch das Fernsehen übt einen stärkeren Einfluß auf uns aus, als Druckerzeugnisse oder das akustisch vernommene Wort. Optische Eindrücke werden besonders intensiv aufgenommen, das menschliche Auge kann nicht zweifeln. Aus solchen Eindrücken werden häufig unbewußte Schlüsse gezogen. Ohne Hinzuziehung bewußten Denkens wird so der Wahrnehmungsakt zu einer Konstruktion von Wirklichkeit. Oft werden Ängste laut, das Fernsehen führe zu einer Entpolitisierung. Die Überlegung hierfür war, daß Medien versuchen könnten, bestimmte Meinungen zu unterdrücken, die beim Publikum Mißfallen erregen würden. Zwar versuchen die Medien durchaus, sich an das Publikum anzupassen, doch nicht durch Unterdrückung und Ausklammerung von Informationen und Inhalten, sondern durch publizistische Aufbereitung des jeweiligen Themas. Ein Verschweigen könnte sich kein Kommunikationsmedium erlauben, ohne unglaubwürdig zu werden, zumal die Medien untereinander in Konkurrenz zueinander stehen, und ein Versäumnis des einen schnell durch das andere Medium aufgedeckt und ergänzt würde. Der Zuschauer bekommt somit zumindest die Möglichkeit, sich maßlos zu informieren und hierzu auch verschiedene Medien zu nutzen. Welchen Inhalten er sich zuwendet, ist dabei abhängig von seiner Bildung und Schichtzugehörigkeit, seinen Erfahrungen, dem Nutzen, den er sich von den Informationen verspricht, und auch davon, ob sie ihn emotional ansprechen, wie es z.B. wichtige Ereignisse tun. Die Rolle, die das Fernsehen beim Wecken von Interessen spielt, ist mithin nicht zu unterschätzen. Doch muß man Vorsicht walten lassen und darf nicht zu leicht allem Glauben schenken, was man durch das Fernsehen erfahren hat. Eine gründliche Hintergrundrecherche des Rezipienten ist nicht selten notwendig, um das Gesehene und Gehörte richtig zu interpretieren und nicht die Realität verzerren zu lassen.
4.2 Das Bild des Rechts in den Medien
Eine Seite der medialen Darstellungsweise von Recht ist bereits im Rahmen der Mediengewalt in Kapitel drei ausführlich betrachtet worden. Gleichzeitig mit dem Eindruck, in einer völlig brutalen, gewaltvollen Welt zu leben, lassen die Medien - vorab wieder das Fernsehen - auch die „gute Seite“, die juristische Seite nicht zu kurz kommen. In den meisten Fernsehkrimis wird der Täter am Ende festgenommen. Privatdetektive in amerikanischen Serien finden den Schuldigen, Anwälte gewinnen Prozesse. Nach der bloßen Kriminalitätsberichterstattung gibt man auch im fiktiven Bereich dem Thema „Recht“ zunehmend Raum. Dem Zuschauer wird vor Augen geführt, daß es trotz aller auf ihn lauernden Gefahren immer noch eine schützende Instanz gibt, die am Ende das Recht siegen läßt. In der Tat: Polizei-, Anwalts- und Gerichtsserien boomen. Wenig berücksichtigt wird in ihnen jedoch der Umstand, daß viele Verbrechen und Vergehen oft ungeklärt bleiben. Auch Bagatelldelikte kommen zu kurz, so daß die Rechtsprechung sich nur mit Mord, Totschlag und ähnlichem zu beschäftigen scheint. Die Filme müssen spannend und abwechslungsreich aufbereitet sein, sie dienen mehr als „escape“ denn als Information. Trotzdem prägen sie sich ein und liefern dem Rezipienten ein Bild über eine bestimmte Art von Wirklichkeit, welches er unbewußt für wahr befindet. Besonders prägend, da häufig ausgestrahlt, ist das Bild des amerikanischen Rechts, des amerikanischen Gerichtsprozesses, da gerade im Filmgeschäft oft auf US-Ware gesetzt wird. Durch Bücher wird dies noch verstärkt. Ein gutes Beispiel ist John Grisham, dessen Kriminalromane sich wachsender Beliebtheit erfreuen und nach und nach auch verfilmt werden. Mancher hierzulande mag sich im amerikanischen Recht besser auskennen als im hiesigen. Aber auch das deutsche Recht kommt in den Medien nicht zu kurz. Eine Fülle von Verbrauchersendungen informiert den Zuschauer über seine Rechte und Pflichten. Ratgeber oder vor laufender Kamera ausdiskutierte Rechtsentscheidungen tragen dazu bei, daß der einzelne Informationen über seine Rechtslage erhält. Besonders eine recht neue Spezies von Verbraucherschutzsendungen vertritt die Interessen des einzelnen: solche Sendungen wie Beispielsweise die auf RTL ausgestrahlte „Wie Bitte?!“ nehmen sich derer an, die sich unrecht behandelt fühlen und vertreten sie im Kampf gegen Behörden und ein Rechtssystem, das hin und wieder Unrecht spricht. Damit wird das Fernsehen selbst zu einer Rechtsgewalt, deren sich der Zuschauer bedient, wenn er sich bei der sonstigen Jurisprudenz nicht aufgehoben fühlt. Alles in allem sind die durch Massenmedien gelieferten Bilder des Rechts sehr umfangreich und - informiert man sich umfassend und nicht nur einseitig - auch recht komplett. Das Rechtssystem wird sowohl mit seinen Stärken als auch seinen Schwächen aufgezeigt, allerdings entspricht die Gewichtung der rechtlichen Problemdarstellungen nicht der Realität, weil in Wahrheit Bagatelldelikte einen großen Teil der strafrechtlichen Rechtsprechung und Rechtsetzung beanspruchen, denen die Medien kaum Beachtung schenken. Auch das Zivilrecht als „Recht des Alltags“ kommt in der Regel zu kurz.
4.3 Wachstum des Rechtsbewußtseins durch Medieninformation?
Die ständige Enthüllung der Medien von Unrecht, das einzelnen widerfährt, mit der gleichzeitig genannten Information, wie man in Zukunft solche Geschehnisse verhindern könne, wie man sich rechtlich absichern und wehren kann, verstärkt sicher das Rechtsbewußtsein des einzelnen. Je mehr Möglichkeiten von Gut und Böse er vor Augen geführt bekommt, um so eher wird sich der Zuschauer damit befassen, wie er selbst Recht behält. Denn Recht haben und Recht bekommen - wer will das nicht? Doch gerade durch das zunehmende Angebot der Medien selbst, dem Rezipienten zur Seite zu stehen, erhält dieser eine zusätzliche Möglichkeit, die ihm oft aussichtsreicher scheint als die bisherigen. So wendet er sich dann ab von der Rechtsprechung und hin zu den Medien, welche ihn im Licht der Öffentlichkeit scheinbar wirkungsvoller vertreten - werden doch in den Sendungen nur eigene Erfolge ausgestrahlt. Es ist aber auch möglich, daß der Betroffene erst durch die Medien auf rechtliche Möglichkeiten aufmerksam gemacht wird und sich der Justiz zuwendet. Schlimm ist der Rückgriff auf Gewaltanwendung. Auch diese ist ein außergerichtliches Mittel, auf das einzelne zurückgreifen, wenn ihr Vertrauen in das Rechtssystem gestört ist. Grundsätzlich ist sich der Zuschauer zunehmend seiner eigenen Rechte bewußt, doch um diese zu verwirklichen greift er nicht immer zu den üblichen sondern mehr und mehr zu verschiedensten Rechtsbehelfen und geht eigene Wege. Seine Entscheidungen sind dabei wieder stark von eigenen Erfahrungen abhängig.
5. Medien formen Recht - Recht formt Medien
Vorab wurde festgestellt, wie sehr die Medien das Bild des Rechts in der Bevölkerung prägen. Doch auch das Recht beeinflußt die Medien. Gesetzliche Vorschriften, wie z.B. die Pressefreiheit oder das Rundfunkrecht belegen dies. Im Folgenden mehr zur Problematik des Wechselspiels zwischen Recht und Medien.
5.1 Das Zensurproblem - Pressefreiheit kontra Menschenwürde
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es in Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes. Artikel 5, Absatz 1 besagt: „ Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Zu leicht geraten diese Vorschriften miteinander in Kollision. Die Medien sind zu einer gesellschaftlich relevanten Institution geworden. Sie besitzen eine öffentliche Aufgabe, die in der Beschaffung und Verbreitung von Informationen besteht. Daher sind die Medien grundrechtlich geschützt. Wie weit aber geht dieser Verfassungsschutz? Zuerst einmal muß gesehen werden, daß die Medien gerade nur wegen ihrer öffentlichen Aufgabe den Schutz des Artikels 5 genießen. Sie stellen das schnellstmögliche Informationssystem dar und tragen so zu politischer Erziehung, einer Bewußtseinsschärfung und der Erhaltung der Demokratie bei. Nun haben aber institutionelle und professionelle Verdichtungen in den Medienanstalten, außerdem die Veränderung der Bedürfnisse verschiedener Verbrauchergruppen zu einer neuen Entfremdung geführt: die intellektuelle und wissenschaftliche Deutung hat sich durch die Medien zunehmend von der Wirklichkeit entfernt. Häufig wird nicht journalistisch, sondern politisch und strategisch vorgegangen, was alle ethischen Maßstäbe verletzt. Oft wird gerade bei Verleumdungen von Einzelpersonen oder Personengruppen die Grenze des Verfassungsschutzes überschritten. Deutlich wird dies an jenem Frankfurter Gerichtsurteil, nach welchem Soldaten als potentielle Mörder bezeichnet werden dürfen. Dieses Urteil basiert auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juni 1982, welches Ehrverletzungen solcher Art zuläßt, und an welches alle deutschen Gerichte gebunden sind. Die Folge davon ist, daß jeder öffentlich jede emotional und subjektiv begründete Meinung oder Beleidigung äußern kann und dabei von der Karlsruher Entscheidung gedeckt ist. Die Grenze zwischen Wert- und Vorurteilen verwischt an dieser Stelle. Beleidigende Behauptungen mit dem Charakter eines Vorurteils dürften nicht von Artikel 5 gedeckt sein. In den Medien jedoch werden sie plötzlich zu „harmlosen“ Werturteilen. Artikel 1 des Grundgesetzes wird hierdurch erheblich beeinträchtigt. In Ländern wie Frankreich, England und den USA ist der Ehrschutz der Persönlichkeit presserechtlich geregelt, ohne daß die Pressefreiheit beeinträchtigt ist. Es geht also gar nicht um eine Einschränkung der Pressefreiheit, sondern hier wird die politische und strategische Absicht sichtbar. Einem solchen Schmäh- und Kampagnenjournalismus muß Abhilfe geschaffen werden. Er muß vom eigentlichen Journalismus getrennt werden, denn letzterer ist Garant für Pressefreiheit und Demokratie. Eine solche Abgrenzung wäre noch nicht einmal Zensur, im Gegenteil: Die Freiheit der Presse nähme zu, Medien würden wieder glaubwürdiger und wirkten dem Werteverfall entgegen. Der Staat ist heute kein Freiheitsgegner sondern Garant für Freiheit. Medien haben somit nicht nur Rechte, sondern tragen auch eine große Verantwortung in der Gesellschaft, so daß Seriosität ein Muß darstellt.
5.2 Recht vor dem Auge der Öffentlichkeit
Auch das Recht wird durch die Medien geformt. Juristen wird öffentlich auf die Finger geschaut, bei den Zuschauern festigt sich ein bestimmtes Bild „des“ Rechts - darauf muß das Recht reagieren. Die Massenmedien klären immer häufiger über Rechtsverstöße von Unternehmen, Wirtschaftsführern, Parteien und Politikern auf, die Öffentlichkeit erlebt eine Flut von Skandalen. Viele darauf bezogene Gerichtsprozesse spielen sich ebenfalls öffentlich ab, werden manchmal sogar verfilmt. Wieder muß hier unterschieden werden zwischen dem reißerischen Sensationsjournalismus und einem Journalismus, der aufklären und informieren will, der verhindern will, daß vertuscht und gepfuscht wird. Die erstgenannte Form zieht das Recht nur zu leicht in politische Streitigkeiten hinein, es besteht die Gefahr, Recht manipulierend zu gebrauchen. Der seriöse Journalismus dagegen gilt als Kontrollinstanz, der sich auch das Recht nicht beugen kann - und so bei der Neutralität bleiben muß, die ihm ohnehin anhaften sollte. Recht befindet sich im Wandel - langsam, aber permanent. Recht wird und wandelt sich durch Rechtsetzung und Rechtsprechung. In eben diese wird durch politische Konstellationen, Interessenlagen, intellektuelle Diskurse und öffentliche Auslegung in den Massenmedien eingegriffen. Damit formen Medien Recht unmittelbar, und dies nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland. Die Medien strahlen die westlichen Lebensverhältnisse in alle Teile der Welt aus. In der Bevölkerung Rußlands und Osteuropas z.B. wuchs so die Sehnsucht nach einem solch freiheitlichen, westlichen Lebensstil. Ohne die Medien wäre es aber nie möglich gewesen, diese Sehnsucht zu einer umstürzenden Macht werden zu lassen. Auch de deutsche Wiedervereinigung wäre ohne das Fernsehen niemals so geschehen. So wurden die Demonstrationen und der politische Aufbruch weltöffentlich, die Massenmedien erfüllten eine ermutigende Verstärkerfunktion. Die in Gang gesetzte politische Kausalkette brachte in den neuen Bundesländern einen kompletten rechtlichen Umbruch mit sich. Das sind nur einige Beispiele der rechtlichen Konsequenzen, die Massenmedien herbeiführen können. In diesem Prozeß ist ihre Bedeutung äußerst positiv einzustufen, sind sie doch Garant für Demokratie geworden. So müssen die Medien auch weiterhin das Bewußtsein und den Willen zur Erhaltung - oder in einigen Staaten zur Schaffung - der Demokratie als bestmögliche Staatsform schärfen.
6. Medien in der Zukunft - Internet und Co.
„Multimedia“ ist mehr und mehr zu einem Schlagwort unserer Zeit geworden. Informationen von CD-Rom oder aus dem Internet zu holen ist „in“, bequem, zeitsparend und oft umfassender als jede Bibliothek oder Enzyklopädie. Doch auch hier erwarten uns nicht ausschließlich Vorteile. Zunächst tauchen neue rechtliche Probleme auf. Wird ein neues Multimedia-Gesetz benötigt, oder sind die bisherigen Regelungen des Rundfunks und der Telekommunikation ausreichend? Wenn nicht, kann es noch Jahre dauern, bis Gesetze existieren, ferner Juristen ausgebildet sind, die sich mit der Materie vertraut gemacht haben. Außerdem müssen internationale Regeln gefunden werden. Der Benutzer selbst muß zunächst die Fähigkeit erwerben, mit den neuen Medien umzugehen und sie für sich sinnvoll zu nutzen. Diese sogenannte Medienkompetenz muß unbedingt gefördert werden, um eine Chancengleichheit zu erhalten. Einer neuen Klasseneinteilung in Technologiebewanderte und weniger Fähige muß vorgebeugt werden. Multimedia selbst liefern zahlreiche Einsatzmöglichkeiten bei der Wissensvermittlung. Diese selbstbestimmt wahrzunehmen, effizient aus dem reichhaltigen Angebot zu selektieren und auch Skeptikern den Umgang mit den neuen Medien nahezubringen soll das Ziel dieser neuen Förderung sein. Es muß ferner dafür gesorgt werden, daß der Verbraucher vor Desinformation und Manipulation geschützt wird und daß zugleich Meinungsvielfalt gewährleistet ist. Letztere ist durch die neuen Möglichkeiten nahezu uneingeschränkt gegeben: Das Internet ist durch seine immense Größe kaum mehr kontrollierbar, außerdem international, so daß Informationen von jedem und für jeden vorhanden sind. Schon diese Tatsache beugt einer einseitigen Manipulation vor, da gerade durch die Angebotsvielfalt keine einseitige Beeinflussung möglich ist. Damit haben die neuen Medien eine immense Bedeutung für die Demokratie. Neue Möglichkeiten, aber auch neu Gefahren tun sich auf. Diese sind in Wahrheit gar nicht neu, sondern nur abgeändert oder verstärkt. Zur Mediengewalt des Fernsehens gesellt sich - mit ebenso facettenreichen Wirkungsmöglichkeiten - das Gewaltspiel am Computer. Informationen liefert in Zukunft zusätzlich das Netz - und zwar auch hier jede Art von Information, schlechter kontrollierbar aber vielfältiger. Durch Mail und Chat sind neue Kommunikationsmöglichkeiten gegeben, die Welt rückt näher zusammen, der „Two-Step-Flow of Communication“ erhält die Möglichkeit, nicht nur gruppendynamisch zu geschehen, sondern in größerem Rahmen. Dennoch wird das Bedürfnis der Menschen nach Verankerung und Bodenständigkeit bleiben, was im negativen Fall Nationalismus begünstigt, im positiven Fall eine Identität auf regionaler Ebene. Sinnvoll genutzt können die neuen Medien jedoch nur eine Bereicherung darstellen. Sie bieten nie dagewesene Möglichkeiten, die nur richtig angewendet werden wollen. In ihren Wirkungen auf Recht und Rechtsbewußtsein werden sie sich jedoch kaum von den bisherigen Massenmedien unterscheiden. Individuell werden auch hier Informationen aufgenommen und verarbeitet. Doch mit dem zunehmenden Erwerb von Medienkompetenz wird der Nutzer mit Multimedia nur gewinnen. Er kann sich selbst sogar mehr in das Medium einbringen als zuvor: durch Diskussionsforen und die Möglichkeit, eigene Webseiten zu gestalten und anzubieten, was bisher nicht möglich war. Die Medien werden so zu einer Instanz mit mehr Nähe zum Rezipienten als zuvor und so zu einem Symbol für Demokratie.
7. Zusammenfassung
Es bleibt zu sagen, daß in der heutigen Zeit auf Medien nicht mehr verzichtet werden kann.
Die Vorgehensweise bestimmter Journalisten, wie denen der „Bild“-Zeitung, und Romane wie Orwells „1984“ oder Bölls „Verlorene Ehre der Katharina Blum“ haben dazu beigetragen, daß Medien oft mit Vorsicht behandelt werden. Das kann nicht schaden, zumal Medien keineswegs ungefährlich sind. Es gibt die verschiedensten Arten von Medienbeiträgen, nützliche und schädliche. Hierauf ist schwerlich Einfluß zu nehmen. Doch kann der einzelne zu einem bewußten und verantwortungsvollen Umgang mit Medien erzogen werden. Mit Medienkompetenz - auch in bezug auf längst bekannte Medien - kann der Rezipient nur Vorteile aus dem Angebot ziehen. So behalten die Massenmedien ihren hohen Nutzen für die Gesellschaft bei.
Literaturverzeichnis
Beste, Dieter Zwischen Big Brother und dem Marktplatz von Athen, Spektrum der Wissenschaft 8 / 96, S. 42 ff. (Zitiert: Beste; Kälke; Mosdorf, Spektrum 8/96)
Bossle, Lothar Videologie als Zerstörung der Gewaltenteilung Paderborn, 1995 (Zitiert: Bossle, Videologie als Zerstörung von Gewaltenteilung)
Frank, Bernward Kinder vor dem Bildschirm - zur Diskussion über Gewalt- darstellungen, Medienforschung, 111 ff. Berlin, 1974 (Zitiert: Frank, Medienforschung)
Frenz, Hans -Georg Theoretische Grundlagen der multimedialen Kommunikation, Spektrum der Wissenschaft 8 / 96, S. 32 ff. (Zitiert: Frey; Kempter; Frenz, Spektrum 8/96)
Frey, Siegfried s. Frenz, Hans-Georg
Halloran, James D. Fernsehen, gesellschaftliche Anpassung und Kriminalität, Medienforschung, 120 ff. Berlin, 1974 (Zitiert: Halloran, Medienforschung)
Hillebrand, Annette Medienkompetenz - die neue Herausforderung der Informationsge- sellschaft, Spektrum der Wissenschaft 8 / 96, S. 38 ff. (Zitiert: Lange; Hillebrand, Spektrum 8/96)
Hoffmann-Riem, Wolfgang Medienwirkung und Medienverantwortung, Medienwirkung und Medienverantwortung, 19 ff. Baden-Baden, 1975 (Zitiert: Hoffmann-Riem, Medienwirkung und Medienverantwor- tung)
Hüther, Jürgen Sozialisation durch Massenmedien Westdeutscher Verlag, 1975 (Zitiert: Hüther, Sozialisation durch Massenmedien)
Kälke, Marion s. Beste, Dieter
Kempter Guido s. Frenz, Hans-Georg
Lange, Bernd-Peter s. Hillebrand, Annette
Lüscher, Kurt Jurisprudenz und Soziologie, Medienwirkung und Medienverantwortung, 81 ff. Baden-Baden, 1975 (Zitiert: Lüscher, Medienwirkung und Medienverantwortung)
Menningen, Walter Die Auswirkungen von Massenkommunikation auf die gesellschaftliche Entwicklung, Medienforschung, 53 ff. Berlin, 1974 (Zitiert: Menningen, Medienforschung)
Mosdorf, Siegmar s. Beste, Dieter
Münch, Richard Recht als Medium der Kommunikation, Zeitschrift für Rechtssoziologie 1992, 65 ff. (Zitiert: Münch, ZfRsoz 92)
Nuissl, Ekkehard Massenmedien im System bürgerlicher Herrschaft Berlin, 1975 (Zitiert: Nuissl, Massenmedien im System bürgerlicher Herrschaft)
Schenk, Michael Publikums- und Wirkungsforschung Tübingen, 1978 (Zitiert: Schenk, Publikums- und Wirkungsforschung)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Wirkung von Massenmedien auf Rechtsadressaten"?
Der Text untersucht die Auswirkungen von Massenmedien auf Menschen in ihrer Rolle als Rechtssubjekte. Er analysiert, wie Medien das Rechtsverständnis und ethisches Verhalten beeinflussen.
Welche Hauptbereiche werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte:
- Wirkung von Massenmedien auf Rechtsadressaten
- Grundlagen der Medienwirkungsforschung
- Gewaltdarstellung in den Medien (Auswirkungen auf Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Abgrenzung reale/fiktive Gewalt, Abstumpfung des Rechtsbewusstseins)
- Information durch Medien (Erschaffung eines Weltbildes, Bild des Rechts, Wachstum des Rechtsbewusstseins)
- Medien formen Recht - Recht formt Medien (Zensurproblem, Recht vor der Öffentlichkeit)
- Medien in der Zukunft - Internet und Co.
- Zusammenfassung
Wie beeinflusst Gewaltdarstellung in den Medien Kinder und Jugendliche?
Der Text diskutiert, dass Kinder und Jugendliche besonders anfällig für die negativen Auswirkungen von Mediengewalt sein können. Es wird die Stimulationstheorie angesprochen, nach der vermehrtes Gewaltfernsehen zu erhöhter Aggression führen kann. Allerdings wird betont, dass familiäre und soziale Umstände eine wichtige Rolle spielen.
Welche Auswirkungen hat Gewaltdarstellung auf Erwachsene?
Auch bei Erwachsenen werden verschiedene Theorien diskutiert (Katharsis-, Habitualisierungs-, Inhibitionstheorie, Stimulationstheorie). Der Text betont, dass die Persönlichkeitsstruktur und das soziale Umfeld eine wichtige Rolle spielen. Eine Gefahr besteht darin, dass Mediengewalt Einstellungen über Normalität prägt und zu Vorurteilen führt.
Wie unterscheiden sich reale und fiktive Gewalt in den Medien?
Der Text stellt fest, dass die Forschung sich hauptsächlich auf fiktive Gewalt konzentriert, während reale Gewaltszenen (Nachrichten, Dokumentationen) oft vernachlässigt werden. Es wird argumentiert, dass reale Gewalt eine stärkere Wirkung haben kann, weil sie als Realität präsentiert wird. Die Vermischung von Realität und Fiktion in den Medien wird als Problem hervorgehoben.
Wie beeinflussen Medien das Rechtsbewusstsein?
Der Text diskutiert, dass die ständige Präsentation von Unrecht in den Medien das Rechtsbewusstsein stärken kann. Gleichzeitig wird die Gefahr der Abstumpfung und Verwilderung durch Gewaltdarstellung angesprochen. Die Medien können aber auch dazu beitragen, dass Menschen sich ihrer Rechte bewusst werden und diese durchsetzen wollen.
Wie formen Medien das Recht und wie formt das Recht die Medien?
Der Text behandelt die Wechselwirkung zwischen Medien und Recht. Einerseits prägen Medien das Bild des Rechts in der Bevölkerung. Andererseits beeinflusst das Recht die Medien durch Gesetze wie die Pressefreiheit und das Rundfunkrecht. Das Zensurproblem (Pressefreiheit vs. Menschenwürde) wird diskutiert.
Welche Rolle spielen die neuen Medien (Internet) in Bezug auf Recht und Medienwirkung?
Der Text betrachtet die neuen Medien als zusätzliche Informationsquelle und Kommunikationsmöglichkeit. Es werden neue rechtliche Probleme (Multimedia-Gesetz) und die Bedeutung der Medienkompetenz angesprochen. Die Vielfalt des Angebots im Internet kann einseitiger Manipulation vorbeugen.
Was ist die Kernaussage des Textes?
Der Text betont, dass Medien in der heutigen Zeit unverzichtbar sind, aber auch Gefahren bergen. Ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Medien (Medienkompetenz) ist wichtig, um die Vorteile zu nutzen und die negativen Auswirkungen zu minimieren.
- Citation du texte
- Ramona Kann (Auteur), 1997, Wirkung von Massenmedien auf den Rechtsadressaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95998