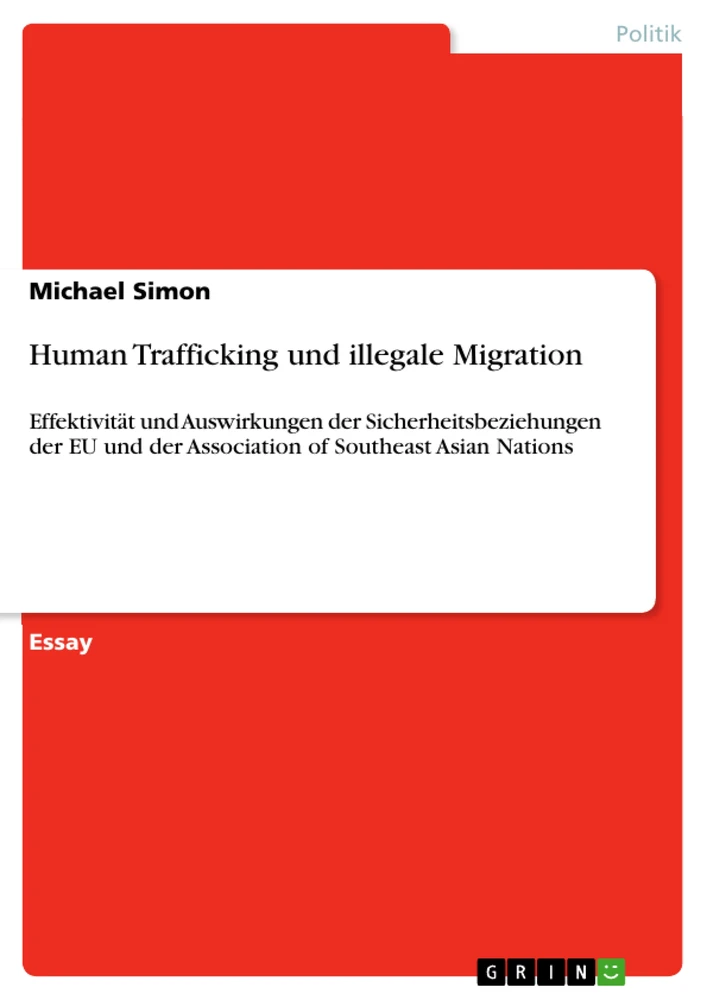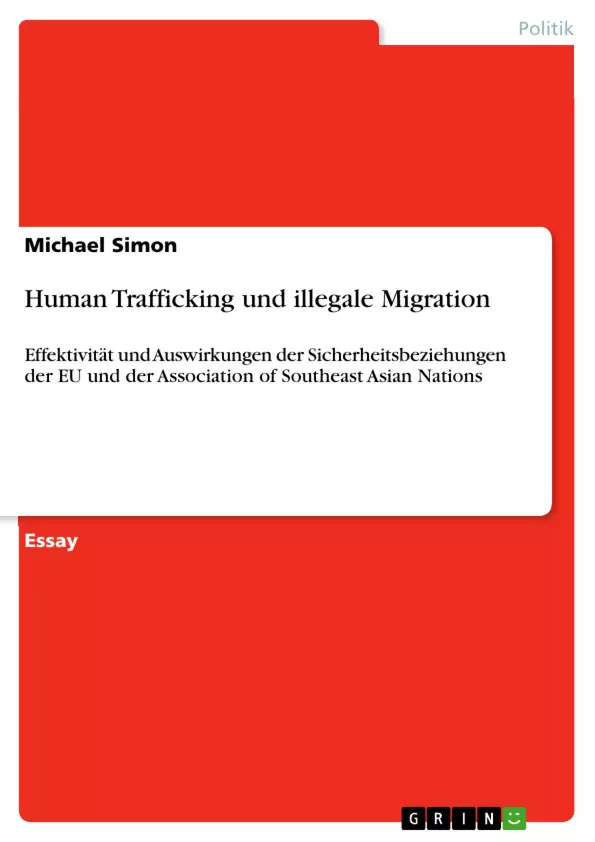Der Fokus in diesem Essay soll auf Human Trafficking liegen, doch viele der Ursachen beziehungsweise der Problemlösungsvorschläge lassen sich auch auf die illegale Migration anwenden.
Im April diesen Jahres ertranken an einem Tag 700 Menschen bei dem Versuch, mit dem Boot über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Diese Katastrophe löste eine Debatte in der EU aus, wie man mit dem Flüchtlingsproblem umzugehen hat. Fast zeitgleich wurde von den Rohingyas berichtet, die ebenfalls über den Seeweg versuchten, von Myanmar aus nach Malaysia, Indonesien oder auf die Philippinen zu gelangen. An den Küsten wurden sie jedoch abgefangen und wieder auf das offene Meer geschleppt. Die Rohingyas sind eine staatenlose Volksgruppe, die aufgrund ihrer prekären sozialen und wirtschaftlichen Lage besonders der Gewalt und Willkür von Schleusern und Menschenschmugglern ausgeliefert sind. Die Problemfelder illegale Migration und Human Trafficking, zu Deutsch Menschenhandel, überschneiden sich derart, dass es schwierig ist, eine klare Trennung zwischen den beiden Problemen zu ziehen.
Fünf Fragen sollen in dieser Arbeit beantwortet werden. Sie alle sind Bestandteil des Analysemodells der Interregionalismustheorie und stellen fünf unterschiedliche Funktionen aus der realistischen, liberalen und konstruktivistischen Theorie der internationalen Beziehungen dar. Die Fragen beschäftigen sich mit der Effektivität und den Auswirkungen der interregionalen Kooperation zwischen der Europäischen Union und der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN):
Trägt die genannte Zusammenarbeit zur interregionalen Institutionalisierung bei? Inwiefern kann sie einen globalen Beitrag zur Rationalisierung und zum Agendasetting leisten? Werden geoökonomische und geostrategische Machtungleichgewichte ausgeglichen? Findet eine Normdiffusion zwischen den beiden Regionen statt? Sind regionale Identitäten entstanden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung der Problematik
- Push- und Pull-Faktoren
- Faktoren, die die Bekämpfung erschweren
- Analysemodell der Interregionalismustheorie
- Interregionale Institutionalisierung
- Globaler Beitrag zur Rationalisierung und zum Agendasetting
- Ausgleich geoökonomischer und geostrategischer Machtungleichgewichte
- Normdiffusion zwischen den Regionen
- Entstehung regionaler Identitäten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Problematik des Human Trafficking und seiner Auswirkungen auf die Sicherheitsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Dabei wird das Analysemodell der Interregionalismustheorie angewendet, um die Effektivität und die Auswirkungen der interregionalen Kooperation zu untersuchen.
- Analyse des Problems Human Trafficking im Kontext von illegaler Migration
- Bewertung der Interregionalen Kooperation zwischen EU und ASEAN in Bezug auf die Bekämpfung des Human Trafficking
- Identifizierung von Herausforderungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich des Human Trafficking
- Exploration des Einflusses von Push- und Pull-Faktoren auf die Entstehung des Problems
- Bewertung der Rolle von NGOs, wie der International Organization for Migration (IOM), im Kampf gegen Human Trafficking
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt die Problematik des Human Trafficking und der illegalen Migration anhand aktueller Beispiele ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Effektivität der interregionalen Kooperation zwischen der EU und der ASEAN im Bereich des Human Trafficking und definiert die fünf Forschungsfragen, die im Rahmen des Analysemodells der Interregionalismustheorie untersucht werden.
Darstellung der Problematik
Dieses Kapitel definiert den Begriff Human Trafficking und beleuchtet die vielfältigen Ursachen und Folgen des Problems. Es werden die Push- und Pull-Faktoren, die zur Entstehung von Human Trafficking beitragen, sowie die Faktoren, die die Bekämpfung erschweren, analysiert.
Analysemodell der Interregionalismustheorie
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der interregionalen Kooperation zwischen der EU und der ASEAN im Kampf gegen Human Trafficking. Es wird analysiert, inwiefern diese Zusammenarbeit zu einer interregionalen Institutionalisierung beiträgt, einen globalen Beitrag zur Rationalisierung und zum Agendasetting leistet, geoökonomische und geostrategische Machtungleichgewichte ausgleicht, Normdiffusion zwischen den Regionen bewirkt und regionale Identitäten entstehen lässt.
Schlüsselwörter
Human Trafficking, illegale Migration, interregionale Kooperation, EU, ASEAN, Interregionalismustheorie, Push- und Pull-Faktoren, Strafverfolgung, Schutz des Opfers, Prävention, Normdiffusion, regionale Identität, UN-Konvention gegen Menschenhandel, 3-P-Strategie, ASEM Conference of the Directors-General of Immigration, EEAS, IOM.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Human Trafficking und Menschenschmuggel?
Human Trafficking (Menschenhandel) beinhaltet Ausbeutung und Zwang, während Menschenschmuggel (Schleuserei) primär die illegale Grenzüberschreitung gegen Bezahlung zum Ziel hat, oft jedoch in Menschenhandel übergehen kann.
Was sind Push- und Pull-Faktoren bei illegaler Migration?
Push-Faktoren (wie Armut oder Krieg) treiben Menschen aus ihrer Heimat, während Pull-Faktoren (wie Arbeitsmöglichkeiten oder Sicherheit) sie in bestimmte Zielregionen locken.
Wie arbeiten die EU und ASEAN gegen Menschenhandel zusammen?
Die Zusammenarbeit erfolgt durch interregionale Dialoge, den Austausch von Best Practices bei der Strafverfolgung und gemeinsame Initiativen zum Opferschutz.
Was ist die 3-P-Strategie im Kampf gegen Human Trafficking?
Die Strategie basiert auf drei Säulen: Prevention (Prävention), Protection (Schutz der Opfer) und Prosecution (Strafverfolgung der Täter).
Welche Rolle spielt die IOM beim Thema Migration?
Die Internationale Organisation für Migration (IOM) unterstützt Regierungen bei der Bewältigung von Migrationsströmen, leistet Hilfe für Migranten in Not und fördert die internationale Kooperation.
- Arbeit zitieren
- Michael Simon (Autor:in), 2015, Human Trafficking und illegale Migration, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/960485