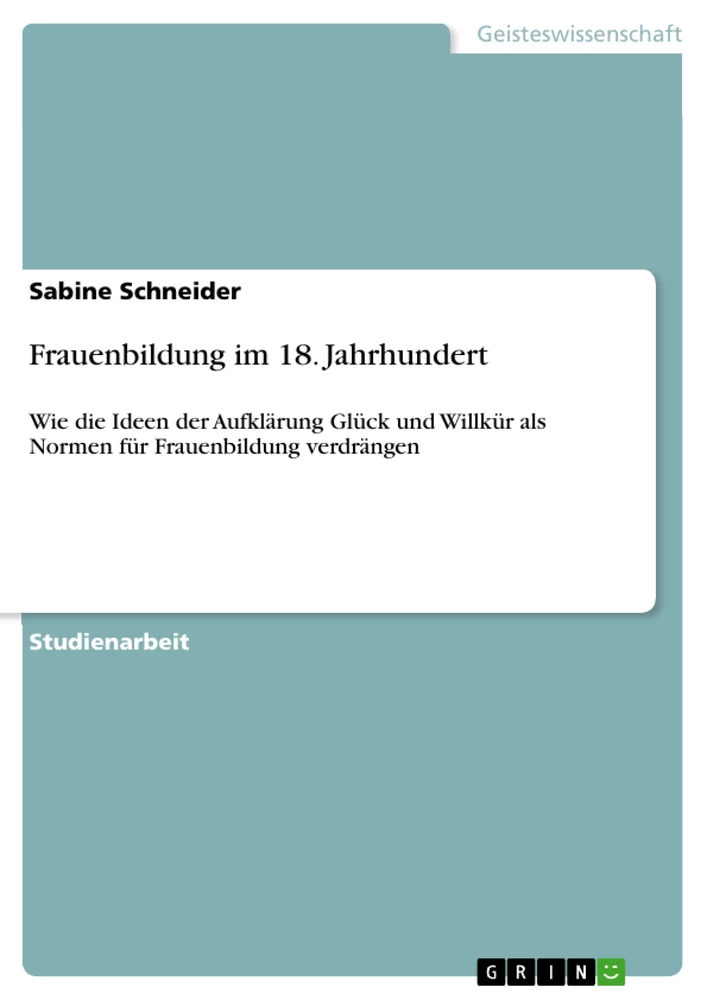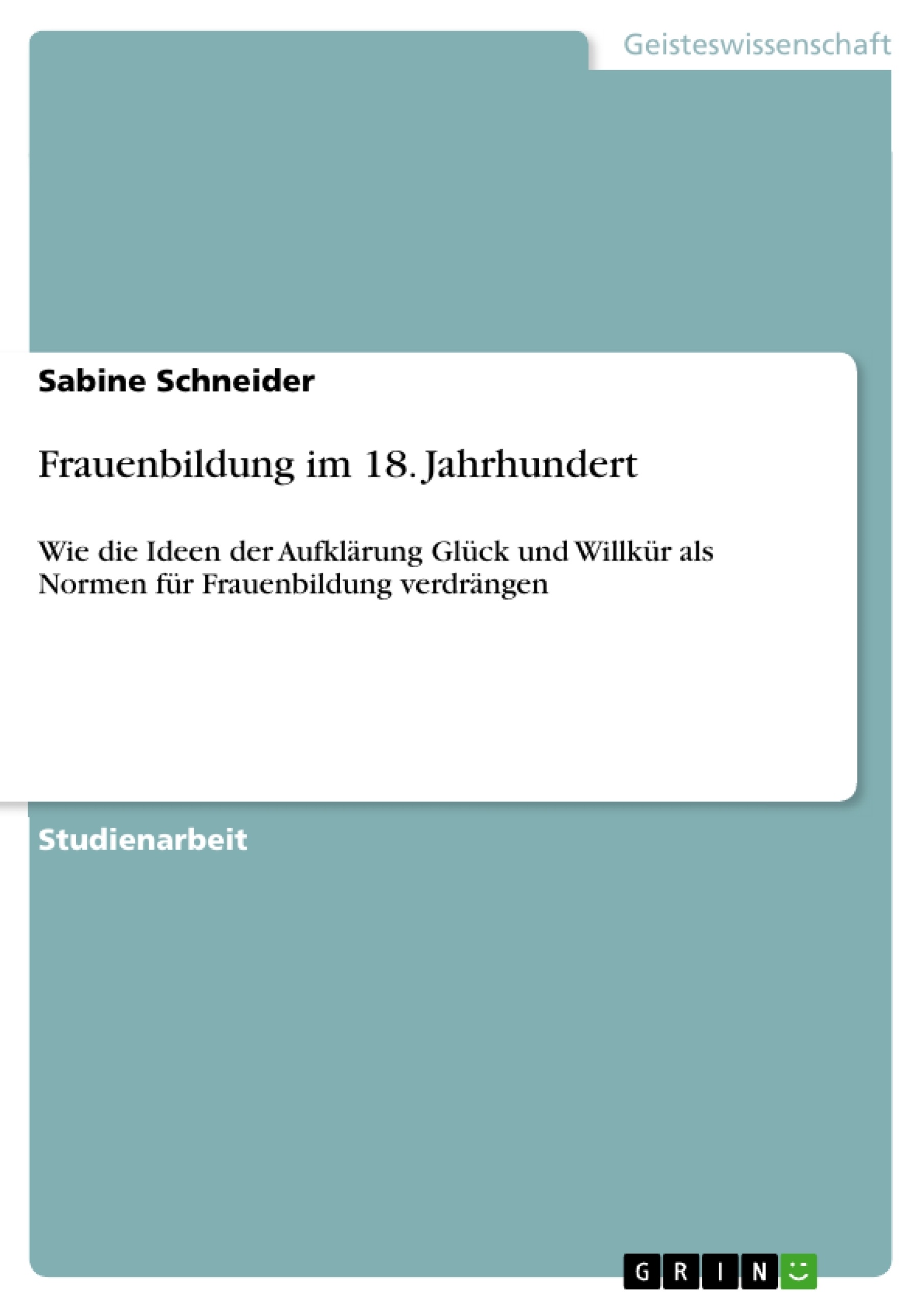Ziel der Arbeit ist es zu klären, welche gesellschaftlichen und kulturellen Geisteshaltungen den allgemeinen Bildungszugang für Frauen maßgeblich bestimmten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Hervorhebung komplexer Ungleichheiten, welche Frauen, im Vergleich zu Männern, vermehrt betrafen.
„Wie regeln Sie die Betreuung Ihrer Kinder?“ Man darf davon ausgehen, dass sich in heutiger Zeit die wenigsten männlichen Bewerber um eine neue Arbeitsstelle mit dieser Frage konfrontiert sehen müssen. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, weshalb Frauen heutiger Zeit überwiegend ihre eigene Karriere zurückstellen, um sich um Familie und Haushalt zu kümmern, ist nicht Grundlage dieser Arbeit. Weshalb es aber trotz berechtigter Kritik zur eingangs kommentierten Frage dennoch als Erfolg zu verstehen ist, dass sich diese Frage überhaupt stellen kann, wird durch die Betrachtung bestehender Verhältnisse im 18. Jahrhundert und des sich einsetzenden Entwicklungsprozesses zur Bildung der Frau deutlich gemacht.
Die Rolle der Frau unserer Gesellschaft hat sich im Laufe der letzten 50 bis 150 Jahre im Vergleich zu den vorherigen Jahrhunderten massiv gewandelt. Insbesondere in den Bereichen der Schul- und Bildungsgleichheit fanden die größten Veränderungen statt. Ausgelöst durch die Ideen der Aufklärung geht diese Arbeit den Grundzügen bestehender Instanzen und neuer, divergierender Entwicklungen und deren Bedeutsamkeit für ein erstes Aufbrechen tradierter Bildungsvorstellungen nach.
Inhaltsverzeichnis
- Frauenbildung im 18. Jahrhundert
- Einführung
- Subjektive Bedingungen und Willkür als Herausforderungen im Spießrutenlauf um weibliche Schulbildung
- Nützliche Handarbeit und Bibelwissen als höchster Grad weiblicher Bildung
- Eindeutig zweitrangig - an ihrem Körper kann der Geist der Frau nur scheitern
- Vive la Révolution – und was für die Frauen davon übrig blieb
- Die Entdeckung der Kindheit und Verdeckung des Mädchens
- Emile und seine demütige Ergänzung
- Fazit
- Eine Frau sieht rot
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Bildungssituation von Frauen im 18. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, mit einem Fokus auf die Herausforderungen, die durch die damaligen gesellschaftlichen und kulturellen Normen entstanden sind. Sie untersucht, wie die Ideen der Aufklärung sich auf die Bildungsmöglichkeiten von Frauen auswirkten und welche Hindernisse ihnen im Weg standen.
- Die Rolle von Religion und Theologie in der weiblichen Bildung
- Die Bedeutung von Handarbeit und Bibelwissen für die Erziehung von Frauen
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung der Frau als Wesen, das durch seinen Körper begrenzt ist
- Die Auswirkungen der französischen Revolution auf die Bildung von Frauen
- Die Kontroversen um Rousseaus Bildungsmodell und die Bedeutung von Amalia Holsts Gegenposition
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung vergleicht die heutige Diskussion über die Vereinbarkeit von Familie und Karriere mit der historischen Situation von Frauen im 18. Jahrhundert. Sie stellt den Kontrast zwischen der modernen Vorstellung von Bildung als Schlüssel zur Welt und der damaligen Realität von Frauen hinter fast verschlossenen Bildungstüren heraus.
- Subjektive Bedingungen und Willkür als Herausforderungen im Spießrutenlauf um weibliche Schulbildung: Dieses Kapitel analysiert die individuellen und gesellschaftlichen Hindernisse, die Frauen im 18. Jahrhundert im Zugang zur Bildung begegneten. Es zeigt, wie Willkür und subjektive Kriterien den Zugang zu Bildungsmöglichkeiten beeinflussten.
- Nützliche Handarbeit und Bibelwissen als höchster Grad weiblicher Bildung: Dieses Kapitel untersucht die traditionellen Bildungsideale für Frauen im 18. Jahrhundert, die Handarbeit und Bibelwissen als höchste Form weiblicher Bildung betrachteten.
- Eindeutig zweitrangig - an ihrem Körper kann der Geist der Frau nur scheitern: Dieses Kapitel beleuchtet die weit verbreitete Vorstellung von der körperlichen und geistigen Unterlegenheit von Frauen, die ihnen im 18. Jahrhundert den Zugang zu höherer Bildung verweigerte.
- Vive la Révolution – und was für die Frauen davon übrig blieb: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Französischen Revolution auf die Bildung von Frauen, wobei der Fokus auf den Kontrast zwischen den Idealen der Revolution und der Realität der Frauen liegt.
- Die Entdeckung der Kindheit und Verdeckung des Mädchens: Dieses Kapitel analysiert, wie die neue Entdeckung der Kindheit im 18. Jahrhundert die Sichtweise auf Mädchen und Frauen beeinflusste.
- Emile und seine demütige Ergänzung: Dieses Kapitel stellt Rousseaus Bildungsmodell in seiner Gesamtheit dar, wobei der Fokus auf der Position der Frau im Rahmen dieses Modells liegt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Themen wie Frauenbildung, Aufklärung, Religion, Geschlecht, Bildungsideale, soziale Normen, Geschlechterrollen und die Entwicklung der weiblichen Bildung im 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet den Einfluss von Persönlichkeiten wie Jean-Jacques Rousseau und Amalia Holst auf das Bildungsverständnis dieser Zeit.
Häufig gestellte Fragen zur Frauenbildung im 18. Jahrhundert
Was war der höchste Grad weiblicher Bildung im 18. Jahrhundert?
Traditionell galten nützliche Handarbeit und fundiertes Bibelwissen als die angestrebten Bildungsziele für Frauen.
Wie beeinflusste die Aufklärung die Bildungschancen von Frauen?
Die Ideen der Aufklärung führten zu einem ersten Aufbrechen tradierter Vorstellungen, stießen aber oft an Grenzen, wenn es um die tatsächliche Gleichstellung ging.
Welches Bildungsverständnis vertrat Jean-Jacques Rousseau gegenüber Frauen?
In seinem Werk "Emile" sah Rousseau die Frau primär als "demütige Ergänzung" des Mannes, deren Erziehung auf dessen Bedürfnisse ausgerichtet sein sollte.
Wer war Amalia Holst?
Amalia Holst war eine Vorkämpferin, die Rousseaus Bildungsmodell kritisierte und eine umfassendere geistige Bildung für Frauen forderte.
Welche Rolle spielte der Körper in der Bildungsdebatte?
Es herrschte die Meinung vor, dass der Geist der Frau aufgrund ihrer körperlichen Beschaffenheit begrenzt sei und sie daher für höhere wissenschaftliche Studien ungeeignet sei.
- Quote paper
- Sabine Schneider (Author), 2020, Frauenbildung im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/960534