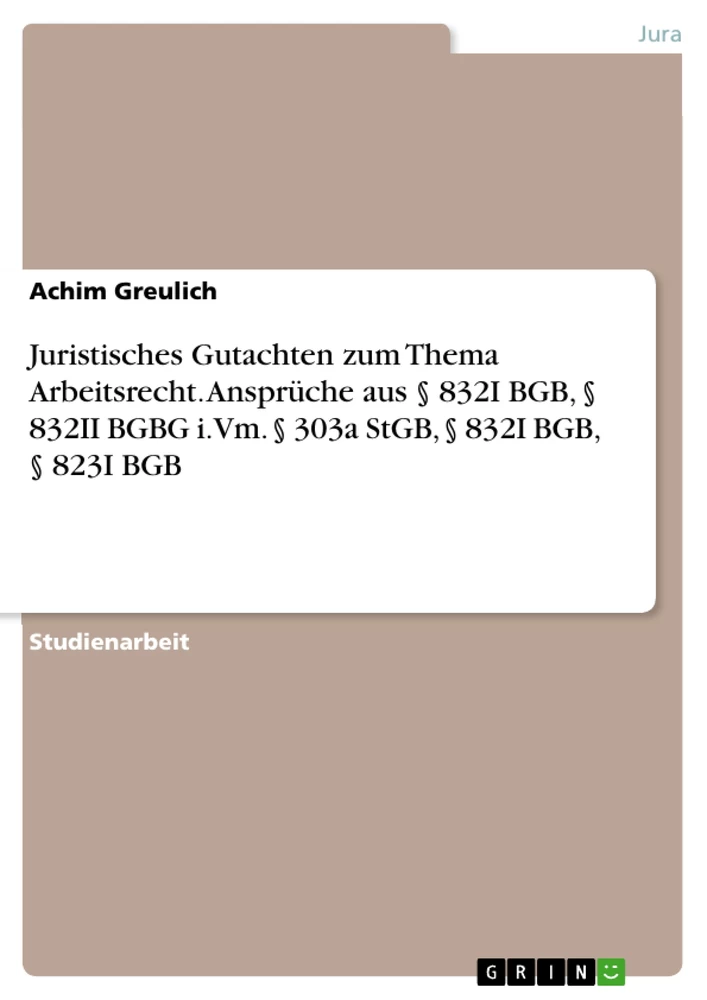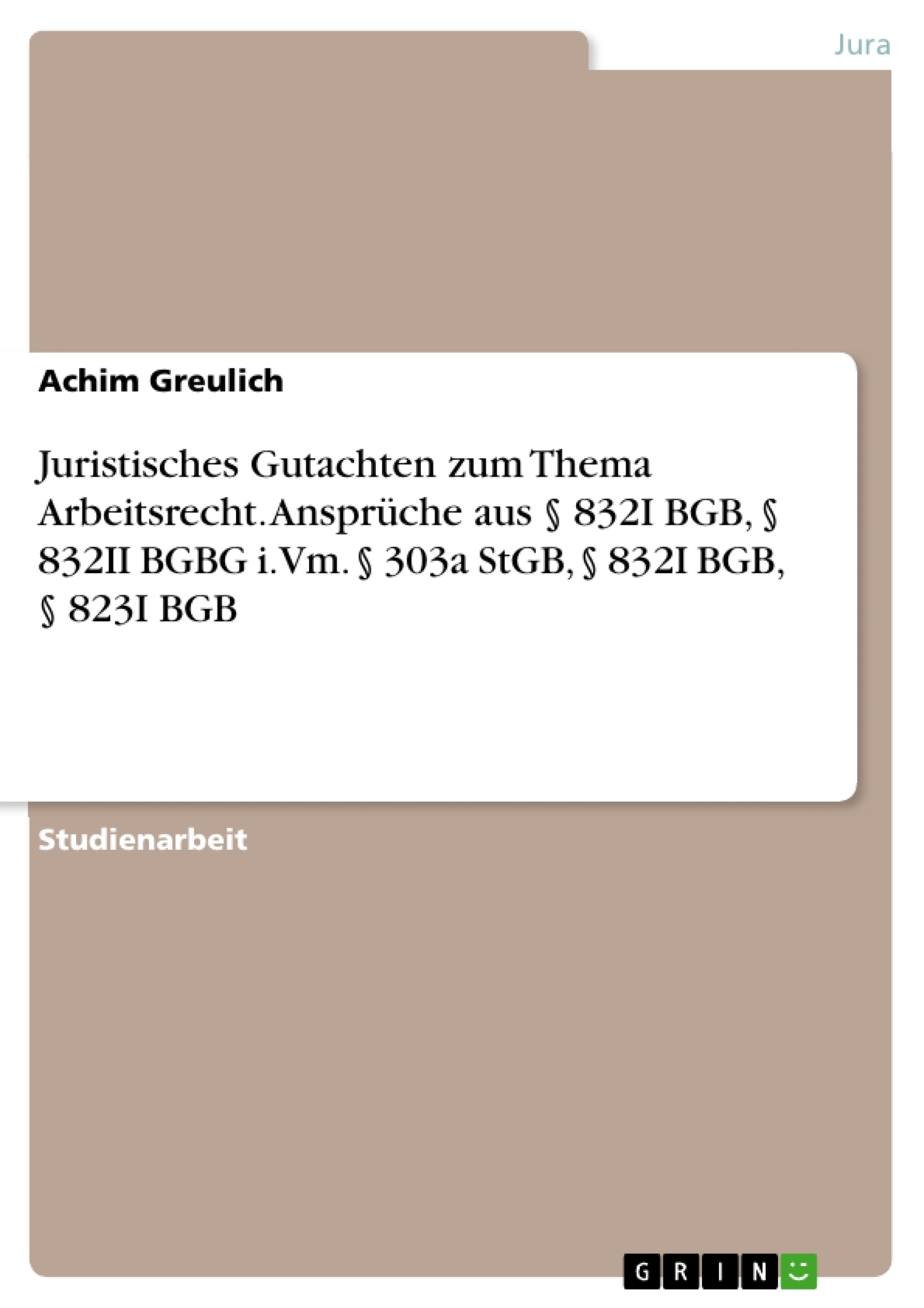Ein riskantes Spiel mit Daten und Vertrauen! Als der Automobilhersteller A Telearbeit einführt, ahnt niemand, welche verhängnisvollen Kettenreaktionen dies auslösen wird. Die Ingenieurin I, Mutter zweier Kinder, freut sich über die Möglichkeit, Beruf und Familie besser zu vereinbaren, doch ihre Dreizimmerwohnung wird zum Schauplatz eines folgenschweren Zwischenfalls. Ihre 13-jährige Tochter Tamara, vertraut mit Computern, löscht versehentlich immense Datenmengen einer wichtigen Versuchsreihe, was A zu einem immensen Schadensersatzanspruch von 200.000 DM zwingt. Wer trägt die Verantwortung für diesen digitalen Fauxpas? Ist Tamara haftbar für ihre unbedachte Handlung? Kann I für die Aufsichtspflichtverletzung belangt werden? Und welche Rolle spielt das Arbeitsrecht bei Telearbeit im Hinblick auf Haftung und Sorgfaltspflicht? Dieser Fall wirft brisante Fragen auf: Inwieweit haften Eltern für ihre Kinder bei Telearbeit? Welche Sorgfaltspflichten hat ein Arbeitnehmer im Homeoffice? Und wie wirkt sich das Arbeitsrecht auf die private Lebenssphäre aus? Neben der Klärung der Schadensersatzansprüche beleuchtet dieses Buch auch die arbeitsrechtlichen Konsequenzen der Telearbeit. Darf A die Telearbeitsplätze willkürlich kontrollieren und den Mitarbeiter C bei Verweigerung des Zutritts in den Betrieb zurückversetzen? Hat der Softwarespezialist S einen Anspruch auf einen Telearbeitsplatz, da er aufgrund seiner familiären Situation besonders darauf angewiesen ist? Die Analyse dieses Falls bietet spannende Einblicke in die rechtlichen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Telearbeit, Haftung und Persönlichkeitsrechten. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der ein falscher Klick verheerende Folgen haben kann, und entdecken Sie die juristischen Feinheiten, die diesen Fall so faszinierend machen. Das Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für Juristen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und alle, die sich für die rechtlichen Aspekte der Telearbeit interessieren. Telearbeit, Arbeitsrecht, Schadensersatz, Aufsichtspflicht, Haftung, BGB, StGB, KSchG, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Homeoffice, Arbeitsvertrag, Direktionsrecht, Änderungskündigung, Gleichbehandlungsgrundsatz, Betriebsrat, Mitverschulden, Rechtsgutverletzung, Kausalität, Rechtswidrigkeit, Verschulden, Schaden, Sachbeschädigung, Eigentumsverletzung, Deliktsrecht, Zivilrecht, Schuldrecht, Prozeßrecht, Jura, Rechtswissenschaft. Dieses Buch analysiert die komplexen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Telearbeit und bietet praktische Lösungsansätze für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es untersucht die Haftungsrisiken und zeigt, wie diese durch klare Richtlinien und Verantwortlichkeiten minimiert werden können. Die juristische Analyse der Thematik der Telearbeit wird hier durch die Erörterung der Interessensabwägung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergänzt. Es wird weiterhin auf die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit eingegangen. Das Buch bietet eine fundierte Grundlage für die Gestaltung rechtssicherer Telearbeitsvereinbarungen und hilft, Konflikte zu vermeiden.
Gliederung:
1. Teil: Schadensersatzansprüche des A
A. Möglicher Anspruch des A gegen Tamara
I. Anspruch aus § 823 I BGB
1. Rechtsgutverletzung
2. Kausalität zwischen Handlung und Verletzung
3. Rechtswidrigkeit
4. Verschulden und Verschuldensfähigkeit
a. Verschuldensfähigkeit
b. Verschulden
5. Schaden
6. Zwischenergebnis
II. Anspruch aus § 823 II BGB i.V.m. § 303a StGB
B. Möglicher Anspruch des A gegen I
I. Anspruch aus positiver Vertragsverletzung
1. Anwendbarkeit der pVV
2. Bestehen eines gegenseitigen Vertrages
3. Pflichtverletzung
4. Kausalität von Pflichtverletzung und Handlung
5. Rechtswidrigkeit
6. Verschulden
7. Einschränkung der Haftung
a. Grund für eine Haftungsbeschränkung
b. Voraussetzung für eine Haftungsbeschränkung
aa. Arbeitsverhältnis
bb. Betrieblich veranlaßte Tätigkeit
c. Umfang der Haftungsbeschränkung
8. Mitverschulden
9. Ergebnis
II. Anspruch aus § 832 I BGB
1. Rechtsgutverletzung durch Minderjährigen
2. Aufsichtspflicht
3. Entlastungsbeweis
III. Anspruch aus § 823 I BGB
IV. Haftungseinschränkung mit Wirkung zugunsten Dritter
1. Leistungsnähe
2. Erkennbarkeit für den Arbeitgeber
3. Interesse an der Einbeziehung Dritter
C. Ergebnis
2. Teil: Darf A den C in den Betrieb zurückversetzen
I. Möglicher Anspruch durch Direktionsrecht
1. Weisungsgebundenheit
2. Grenzen des Direktionsrecht
II. Möglicher Anspruch durch Änderungskündigung
1. Wirksamkeit der Änderungskündigung durch Annahme
2. Beendigungskündigung
a. Kündigungserklärung
b. Kündigungsgrund
c. Kündigungsausschließungsgrund
d. Kündigunsschutz nach dem KSchG
e. Voraussetzungen des § 1 KSchG
f. Zutrittsrechte zum Telearbeitsplatz
3. Ergebnis
3. Teil Hat S einen Anspruch auf einen Telearbeitsplatz
I. Anspruch aus Gesetz
II. Anspruch aus Vertrag
1. Gleichbehandlungsgrundsatz
III. Ergebnis
SACHVERHALT
1. In der Entwicklungsabteilung des Automobilherstellers A soll auf Wunsch zahl- reicher Arbeitnehmer Telearbeit eingeführt werden. Der Abteilungsleiter meint, daß 10 der insgesamt 50 Arbeitsplätze für eine teilweise Verlagerung in die Privatwohnung der Arbeitnehmer geeignet seien. Die betroffenen Arbeitnehmer stimmen einer entsprechenden Anpassung ihres Arbeitsvertrages sofort zu, unter ihnen auch die geschiedene Ingenieurin I, die wegen ihrer beiden Kinder gern einen Teil der Arbeit von zu Hause aus erledigen möchte.
I gibt allerdings zu bedenken, daß sie in ihrer Dreizimmerwohnung kein eigenes Arbeitszimmer einrichten kann, sondern sich der Telearbeitsplatz im geräumigen Wohnzimmer befinden würde. Dagegen hat A nichts einzuwenden.
Den Kindern verbietet I strikt, die Einrichtungen des Telearbeitsplatzes zu betätigen. Um aber ihre große Neugier zu befriedigen, dürfen sie hin und wieder ihrer Mutter bei der Arbeit zuschauen. Daher hat insbesondere die 13-jährige Tamara, die schon seit Jahren Erfahrungen am eigenen PC sammeln konnte, eine Vorstellung von den Ab- läufen.
An einem Nachmittag ruft A wegen Problemen bei der Installation neuer Software bei I an, die mit ihrem Handy ins Nebenzimmer geht, um dort Unterlagen einzusehen. Das Telephonat dauert etwa eine halbe Stunde. In diese Zeit setzt sich Tamara an den Computer. Die Online-Verbindung zum Zentralrechner ist schon hergestellt und Tama- ra startet das interessant klingende Auswertungsprogramm "CRASH". Durch die für sie ungewohnte Belegung der Funktionstasten verschiebt sie aus Versehen die sehr umfangreichen Rohdaten (4 GB) einer aufwendigen Versuchsreiche über einen neu- artigen Kunststoff für den Karosseriebau. Auf den Warnhinweis "Speichermedium zu klein, soll Operation fortgeführt werden? (Achtung: Gefahr von Datenverlust!) ja/nein" reagiert sie fälschlicherweise mit "ja". Dadurch geht ein großer Teil der Daten verlo- ren. Die Versuche müssen wiederholt werden, wodurch A Kosten von 200.000,-- DM entstehen, die er ersetzt verlangt.
2. Aufgrund dieses Vorfalls will A die Kontrolle der Telearbeitsplätze verschärfen und ohne Vorankündigung zu jeder Zeit Inspektoren schicken.
An einem Freitag gegen 19 Uhr erscheint bei C, der an drei Tagen pro Woche z.T. bis spät in die Nacht zu Hause arbeitet, unangekündigt ein von A beauftragter Kontrol- leur, um den Telearbeitsplatz, insbesondere seine Lage innerhalb der Wohnung und die Sicherungsmaßnahmen, zu inspizieren. C verweigert ihm den Eintritt. Er beruft sich darauf, daß in seinem im Hinblick auf den Telearbeitsplatz angepaßten Arbeits- vertrag von einer Inspektion keine Rede sei. Nach dem Vertrag ist nur die Erstinstalla- tion und nach Vorankündigung eine jährliche technische Wartung durch einen von A zu bestimmenden Spezialisten vorzunehmen. Einen konkreten Anlaß für die Inspektion gebe es darüber hinaus nicht. Im Gegenteil habe ihm A erst kürzlich versichert, daß er mit C's Arbeitsleistung sehr zufrieden sei.
A kündigt an, daß er sich, sollte C bei seiner Weigerung bleiben, gezwungen sehe, den Telearbeitsplatz des C aufzulösen und C wieder ausschließlich auf seinem alten Arbeitsplatz im Betrieb zu beschäftigen. Damit ist C nicht einverstanden.
3. Der ebenfalls in der Entwicklungsabteilung tätige Softwarespezialist S würde wegen seiner drei Kinder auch gern mehr zu Hause arbeiten, kann mit seinem Wunsch, trotz seiner unbestrittenen fachlichen Eignung, bei A aber nicht durchdringen, da A nicht noch mehr Telearbeitsplätze einrichten will. S ist allerdings der Meinung, daß A jedenfalls ihn bei der Vergabe der eingerichteten Telearbeitsplätze habe be- rücksichtigen müssen, da für ihn aufgrund seiner familiären Situation ein Telearbeits- platz viel wichtiger sei als für die fünf Telearbeitnehmer ohne Kinder oder sonstige familiäre Verpflichtungen.
1. Wer haftet in welcher Höhe für den von Tamara angerichteten Schaden?
2. Darf A den C in den Betrieb zurückversetzen?
3. Hat S Anspruch auf einen Telearbeitsplatz?
Literaturverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Teil Schadensersatzansprüche des A
A. Möglicher Anspruch des A gegen Tamara
Mangels eines Schuldverhältnisses zwischen dem Automobilhersteller A und Tamara kommen keine vertraglichen oder vertragsähnlichen Ersatzansprüche in Betracht.
I. Anspruch aus § 823 I BGB
Anspruchsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch des A gegen Tamara könnte § 823 I BGB sein.
1. Rechtsgutverletzung
Zunächst müßte ein durch § 823 I BGB geschütztes Rechtsgut des A verletzt worden sein.
Als solches kommt das Eigentum des A in Betracht.
Eine Verletzung des Eigentums liegt vor, wenn eine Beeinträchtigung der in § 903 BGB genannten Befugnisse besteht.1 So ist eine Beeinträchtigung gegeben, wenn einer einem anderen gehörende Sachen beschädigt oder zerstört.2
Dabei sind unter Sachen gemäß § 90 BGB alle körperlichen Gegenstände zu verstehen.
Unproblematisch ist dieses Erfordernis in Fällen von Hardwarezer- störung.3
Vorliegend wurde dem A nicht die Computeranlage zerstört, sondern nur die auf der Festplatte befindlichen Dateien einer aufwendigen Versuchsreihe.
Dateien sind keine körperlichen Gegenstände.
Demnach wäre eine Eigentumsverletzung ausgeschlossen.
Allerdings könnte eine Eigentumsverletzung auch dann vorliegen, selbst wenn nicht in die Substanz der Sache eingegriffen wurde. Dann müßte den gespeicherten Programmen eine Sacheigenschaft zukommen.
Einer Ansicht in der Literatur folgend, werden Computerprogramme nicht als Sache angesehen. Diese argumentiert, daß nur die Diskette oder Festplatte materiell sei, nicht jedoch das Programm. Wird ein Programm zerstört, so wird lediglich die Information, die das jeweilige Medium trägt, gelöscht. Ein Computerprogramm stellt somit nur ein geistiges, immaterielles Werk dar.4
Die h.L. und die Rechtsprechung erkennen Computerprogramme je- doch als ein auf einem Datenträger verkörpertes Programm an und stellen fest, daß es sich damit um eine körperliche Sache handelt.5 Demzufolge führt zwar der Verlust von Daten nicht zum Substanzver- lust der Sache, jedoch wird der bestimmungsgemäße Gebrauch der
Sache beeinträchtigt6, was letztendlich zu einer Eigentumsverletzung führt.
Folglich liegt eine Eigentumsverletzung vor.
2. Kausalität zwischen Handlung und Verletzung
Zwischen der Rechtsgutverletzung und der Verletzungshandlung muß ein kausaler Zusammenhang bestehen. Dies ist der Fall, wenn das Verhalten der Tamara nicht hinwegzudenken ist, ohne daß der konkrete Erfolg entfiele.7
Hätte Tamara nicht mit dem Computer von ihrer Mutter gespielt, wäre es nicht zu dem Datenverlust gekommen.
Mithin ist die Handlung kausal für die Verletzung.
3. Rechtswidrigkeit
Weiterhin müßte Tamara rechtswidrig gehandelt haben. Die Verletzung eines Rechtsguts ist stets rechtswidrig, sofern nicht Rechtfertigungsgründe eingreifen.8
Vorliegend sind keine Rechtfertigungsgründe erkennbar. Demnach hat Tamara widerrechtlich gehandelt.
4. Verschuldensfähigkeit und Verschulden
Weiterhin müßte der Anspruchsgegner die Rechtsgutverletzung zu vertreten haben.
a. Verschuldensfähigkeit
Verschulden setzt die Verschuldensfähigkeit des Handelnden voraus.9
Vorliegend könnte Tamara verschuldensunfähig sein. Dann müßten die Voraussetzungen des § 828 II BGB erfüllt sein.
Nach § 828 II BGB gelten Minderjährige, die das siebente, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, als nicht verant- wortlich und somit als verschuldensunfähig, wenn bei Begehung der Handlung die zur Erkenntnis der Verantwortung erforderliche Ein- sicht fehlt.
Tamara ist erst 13 Jahre alt und demnach minderjährig.
Es ist nun fraglich, ob sie mit der erforderlichen Einsicht gehandelt hat.
Diese Einsicht besitzt, wer diejenige geistige Entwicklung erreicht hat, die ihn befähigt, das Unrechtmäßige seiner Handlung und zugleich die Verpflichtung zu erkennen, in irgendeiner Weise für die Folgen seines Tuns einstehen zu müssen.10
Dabei genügt die Erkenntnis einer allgemeinen Gefahr und eines allgemeinen Schadens bzw. das allgemeine Verständnis dafür, daß das Verhalten in irgendeiner Weise Verantwortung begründen kann.11
Vorliegend hat Tamara durch Erfahrungen am eigenen PC schon eine Vorstellung von den Abläufen. Sie müßte folglich die Gefahr erkannt haben, daß sie mit einer falschen Bedienung einen Schaden verursachen könnte.
Allerdings könnte man die Auffassung vertreten, daß sie den Computer nur zum Spielen benutzt und sie sich nicht vorstellen konnte, daß durch ihre Handlung ein erheblicher Schaden entstehen kann. Insbesondere dürfte das Auswertungsprogramm „CRASH“ sie an ein Spiel erinnert haben.
Somit hätte Tamara nicht das Verständnis gehabt, daß ihr Verhalten in irgendeiner Weise Verantwortung begründet und damit würde ihr auch die erforderliche Einsicht fehlen.
Jedoch wurde Tamara von ihrer Mutter I strikt untersagt, den Telearbeitsplatz zu betätigen.
Demnach hätte Tamara wissen müssen, daß ihr Verhalten möglicherweise einen Schaden verursachen könnte und sie dann zur Verantwortung gezogen wird.
Sie ist auch alt genug, dieses Verbot zu verstehen und entsprechend zu befolgen.
Folglich besitzt Tamara die erforderliche Einsicht und ist demnach verschuldensfähig.
b. Verschulden
Der Anspruchsgegner hat die Verletzung gemäß § 276 I BGB zu vertreten, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Vorsätzlich handelt, wer im Bewußtsein des Handlungserfolgs und in Kenntnis der Rechtswidrigkeit des Verhaltens den Erfolg in seinen Willen aufgenommen hat.12
Hier hat Tamara nicht mit Absicht die Dateien gelöscht. Demnach hat sie nicht vorsätzlich gehandelt.
Allerdings könnte sie fahrlässig i.S.d. § 276 I 2 BGB gehandelt ha- ben.
Infolgedessen handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt.
Vorliegend hat Tamara die umfangreichen Dateien durch Verschie- ben auf ein zu kleines Speichermedium aus Versehen gelöscht. Sie ist zwar mit der Bedienung eines Computers vertraut, jedoch ist ihr durch die ungewöhnliche Belegung der Funktionstasten ein Bedie- nungsfehler unterlaufen, der letztendlich zum Datenverlust geführt hat. Hätte sie die Tastenbelegung sorgfältig beachtet, wäre es nicht zum Datenverlust gekommen.
Folglich hat Tamara fahrlässig gehandelt und demnach die Eigentumsverletzung zu vertreten.
5. Schaden
Weiterhin müßte durch die Rechtsgutverletzung ein Schaden entstanden sein. Durch den Verlust der gelöschten Dateien müssen aufwendige Versuche wiederholt werden, wodurch A Kosten in Höhe von 200.000,--DM entstehen. A hat also durch die Rechtsgutverletzung einen Schaden in dieser Höhe erlitten.
6. Zwischenergebnis:
Thaftet dem A gegenüber aus § 823 I BGB auf Schadensersatz.
II. Anspruch aus § 823 II BGB i.V.m § 303a StGB
A könnte weiterhin einen Schadensersatzanspruch aus § 823 II BGB i.V.m. § 303a StGB haben.
Allerdings ist Sachbeschädigung nach § 303a StGB nur bei Vorsatz strafbar, so daß bei bloß fahrlässiger Sachbeschädigung § 303a StGB nicht erfüllt ist.13
Vorliegend hat Tamara die Dateien fahrlässig gelöscht. Demnach scheidet ein Schadensersatzanspruch nach § 823 II BGB i.V.m. § 303a StGB aus.
B. Möglicher Anspruch des A gegen I
I. Anspruch aus positiver Vertragsverletzung
A könnte gegen I einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung seines Eigentums aus positiver Vertragsverletzung des Arbeitsvertrages haben.
1. Anwendbarkeit der pVV
Die pVV wurde in einer Analogie zu den §§ 280,285,325,326 BGB entwickelt und ist inzwischen Gewohnheitsrecht geworden.14 Vorliegend kommen weder die Vorschriften über die Unmöglichkeit noch Verzug in Betracht.
Somit wird hier das subsidiäre Rechtsinstitut der pVV nicht durch die gesetzlichen Vorschriften verdrängt. Mithin ist die pVV anwend- bar.
2. Bestehen eines gegenseitigen Vertrages
Es müßte ein gegenseitiger Vertrag zwischen A und I bestehen.
A und I stehen in einem Arbeitsverhältnis in Form eines Dienstvertrages gemäß § 611 BGB, welches die I zur Arbeitsleistung und den A zur Lohnzahlung verpflichtet.
Ein gegenseitiger Vertrag liegt somit vor.
3. Pflichtverletzung
Weiterhin müßten die Voraussetzungen einer Pflichtverletzung erfüllt sein. Aus § 242 BGB ergibt sich das Grundprinzip, den Vertragspartner nicht zu schädigen.15
Aus diesem gehen zahlreiche Nebenpflichten hervor. Dazu gehören u.a. Unterlassungs-, Fürsorge- und Schutzpflichten.16 Vorliegend könnte die I ihre Unterlassungspflicht gegenüber dem A verletzt haben.
Indem es die I während des Telephongesprächs mit dem A unterlas- sen hat, den Telearbeitsplatz vor dem Zugriff eines anderen zu schützen, könnte sie ihre Unterlassungspflicht verletzt haben. Eine Unterlassungspflicht des Arbeitnehmers ist es, schädigende Handlungen gegenüber dem Arbeitgeber zu unterlassen. Vorliegend war während des Telephongesprächs, bei dem I den Raum verlassen hat, der Computer ungesichert und die Online- Verbindung zum Zentralrechner hergestellt. Die T nutzt die Gelegen- heit aus und löscht, aus Versehen, die umfangreichen Dateien einer aufwendigen Versuchsreihe.
Die I hat es folglich unterlassen, ihren Telearbeitsplatz vor dem Zugriff anderer zu schützen bzw. sie hat es unterlassen, die Online-Verbindung zum Zentralrechner zu unterbrechen. Dadurch hat sie es begünstigt, daß bei ihrem Arbeitgeber ein Scha- den entsteht.
Somit hat I ihre Unterlassungspflicht verletzt.
4. Kausalität von Pflichtverletzung und Handlung
Die Pflichtverletzung und die Handlung der T müßten kausal gewesen sein. Eine Kausalität zwischen der Unterlassungspflicht und der Handlung der T liegt vor, da ohne die Pflichtverletzung der Erfolg nicht eingetreten wäre.
5. Rechtswidrigkeit
Die Pflichtverletzung müßte rechtswidrig gewesen sein. Regelmäßig ist jede Verletzung einer vertraglichen Pflicht rechtswidrig, soweit kein Rechtfertigungsgrund vorliegt.17
Ein Rechtfertigungsgrund ist hier nicht ersichtlich. Demnach ist die Rechtswidrigkeit gegeben.
6. Verschulden
Eine Haftung aus pVV setzt schließlich voraus, daß der Schuldner die Pflicht schuldhaft verletzt hat, wobei das Verschulden sich nur auf die Pflichtverletzung, nicht auf den daraus entstandenen Schaden beziehen muß.18
Nach § 276 I BGB hat der Arbeitnehmer Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Hier hat die I nicht vorsätzlich gehandelt. Jedoch könnte sie fahrlässig i.S.d. § 276 I 2 BGB gehandelt haben. Demnach handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorg- falt außer acht läßt. Deren Maß richtet sich danach, welche Sorgfalt gerade für die Tätigkeit, die der Arbeitnehmer auszuüben hat, für er- forderlich gehalten wird.19
Die I hat während des Telephongesprächs mit A die Online- Verbindung mit dem Zentralrechner aufrechterhalten und so den Ar- beitsplatz unbeaufsichtigt und ungesichert verlassen. Es wäre aber zumindest erforderlich gewesen, daß I die Online- Verbindung zum Zentralrechner unterbricht, um einen Zugriff anderer darauf zu verhindern.
Somit hat I fahrlässig gehandelt und demnach die pVV zu vertreten.
7. Einschränkung der Haftung
Die Haftung der von I zu vertretenen pVV könnte eingeschränkt sein.
a. Grund für eine Haftungsbeschränkung
Im Arbeitsleben besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, daß bei geringem Versehen ein unverhältnismäßig großer Schaden entsteht. Die uneingeschränkte Anwendung des Verschuldens-maßstabes des § 276 BGB im Verhältnis der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber wäre angesichts der Fürsorgepflicht und einer angemessenen Risi- koverteilung unbillig.20Darüber hinaus ist die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers schnell erreicht.
Daher hat die Rechtsprechung zunächst die Grundsätze der Haftungsminderung bei gefahrgeneigter Arbeit entwickelt und dann auf alle betrieblich veranlaßten Tätigkeiten ausgedehnt.21
b. Voraussetzung für eine Haftungsbeschränkung
Voraussetzung für eine Haftungsbeschränkung ist, daß die Arbeit aufgrund eines Arbeitsverhältnisses geleistet wurde und durch den Betrieb veranlaßt war.22
aa. Arbeitsverhältnis
Ob ein Arbeitnehmerverhältnis vorliegt, zeigt sich an der Ausgestal- tung des Arbeitsverhältnisses. Danach ist Arbeitnehmer, wer auf- grund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines anderen zur Leistung fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.23
Vorliegend hat die I ihren Arbeitsvertrag dahingehend angepaßt, daß ihr Arbeitsplatz teilweise in die eigene Wohnung verlagert wur- de. Man spricht dann von einem alternierenden Arbeitsplatz, d.h. der Mitarbeiter arbeitet teilweise im Betrieb und teilweise in der eigenen Wohnung.24
Folglich bleibt die I weiterhin gegenüber dem A weisungsgebunden und wirtschaftlich abhängig.
Somit ist I Arbeitnehmer. Ein Arbeitsverhältnis liegt demnach vor.
bb. Betrieblich veranlaßte Tätigkeit
Weiterhin müßte es sich um eine betrieblich veranlaßte Tätigkeit handeln.
Durch den Betrieb veranlaßt sind alle Arbeiten, die der Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsvertrages schuldet oder die ihm der Arbeitgeber zugewiesen hat.25
Hier wurde die I von dem A zu Hause angerufen, um ihn bei der In- stallation einer neuen Software zu helfen. Sie unterbrach daraufhin ihre Arbeit am Telearbeitsplatz, um im Nebenraum Unterlagen ein- zusehen. Folglich war ihre Tätigkeit im Rahmen ihres Arbeitsvertra- ges und mit den Anweisungen des Arbeitgebers verbunden. Demnach handelt es sich um eine betrieblich veranlaßte Tätigkeit.
c. Umfang der Haftungsbeschränkung
Die neueste Rechtsprechung hat nur die Voraussetzung, nicht aber den Umfang der Haftungsbeschränkung geändert. Dieser richtet sich weiterhin nach dem Abwägungsergebnis, zu dem man gelangt, wenn man in entsprechender Anwendung des § 254 BGB dem Verschul- den des Arbeitnehmers die auf Billigkeitserwägungen beruhende Risikozurechnung an den Arbeitgeber gegenüberstellt.26
Demzufolge orientiert sich die Haftung des Arbeitnehmers am Grad des Verschuldens.27
Für grobe Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer in vollem Umfang. Für eine grobe Fahrlässigkeit würde sprechen, wenn der Telear- beitsplatz leicht für fremde Personen zu erreichen wäre. Dann hätte die I den Computer nicht ungesichert verlassen dürfen. Allerdings ist der Arbeitsplatz in der Wohnung vor fremden Zugriff geschützt. Folg- lich hat die I nicht grob fahrlässig gehandelt. Die I könnte jedoch mit mittlerer Fahrlässigkeit gehandelt haben. Dann käme es zu einer Aufteilung des Schadens. Dafür würde sprechen, wie die allgemeine Lebenserfahrung zeigt, daß sich Kinder oft über Verbote hinwegset- zen, auch wenn diese ihnen ausdrücklich erklärt werden. Hier lebt die I mit zwei Kindern in der 3-Zimmerwohnung. Infolgedessen hätte sie als erfahrene Mutter zumindest damit rechnen müssen, daß ei- nes ihrer Kinder mit dem betriebsbereiten Computer spielen könnte. Demnach hätte sie beim Verlassen des Computers die Online- Verbindung trennen müssen. Da sie diese Schutzvorkehrung unter- lassen hat, haftet sie für mittlere Fahrlässigkeit.
Folglich wäre der Schaden zwischen ihr und dem Arbeitgeber gemäß ihrer Leistungsfähigkeit aufzuteilen.
8. Mitverschulden
Darüber hinaus könnte ein Mitverschulden des A vorliegen.
Ein Mitverschulden des Arbeitgebers könnte sich aus der unterlassenen Schadensabwendung bzw. Schadensminderung gemäß § 254 II BGB ergeben.28
Dann müßte der A es unterlassen haben, den entstandenen Scha- den durch geeignete Maßnahmen zu verhindern bzw. den enstande- nen Schaden in einem deutlich geringeren Ausmaß entstehen zu lassen.
Ein relevantes Mitverschulden gem. § 254 II BGB könnte etwa dann gegeben sein, wenn die Datensicherung vom Arbeitgeber vernach- lässigt wurde. So sind Sicherheitskopien bei dem Umgang mit sen- siblen Daten erforderlich, um einem Verlust vorzubeugen.29Weiterhin kann die Eingabe von Paßwörtern in kurzen Intervallen erforderlich sein, um bei einer Online-Verbindung den Zugriff von Nichtberechtig- ten zu unterbinden.30
Im vorliegenden Fall wurden weder Sicherheitskopien angefertigt noch Vorsichtsmaßnahmen zur Datensicherheit getroffen, obwohl die Daten einen erheblichen Wert darstellten.
Für den entgültigen Verlust der Daten ist somit der A mitverantwort- lich.
Weiterhin ist dem Arbeitgeber ein Mitverschulden zuzurechnen, wenn er versicherbare Risiken nicht versichert hat.31 Hätte der A sich versichert, würde ein Versicherer für den Schaden aufkommen.
Demnach trägt der A ein erhebliches Mitverschulden.
9. Ergebnis
Eine positive Vertragsverletzung liegt zwar vor, jedoch führt die oben bejahte Haftungserleichtung dazu, daß die I dem A nicht verpflichtet ist, Schadensersatz aus pVV zu leisten.
II. Anspruch aus § 832 I BGB
Des weiteren könnte A einen Anspruch aus § 832 I BGB geltend machen. Dann müßte die I ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.
a. Rechtsgutverletzung durch Minderjährigen
Voraussetzung für das Entstehen des Anspruchs ist, daß A durch einen Minderjährigen geschädigt worden ist, über den die I eine Aufsichtspflicht hatte. Wie oben festgestellt, wurde A durch die Handlung von T in seinem Eigentum geschädigt.
Tist, wie vorstehend erläutert, auch minderjährig.
b. Aufsichtspflicht
Weiterhin ist fraglich, ob I die aufsichtspflichtige Person ist.
Dazu müßte I gesetzlich oder vertraglich verpflichtet sein.
Die Eltern besitzen nach § 1626 BGB die Aufsichtspflicht über ihre Kinder. Minderjährige sind stets aufsichtspflichtig.32
I hat somit als die Mutter die gesetzliche Aufsichtspflicht über T.
c. Entlastungsbeweis
Möglicherweise kann I beweisen, daß sie ihrer Aufsichtspflicht nach- gekommen ist. Dann müßte nach § 832 I 2 BGB der Entlastungsbe- weis erbracht sein, daß die Aufsichtspflicht erfüllt wurde. Der Entlas- tungsbeweis ist erbracht, wenn die Mutter alles erforderliche und zumutbare getroffen hat, um Schädigungen durch ihr Kind zu verhin- dern und wenn das schädigende Verhalten nicht voraussehbar war.33
Vorliegend hat I der T strikt untersagt, den Computer am Telearbeitsplatz zu betätigen. Von einem 13-jährigen Kind kann erwarten werden, daß es dieses Verbot auch befolgt.
Somit hat I auch das in dieser konkreten Situation Erforderliche ge- tan. Weiterhin konnte die I das schädigende Verhalten der T nicht voraussehen, da die T auch schon seit Jahren Erfahrungen am eige- nen PC besitz.
Folglich hat die T ihre Ausichtspflicht nach § 832 I BGB nicht verletzt. Somit entfällt eine Haftung nach § 832 I BGB.
III. Anspruch aus § 823 I BGB
Der A könnte weiterhin einen Schadensersatzanspruch aus § 823 I BGB geltend machen.
Allerdings wird die Ansicht vertreten, daß kein weitergehender An- spruch aus unerlaubter Handlung gem. § 823 I BGB besteht, wenn ein vertraglicher Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer eingeschränkt oder ganz ausgeschlossen ist.34 Es soll dann der Grundsatz gelten, daß eine strengere Haftung aus unerlaubter Handlung nicht eingreift, wenn eine vertragliche Haftung beschränkt ist.35
Andernfalls würde die Haftungsmilderung vereitelt werden.
Vorliegend wurde die Haftung der I aus positiver Vertragsverletzung aus den oben genannten Gründen ausgeschlossen.
Folglich besteht dem A kein Anspruch aus § 823 I BGB.
IV. Haftungserleichterung mit Wirkung zugunsten Dritter
Vorliegend könnte die Einbeziehung von Dritten in die Haftungserleichterung des Arbeitnehmers angebracht sein.
Beim Zusammentreffen von Arbeitnehmerhaftung und Haftung Dritter tritt ein grundlegendes Problem auf: Nach den Regeln der §§ 426, 840 BGB kann es zu einer gesamtschuldnerischen Haftung von Ar- beitnehmern und Dritten kommen, die zu einer Ausgleichspflicht führt, die über die ansonsten geltenden Regelungen zur Haftungsre- duzierung hinausgeht.36
Es ist folglich zu prüfen, ob die Handlung der T eine Haftungserleichterung mit Wirkung zugunsten Dritter begründet.
Voraussetzung für die Annahme einer Einbeziehung von Dritten in den Schutzbereich des Vertrages zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist die Leistungsnähe des Dritten, die Erkennbarkeit für den Arbeitgeber bei Vertragsschluß und das berechtigte Interesse des Gläubigers am Schutz des Dritten.37
1. Leistungsnähe des Dritten.
Fraglich ist, für welche Person die Leistungsnähe bejaht werden kann. Es wird die Ansicht vertreten, daß die Bewohner und Familienangehörigen in die Leistungsnähe miteinzubeziehen sind.38Der Telearbeitsplatz der I ist in ihrer 3-Zimmer Wohnung eingerichtet. Folglich sind die Kinder in der Leistungsnähe der I.
2. Erkennbarkeit für den Arbeitgeber
Die Erkennbarkeit für den Arbeitgeber erfolgt aus der für die Telear- beit eigentümlichen Verknüpfung von Arbeitsplatz und Privatsphäre. Es existiert die Auffassung, daß sich bereits aus der Synthese von Arbeitsplatz und Privatsphäre eine erhöhte Schadenswahrschein- lichkeit ergibt. Dies wird durch die häusliche Umgebung und den damit verbundenen Streß- und Ablenkungsfaktoren begründet.39
Gerade im Bereich der häuslichen Atmosphäre sind Schäden durch Familienangehörige sicherlich nicht sehr fernliegend.40 Der A wußte bei Vertragsschluß, daß der Telearbeitsplatz im Wohn- zimmer der I eingerichtet wird und er wußte auch, daß I mit ihren bei- den Kindern dort wohnt.
Somit war es für den A auch erkennbar, daß Dritte in die Haftungserleichtung der I miteinzubeziehen sind.
3. Interesse an der Einbeziehung Dritter
Es ist davon auszugehen, daß die I grundsätzlich ein Interesse daran hat, daß ihre Tochter T in den Schutzbereich des Arbeitsvertrages gelangt.
Es würde letztlich zu Unfrieden innerhalb der Familie führen, wenn Schadensersatzansprüche der Familienmitglieder untereinander entstehen würden.
Des weiteren würde das Privatleben des Telearbeiters in unzumutbarer Weise durch arbeitsrechtliche Sorgfaltspflichten und ständige Rücksichtnahmen auf die Arbeitswelt überlagert.41
Demzufolge ist die T mit in die Haftungserleichterung der I einbezo- gen.
C. Ergebnis
Die von T erfüllte Eigentumsverletzung nach § 823 I BGB wird somit nach dem Grundsatz Haftungserleichterung mit Wirkung zugunsten Dritter ausgeschlossen.
2. Teil Darf A den C in den Betrieb zurückversetzen
I. Möglicher Anspruch durch Direktionsrecht
Der A könnte im Rahmen seines Direktionsrechts einen Anspruch haben, dem C neue Arbeitsbedingungen zuzuweisen. Dann müßte der C weisungsgebunden sein.
1. Weisungsgebundenheit
Aus dem Wesen des Arbeitsvertrags i.S.v. § 611 BGB ergibt sich das Direktionsrecht des Arbeitgebers.42
Mit der Ausübung des Direktionsrechts konkretisiert der Arbeitgeber, die durch den Arbeitsvertrag nur rahmenmäßig festgelegte Arbeitspflicht des Arbeitnehmers.43
Demnach wäre der C als Arbeitnehmer dem A gegenüber weisungsgebunden und hat dem Arbeitgeber Folge zu leisten.
2. Grenzen des Direktionrechts
Allerdings könnte das Direktionsrecht durch den Arbeitsvertrag oder durch § 315 III BGB eingeschränkt sein.
Danach darf das Direktionsrecht nur im Rahmen billigen Ermessens ausgeübt werden.
Gewahrt ist der Grundsatz der Billigkeit nur dann, wenn alle wesentliche Umstände des Einzelfalls abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt werden.44
Daraus ergibt sich, daß der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einseitig nur solche Tätigkeiten übertragen darf, die nach ihrer Art, Arbeitsort und Arbeitszeit den nach dem Arbeitsvertrag geschilderten Diensten entsprechen.
Vorliegend wurde der Arbeitsvertrag des C dahingehend angepaßt, daß er ein Teil seiner Arbeit zu Hause von einem Telearbeitsplatz verrichtet.
Die Zuweisung, daß der C wieder ausschließlich auf seinem alten Arbeitsplatz arbeiten solle, würde somit nicht seinem Arbeitsvertrag entsprechen und läge auch nicht im Interesse des C. Eine ausdrückliche arbeitsvertagliche Vereinbarung, die eine Ver- setzung rechtfertigen würde, liegt laut Sachverhalt nicht vor.
Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine konkludente Verein- barung.
Eine Versetzung zu einem anderen Arbeitsort würde also dem Arbeitsvertrag des C widersprechen.
Der A hätte somit kein Anspruch aus seinem Direktionsrecht.
II. Möglicher Anspruch durch Änderungskündigung
Der A könnte durch eine Änderungskündigung einen Anspruch haben, den C zurückzuversetzen.
Dann müßte die Zuweisung der neuen Tätigkeit nicht vom Arbeitsver- trag gedeckt sein und der Arbeitnehmer damit nicht einverstanden sein.
Nach § 2 KSchG ist die Änderungskündigung eine unbedingte Kündigung des alten Arbeitsvertrages kombiniert mit dem Angebot des Arbeitgebers zur Fortsetzung des Arbeitverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedingungen.45
1. Wirksamkeit der Änderungskündigung durch Annahme
Die Änderungskündigung würde durch die Annahme eines Ände- rungsvertrags gemäß §§ 241, 305 BGB wirksam werden.46Vorlie- gend wäre der C nicht mit der Änderung seines Arbeitsvertrages ein- verstanden gewesen und hätte das Angebot des A abgelehnt. Folglich würde kein neues Arbeitsverhältnis begründet werden.
2. Beendigungskündigung
Durch die vorbehaltslose Ablehnug der Änderungskündigung wäre der Arbeitgeber gezwungen, eine Beendigungskündigung auszu- sprechen.47
Eine Beendigungskündigung hätte Aussicht auf Erfolg, wenn die Voraussetzungen einer wirksamen Kündigung vorliegen würden.
a. Kündigungserklärung
Dann müßte der A dem C die Kündigung erklären. Kündigung ist die empfangsbedürftige Willenserkärung eines Vertragspartners, durch die der einseitige Wille zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Ausdruck gebracht wird.48
Gemäß § 130 BGB müßte die Kündigung dem C auch zugehen. Es ist fraglich, ob der A dem C die Kündigung ausdrücklich erklärt hätte. Vorliegend erklärte der A dem C, daß er den Telearbeitsplatz auflö- sen werde und ihn ausschließlich auf seinem alten Arbeitsplatz wei- terbeschäftigen würde, wenn dieser ihm nicht den Zutritt zur Wohnung für die Kontrolle des Telearbeitsplatzes verschaffe. Der C war damit nicht einverstanden. Er müßte folglich die Erklärung des A und seine anschließende Reaktion als eine konkludente Kündigungserklärung für seinen Telearbeitsplatz auffassen. Es wird allgemein angenom- men, daß mündlich ausgesprochene Kündigungen grundsätzlich dann zugehen, wenn sie der Arbeitnehmer wahrnimmt.49Hier ist die Erklärung mündlich erfolgt. Somit würde die Kündigung gegenüber dem C konkludent ausgesprochen werden.
b. Kündigungsgrund
Die Kündigung wäre bei einer ordentlichen Kündigung ohne die An- gabe von Gründen wirksam. Allerdings müßte der A auf Verlangen den Kündigungsgrund mitteilen, soweit die Kündigung eines Grundes bedarf.50
c. Kündigungsausschließungsgrund
Die Kündigung wäre wirksam, wenn keine ausschließende Gründe vorliegen würden.
Nach § 102 I 1 BetrVG müßte der Betriebsrat vor einer Kündigung durch den Arbeitgeber angehört werden. Eine Kündigung wäre sonst nach § 102 I S. 3 BetrVG unwirksam.
Dies würde voraussetzen, daß ein Betriebsrat besteht. Vorliegend handelt es sich um einen Automobilhersteller, dessen Entwicklungsabteilung alleine schon 50 Arbeitsplätze umfaßt. Der Betrieb wäre also nach § 1 BetrVG betriebsratfähig. Jedoch ist dem Sachverhalt nicht zu entnehmen, daß ein Betriebsrat besteht. Folglich müßte der A auch keinen Betriebsrat anhören.
d. Kündigungschutz nach dem KSchG
Weiterhin müßte das KSchG anwendbar sein. Gemäß § 23 I 2 KSchG gilt der allgemeine Kündigungsschutz nur für Betriebe mit mehr als zehn Arbeitnehmern. Vorliegend sind mehr als zehn Arbeit- nehmer bei dem A beschäftigt. Demnach wäre die erforderliche Be- triebsgröße erfüllt.
Darüber hinaus müßte der C gemäß § 1 I KSchG länger als 6 Monate im selben Betrieb ohne Unterbrechung beschäftigt sein. Aus dem Sachverhalt läßt sich zwar nicht entnehmen, wie lange der C schon bei dem A beschäftigt ist. Allerdings sollte man davon ausgehen, daß die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes ein gewisses Vertrauens- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer voraussetzt. Dies läßt darauf schließen, daß die Betriebszugehörigkeit schon länger als 6 Monate besteht.
Des weiteren wäre das KSchG nicht anwendbar, wenn der C gemäß § 2 I HAG als Teleheimarbeiter gelten würde. Heimarbeiter i.S.v. § 2 I HAG unterscheiden sich von Arbeitnehmern durch ihre persönliche Selbständigkeit51. Wie oben bereits erwähnt handelt es sich bei dem C um einen Arbeitnehmer.
Folglich wäre das KSchG anwendbar.
e. Voraussetzungen des § 1 KSchG
Die Kündigung des A wäre gemäß § 1 I KSchG unwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt wäre.
Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung nach § 1 II 1 KSchG immer dann, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt wäre.
Im vorliegenden Fall könnte eine verhaltensbedingte Kündigung vor- liegen.
Eine verhaltensbedingte Kündigung ist sozial gerechtfertigt, wenn sich der Kündigungsgrund aus dem Verhalten des Arbeitnehmers ergibt. Verhalten kann jedes rechtmäßige oder unrechtmäßige, vom
Willen des Arbeitnehmers gesteuerte Handeln sein.52In erster Linie sind darunter Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers zu verstehen. Vorliegend könnte der C durch die Weigerung, einen Kontrolleur des A in seine Wohnung zu lassen, eine vertragliche Nebenpflicht verletzt haben.
e. Zutrittsrecht zum Telearbeitsplatz
Eine solche vertragliche Nebenpflicht könnte das Zutrittsrecht des Arbeitgebers zu dem Telearbeitsplatz sein.
Allerdings war entsprechend des Arbeitsvertrages vereinbart, daß nur eine Inspektion bei der Erstinstallation und einmal jährlich, nach Vorankündigung, eine technische Wartung vorzunehmen ist. Folglich war die unangekündigte Kontrolle nicht durch den Arbeitsvertrag gedeckt. Es läge demnach keine Pflichtverletzung von vertraglichen Nebenpflichten vor.
Die Kündigung wäre somit sozial ungerechtfertigt.
Allerdings könnte sich für den Arbeitgeber ein Zugangsrecht konkludent aus dem Arbeitsvertrag ergeben.53Dies müßte mit Art. 13 GG vereinbar sein.
Es wird überwiegend die Auffassung vertreten, daß ein generelles Zutrittsrecht nicht mit Art. 13 GG vereinbar wäre.54Art. 13 GG garan- tiert die Unverletzlichkeit der Wohnung. Beim Betreten der Wohnung ohne Einwilligung wäre der Schutzbereich des Art. 13 GG betroffen. Allerdings ist hierbei zwischen Zutrittsrechten für Behörden und Zu- trittsrechten Privater zu unterscheiden.55Art. 13 GG bietet nur einen Schutz vor dem Zugang staatlicher Kontrollorgane.56Eine unmittel- bare Drittwirkung von Grundrechten wird somit ausgeschlossen. Je- doch wird eine mittelbare Drittwirkung inzwischen von der Literatur und Rechtsprechung anerkannt.57Dies führt dazu, daß die Unverletz- lichkeit der häuslichen Wohnung ein hohes Maß an Schutzwürdigkeit zuerkannt wird. Es ist folglich zu prüfen, ob die Art der Nutzung der
Wohnung eher einem betrieblichen Charakter entspricht oder ob der wohnliche Aspekt überwiegt.
Streitig ist, ob der Arbeitnehmer durch Einrichtung des Telearbeits- platzes seine Wohnung weitgehend aus der Privatsphäre herausge- nommen hat.58Das wäre der Fall, wenn die Wohnung überwiegend zum Arbeiten genutzt werden würde. Im vorliegenden Fall wird e- doch deutlich, daß der C neben den betrieblichen Aufgaben die Wohnung überwiegend zu privaten Zwecken nutzt. Daraus ergibt sich, daß der Schutz der Intimsphäre höher zu bewerten ist, als die Kontrollmöglichkeit des Arbeitgebers über den Telearbeitsplatz. Vorliegend ist der Kontrolleur unangekündigt an einem Freitag A- bend um 19.00 Uhr erschienen. Dies ist bereits deutlich außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeit. Es wurde dadurch erheblich in die Pri- vatsphäre des C eingegriffen. Ein mögliches konkludentes Zutritts- recht ist folglich auszuschließen.
3. Ergebnis
Die Kündigung des A wäre infolge dessen sozial ungerechtfertigt und damit unwirksam. Der A darf den Telearbeitsplatz des C nicht wegen der Weigerung des Zutritts auflösen.
3. Teil Hat S einen Anspruch auf einen Telearbeitsplatz
I. Anspruch aus Gesetz
Gesetzliche Vorschriften, die den Arbeitgeber zur Gleichbehandlung verpflichten, sind vorliegend nicht ersichtlich.
II. Anspruch aus Vertrag
1. Gleichbehandlungsgrundsatz
Der S könnte gegen den A einen Anspruch auf Versetzung aus der Verletzung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz geltend machen.
Der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz ist subsidiär zu vertraglichen Regelungen.59
Die Vorschriften der §§ 75 I 1 BetrVG, § 67 I BPersVG bringen den Gleichbehandlungsgrundsatz zum Ausdruck, geben aber dem einzelnen Arbeinehmer keinen Anspruch.60
Der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz wurde demnach entwi- ckelt, um eine Gleichbehandlung unter den Arbeitnehmer zu gewähr- leisten. Er ist allerdings nicht als Gebot gleichmäßiger Behandlung, sondern als Verbot unsachlicher Differenzierung zu verstehen.61 Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist folglich verletzt, wenn einzelne Arbeitnehmer im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern, die sich gruppenmäßig in der vergleichbaren Lage befinden, willkürlich, d.h. sachfremd, von ihrem Arbeitgeber schlechter gestellt werden.62Dem soll allerdings nicht entgegenstehen, daß einzelne Arbeitnehmer be- günstigt werden.63
Folglich ist zu klären, ob der S von dem A unsachgemäß den anderen Arbeitnehmern gegenüber differenziert wurde.
Im vorliegenden Fall könnte der A durch die Auswahl von zehn Arbeitnehmern, die für die Telearbeit geeignet waren, eine unsachgemäße Differenzierung vorgenommen haben.
Der A hat durch seinen Abteilungsleiter feststellen lassen, daß nur zehn der insgesamt fünfzig Arbeitsplätze für eine Verlagerung in die Privatwohnung der jeweiligen Arbeitnehmern geeignet sind. Die betroffenen Arbeitnehmer haben dieses Angebot auch sofort angenommen. Der Arbeitgeber hat damit eine Gruppe innerhalb des Betriebes gebildet, nämlich eine Gruppe, deren Tätigkeit für einen Telearbeitsplatz geeignet waren und einer Gruppe die dafür nicht in Betracht kommt.
Fraglich ist deswegen, ob die Auswahl dieser zehn Arbeitsplätze sachlich gerechtfertigt war. Sachlich gerechtfertigt ist die Auswahl, wenn sie aus einleuchtenden Gründen erfolgt ist. Vorliegend könnte die Auswahl aus betrieblichen Gründen erfolgt sein. So möchte der Arbeitgeber die Aufwendungen bei einer Umstrukturierung möglichst gering halten. Eine Auswahl nach den geeigneten Stellen aus be- triebswirtschaftlichen Gründen erscheint somit als sinnvoll und sach- gerecht. Andernfalls hätte der Arbeitgeber mit erheblichen Kosten für eventuelle Umschulungen und Umstellungen innerhalb des Betriebs zu rechnen. Weiterhin könnte der Arbeitgeber bei der Auswahl der geeigneten Stellen auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zu den ausgewählten Personen abgestellt haben. So kommt es dem Ar- beitgeber neben der fachlichen Eignung bei einer Telearbeitsstelle auch auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zu dem Arbeitnehmer an, da sich dieser aus dem Kontrollbereich des Arbeitgebers ent- fernt.
Aus diesem Aspekt muß deshalb auch der Einwand des S, daß er die fachliche Eignung für einen Telearbeitsplatz besitzt, unberück- sichtigt bleiben. Eine Auswahl der Gruppe nach dem Kriterium eines besonderen Vertrauensverhältnisses wäre demnach auch sachge- recht. A hat folglich nach rein sachlichen nicht nach willkürlichen Ge- sichtspunkten gehandelt.
Insbesondere benachteiligte der A niemanden in der für die Telearbeit ausgewählten Gruppe. Es hat somit auch keine Ungleichbehandlung innerhalb dieser Gruppe stattgefunden.
III. Ergebnis
Der S hat keinen Anspruch auf Versetzung zu einem Telearbeits- platz.
[...]
1Jauernig-Teichmann, BGB Kommentar, § 823, II A 4
2Hein Kötz, Deliktsrecht, C 58
3Wolfgang Rombach, Killer-Viren als Kopierschutz, CR 1990,101,104
4vgl. Redeker NJW 1992, 1739; ebenso Junker NJW 1993, 824, 830
5BGH NJW-RR 1986,219; BGH NJW 1993,1871; M.König, Software als Sache, NJW 1993,3121,3122 J.P. Marly, Computerprogr. als Sache,BB,1991,432
6Palandt-Thomas, BGB Kommentar, § 823 Rdn 8
7Medicus, Schuldrecht AT, Rdn. 596
8vgl. Palandt-Thomas, BGB Kom, § 823 Rdn 33
9 so Jauernig-Teichmann, aaO, § 823 V 1
10so Kötz, Deliktsrecht, D Rdn. 317 vgl. Palandt-Thomas, § 828 Rdn 3
11 BGH NJW 1984, 1958
12 Deutsch, Unerlaubte Handlungen, § 10, Rdn 116
13Hans Brox, Besonderes Schuldrecht, § 38,Rdn. 466
14Medicus, Schuldrecht AT, Rdn. 422 BGH NJW 1990,507,508
15MünchKomm-Roth, § 242, Rdn. 5ff.
16Palandt-Heinrichs, BGB Kommentar, § 242 Rdn. 23
17 H. Brox, Allg. Schuldrecht, § 22 II, Rdn. 298
18H. Brox, aaO, § 22 II, Rdn. 299
19Brox/Rüthers, Arbeitsrecht, Rdn. 99
20vgl. Brox/Rüthers, aaO, Rdn. 100
21BAG NZA 1993, 547; BAG NZA 1994, 270
22Schaub, Arbeitsrechtshdb., § 52 VI 2
23Fitting/Kaiser/Heither/Engels, BetrVG Kom., § 3 Rdn. 9
24Rudolf Saller, Telearbeit, NJW-CoR 1996, 300,301
25 Schaub, aaO, § 52 VI 2 a
26Brox/Rüthers, aaO, Rdn. 102
27Schaub, aaO,§ 52 VI 1a-d; Richardi, NZA 1994,241
28Günter Schaub, aaO, § 52 VI 2
29Collardin, Aktuelle R.fragen d. Telearb., S. 174
30R. Albrecht, NZA 1996,1240,1243
31P. Wedde, Telearbeit, Hdb. f. AN u. BR, S.114 ff Schaub, aaO, § 52 VI 4f
32Jauernig-Teichmann, aaO, § 832 Rdn 3
33Palandt-Thomas, aaO, § 832, Rdn. 8
34Brox/Rüthers, aaO, Kap.4 III 4 c(4), Rdn. 102
35Brox/Rüthers, aaO, Rdn. 102
36Blohmeyer, in: Mch.Hdb. Bd I, § 57 Rn. 68 Schaub, aaO, § 52 VI 4e
37Wedde, aaO, S. 176; M. Collardin, Aktuelle Rechtsfrage der Telearbeit, S. 180
38 P. Wedde, Entw. d. Telearbeit-AR-Rahmenb., S. 85 R. Wank, D. Indi.AR d. Telearbeit, AG 1998,99 f.
39Peter Wedde, Telearbeit und Arbeitsrecht, S. 176
40T. Goerke, Arbeits- und Datenschutzrechtliche Grundlagen der Telearbeit, AuA 1996, 188, 191
41R. Albrecht, NZA 1996, 1240, 1245
42W. Gitter, Arbeitsrecht, S. 23
43Manfred Lieb, Arbeitsrecht, Rdn. 69
44BAG,NZA 1993,1127; Schaub,aaO, § 45,IV 7
45A. Söllner, Grundriß des Arbeitr., § 35 I
46G., v. Hoyningen=Huene, Grundlagen. u. Auswirkungen einer Versetzung, NZA 1993, 145, 146
47Brox, Arbeitsrecht, Rdn. 210
48Brox, aaO, Rdn. 179
49Palandt-Heinrichs, aaO, § 130, Rdn. 14; BAG, ZIP 1982, 1467; Brox, aaO, Rdn. 180
50Hanau/Adomeit, Arbeitsrecht, J II 1
51 Schmidt-Maus, HAG-Kommentar, § 2 Rdn. 93
52W. Gitter, aaO, S. 109
53P. Wedde, Rahmenbedingungen, S. 134 aA. Kappus, Telearbeit, S. 412
54P. Wedde, aaO, S. 153; M. Collardin, aaO, S. 41
55Rolf Wank, aaO, Arbeitgeber 1998, 99, 101
56BVerfG 32, 54
57BAG, NJW 1985, S. 2968, 2969; Collardin, aaO, S. 45, 46;
58P. Wedde , Rahmenbedingungen, S. 134 f.; Rolf Wank, aaO, Arbeitgeber 1998, 99, 101
59Richardi, Münchner Hdb.z.ArbR, § 14, Rdn. 2.
60Schaub, § 112, I 6; A. Söllner, § 31 III
61Zöllner/Loritz, Arbeitsrecht, § 17 IV 1
62Schaub, § 112, I 5, Dütz, Arbeitsrecht, Rdn. 49
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine juristische Analyse eines Falles, der sich mit Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit Telearbeit, der Rückversetzung eines Arbeitnehmers und dem Anspruch eines Arbeitnehmers auf einen Telearbeitsplatz befasst. Es behandelt die relevanten Rechtsnormen des BGB und des KSchG.
Wer haftet für den Schaden, der durch Tamara entstanden ist?
Das Dokument analysiert, ob Tamara selbst, ihre Mutter I oder beide für den entstandenen Schaden haften. Es werden Ansprüche aus § 823 I BGB, § 823 II BGB i.V.m. § 303a StGB und § 832 I BGB geprüft.
Kann A den C in den Betrieb zurückversetzen?
Das Dokument untersucht, ob A berechtigt ist, C von seinem Telearbeitsplatz in den Betrieb zurückzuversetzen. Dabei werden das Direktionsrecht des Arbeitgebers und die Möglichkeit einer Änderungskündigung betrachtet.
Hat S einen Anspruch auf einen Telearbeitsplatz?
Das Dokument analysiert, ob S einen Anspruch auf einen Telearbeitsplatz hat, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgrundsatzes.
Welche Rolle spielt die Aufsichtspflicht im vorliegenden Fall?
Es wird geprüft, ob die Mutter, I, ihre Aufsichtspflicht verletzt hat und ob sie für den Schaden haftet, den ihre Tochter Tamara verursacht hat.
Was sind die Voraussetzungen für eine Haftungsminderung des Arbeitnehmers?
Das Dokument untersucht, unter welchen Voraussetzungen die Haftung des Arbeitnehmers für betrieblich verursachte Schäden beschränkt werden kann. Dazu gehören das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses und die betriebliche Veranlassung der Tätigkeit.
Was bedeutet der Gleichbehandlungsgrundsatz im Zusammenhang mit Telearbeit?
Es wird analysiert, ob der Arbeitgeber den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt hat, indem er nicht alle Arbeitnehmer gleichermaßen für Telearbeit berücksichtigt hat.
Welche Rolle spielt der Artikel 13 des Grundgesetzes (Unverletzlichkeit der Wohnung) im Zusammenhang mit Telearbeit?
Es wird untersucht, ob der Arbeitgeber ein Zutrittsrecht zum Telearbeitsplatz hat und inwieweit dieses Recht mit dem Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung vereinbar ist.
Welche Bedeutung haben Sicherheitskopien bei Telearbeit?
Es wird erörtert, ob das Unterlassen der Anfertigung von Sicherheitskopien ein Mitverschulden des Arbeitgebers begründet.
Welche Rolle spielt das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) im Fall der Rückversetzung?
Es wird analysiert, ob das KSchG im Fall der Rückversetzung des C anwendbar ist und ob die Kündigung sozial ungerechtfertigt wäre.
- Quote paper
- Achim Greulich (Author), 1998, Juristisches Gutachten zum Thema Arbeitsrecht. Ansprüche aus § 832I BGB, § 832II BGBG i.Vm. § 303a StGB, § 832I BGB, § 823I BGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96055