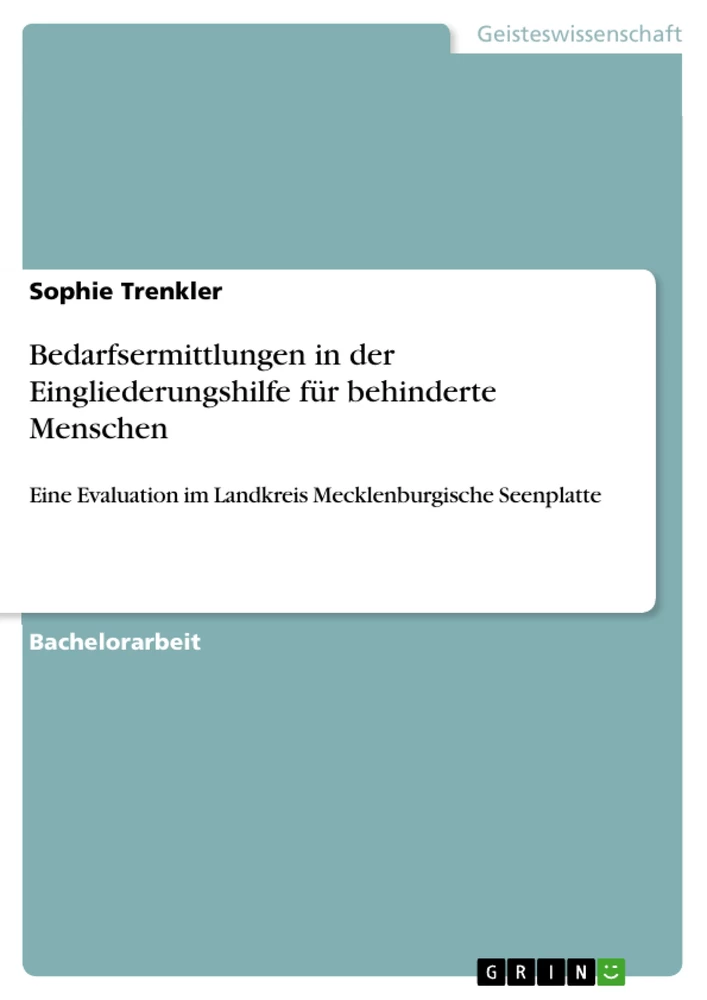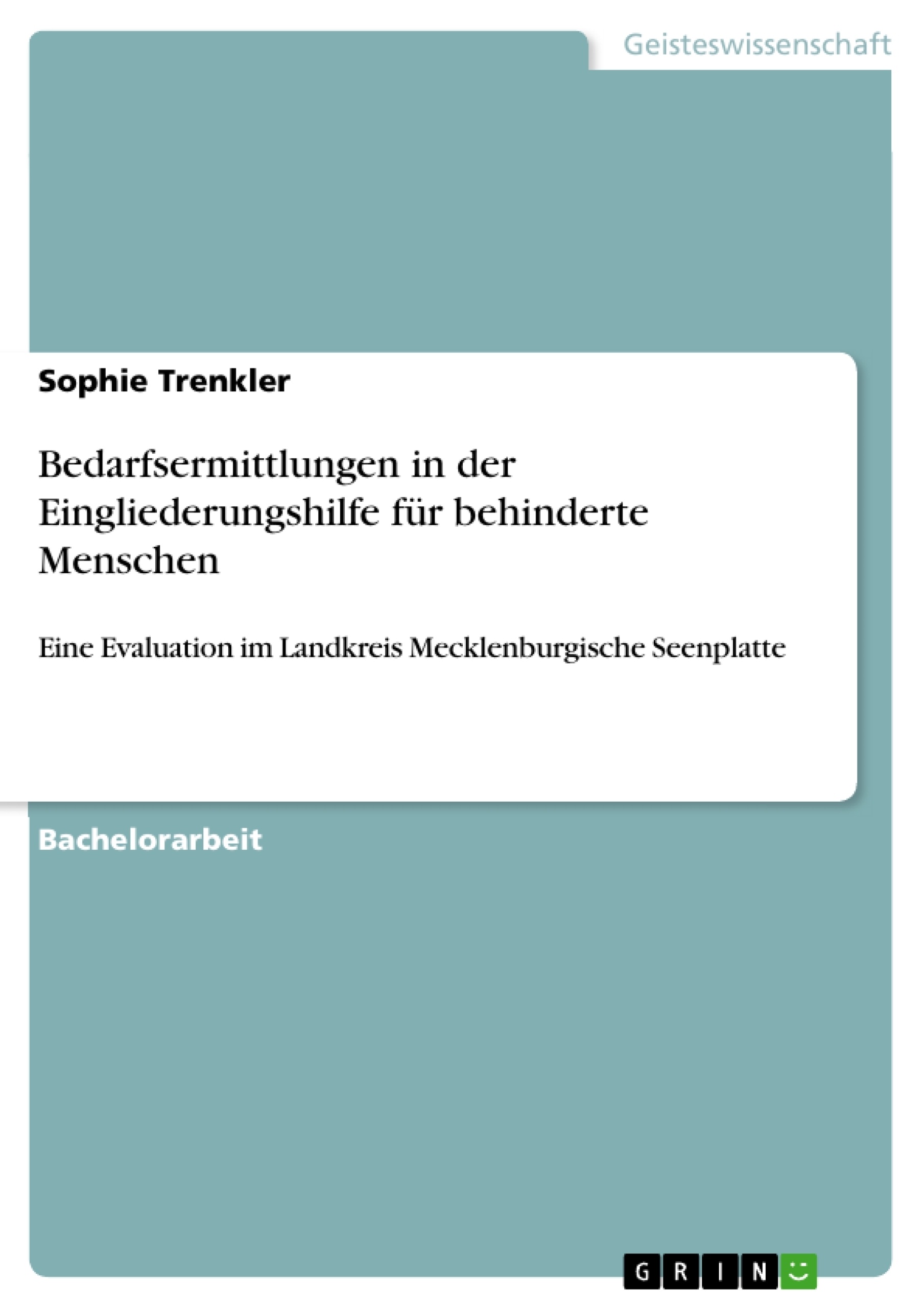In einer modernen Gesellschaft sollte jeder Mensch, mit oder ohne Behinderung, dass Leben führen können, welches er für richtig hält. Gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen oder Barrieren sollten nicht daran hindern, den eigenen Platz zu finden. Menschen mit Behinderungen sollten nicht in „Sonder“-welten leben, sondern mittendrin und an allen Gestaltungsprozessen partizipativ teilnehmen. Moderne Behindertenhilfe muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Mit dem BTHG ist von der Bundesregierung ein Reformgesetz verabschiedet worden, diese Dinge zu ermöglichen und schickt sich an, Inklusion in der Gesellschaft zu etablieren.
Mein Praktikum im Sommersemester 2018 startete zu einem Zeitpunkt, in dem sich die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in einem Umstrukturierungsprozess befand. Es mussten neue gesetzliche Vorgaben umgesetzt werden und ein neues Bedarfsermittlungsgesetz kam zum Einsatz: der ITP. Dieser soll es ermöglichen die leistungsberechtigten Bürger in den Blick zu nehmen, mit ihren Ressourcen und Zielen. Während dieser Zeit bildete sich die Frage, wie sich eben diese Bürger in dem Hilfeprozess fühlen. Fühlen sie sich als Mitgestalter ihrer Zukunft, im Fokus der Hilfeplanung? Bietet der ITP die Chance, personenzentrierte Hilfe zu ermöglichen?
Zur theoretischen Einordnung von Bedarfsermittlungen wird im ersten Kapitel die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen beschrieben. Dafür wird die UN-BRK erläutert und die Auswirkungen dieser auf die Judikative der Bundesrepublik, die zur Verabschiedung des BTHGs führte. Im folgenden Kapitel geht es um Grundlagen von Bedarfsermittlungen, denn während dieser kommt der ITP zum Einsatz. Es wird der ICF-Katalog erläutert und wie dieser den Behindertenbegriff, der in der Behindertenhilfe zum Einsatz kommt, verändert hat. Im praktischen Teil dieser Arbeit wird im dritten Kapitel zum Anfang auf die Entstehung der Fragestellung eingegangen und welche Methode verwendet wurde, um diese möglichst genau beantworten zu können. Anschließend wird der genutzte Fragebogen dargestellt, mit den unterschiedlichen Fragenkomplexen. Es werden die gewonnenen Ergebnisse vorgestellt, welche Fehler bei der Erhebung entstanden sein können und abschließend werden Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dies kann dazu beitragen, die Qualität der Arbeit im ASD zu steigern, da Erfahrungen der leistungsberechtigten Bürger sichtbar gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Relevanz
- 1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
- 1.3 Methode und Vorgehen
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Menschen mit Behinderung
- 2.1.1 Definition und Abgrenzung
- 2.1.2 Sozialrechtliche Grundlagen
- 2.1.3 Selbstbestimmung und Teilhabe
- 2.2 Bedarfsermittlung
- 2.2.1 Definition und Bedeutung
- 2.2.2 Methoden der Bedarfsermittlung
- 2.2.3 Qualitätsmerkmale der Bedarfsermittlung
- 2.3 Eingliederungshilfe
- 2.3.1 Rechtliche Grundlagen
- 2.3.2 Leistungsspektrum
- 2.3.3 Zielsetzung und Grundsätze
- 3 Analyse der Bedarfslage im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
- 3.1 Soziodemografische Daten
- 3.2 Statistische Daten zur Eingliederungshilfe
- 3.3 Qualitative Analyse der Bedarfslage
- 4 Evaluation der Bedarfsermittlung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
- 4.1 Methoden der Evaluation
- 4.2 Ergebnisse der Evaluation
- 4.3 Diskussion der Ergebnisse
- 5 Schlussfolgerung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis befasst sich mit der Evaluation von Bedarfsermittlungen in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Die Arbeit zielt darauf ab, die Qualität der Bedarfsermittlungsprozesse zu untersuchen und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und des Leistungsspektrums der Eingliederungshilfe
- Bewertung der Methoden und Instrumente der Bedarfsermittlung
- Identifizierung von Stärken und Schwächen der Bedarfsermittlungsprozesse im Landkreis
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Bedarfsermittlung
- Diskussion der Bedeutung von Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und Relevanz des Themas darlegt. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Eingliederungshilfe, der Bedarfsermittlung und der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung beleuchtet. Das dritte Kapitel analysiert die Bedarfslage im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, indem soziodemografische Daten, statistische Daten zur Eingliederungshilfe und qualitative Analysen betrachtet werden.
Das vierte Kapitel widmet sich der Evaluation der Bedarfsermittlungsprozesse im Landkreis. Es werden verschiedene Methoden der Evaluation vorgestellt und die Ergebnisse der Untersuchung analysiert. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Eingliederungshilfe, Bedarfsermittlung, Menschen mit Behinderung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Evaluation, Qualitätssicherung, Handlungsempfehlungen, Sozialgesetzbuch, Bundesteilhabegesetz.
- Citar trabajo
- Sophie Trenkler (Autor), 2019, Bedarfsermittlungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/960802