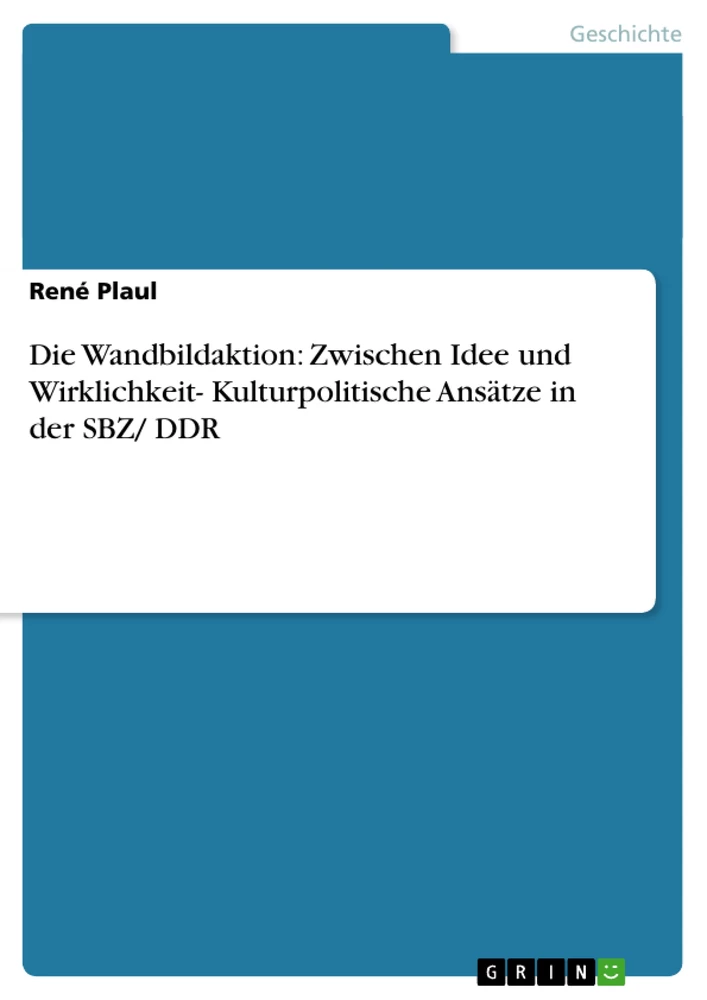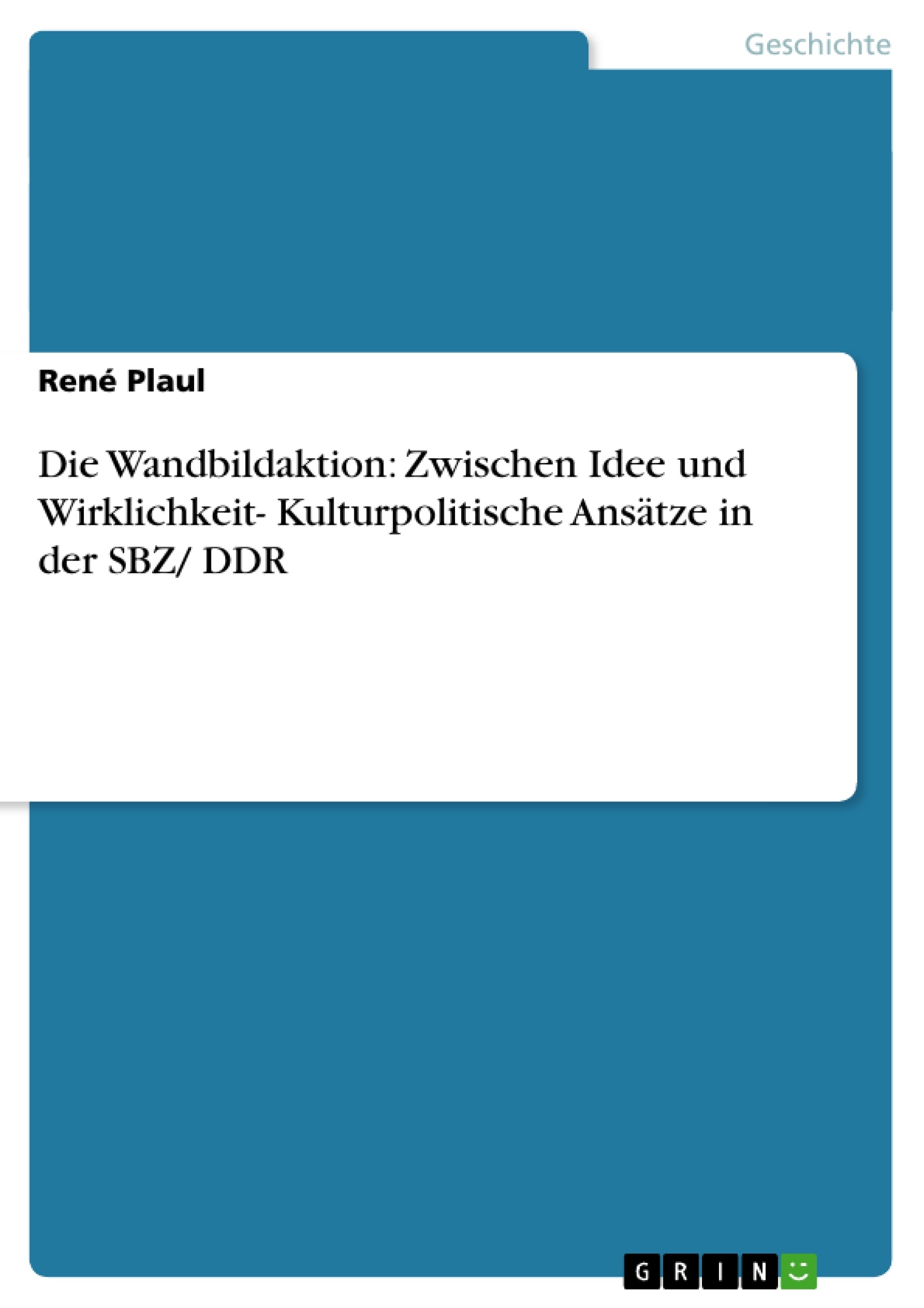Der geschichtliche Hintergrund
Ort der Wandbildaktion war die 2. Deutsche Kunstausstellung, die am 10. 09. 1949 in Dresden eröffnet wurde. Sie zeigte ca. 680 Exponate aus allen vier Zonen Deutschlands. Damit war in der SBZ eine Ausstellung zusammengekommen, die keineswegs den Erwartungen der Partei an eine neue, sozialistische Kunst gerecht wurde. So schrieb Stephan Heymann1 in einem „vertraulichen“ Schreiben an Wilhelm Pieck : „Die Ausstellung ist wie die Kunstkritiker unserer Presse bereits feststellten, eine Schau des Formalismus. Neue Ansätze sind fast überhaupt nicht vertreten, die gesamte Ausstellung ist ein schreiender Widerspruch zu der demokratischen Entwicklung in unserer Zone “2.
Erstmals wurde auf der dritten Sitzung des „Arbeitsausschusses für die 2. Deutsche Kunstausstellung Dresden 1949“ mit dem Gedanken gespielt ,Wandgemälde schaffen zu lassen. Es kam dabei der Vorschlag, 10 verschiedene Großbetriebe der sächsischen Wirtschaft für die thematische Bearbeitung heranzuziehen. Den Mittelpunkt sollte dabei der Zweijahresplan bilden.3 So war also die Verbindung zwischen Wirtschaftspolitik und Kunst bereits schon in dieser frühen Phase vorgesehen. Grund war wohl der kulturpolitische Ansatz, die Umgestaltung der Wirtschaft und das Thema Arbeit in den Vordergrund zu schieben. Denn waren noch kurze Zeit vorher Aufbau und Beseitigung der Trümmer der zentrale Gedanke, ging es nun speziell um Planerfüllung und Produktionssteigerung.
Noch in anderer Hinsicht sollten aber die Bilder ein visuelles Anschauungsobjekt werden.
Im Herbst 1948 setzte eine Formalismus- Debatte ein, die bei vielen Künstlern auf Unverständnis stieß. Es fehlte wohl an der Anschaulichkeit. Die Partei hatte sich aber zu einer Kampagne gegen den Formalismus entschlossen, da sie sich für eine „fortschrittliche deutsche Kultur“ einsetzen wollte.4 Die Wandbilder sollten aber bald ins anschauliche Zentrum der Kritik geraten. Denn in die als antinaturalistische Werke bezeichnete Bildern interpretierte Herbert Gute5 den anachronistischen Versuch, „aktionistische Kunsttendenzen aus der Weimarer Zeit“ zu übernehmen.6
Was waren die Wandbilder also nun genau und welchen Zweck sollten sie erfüllen?
Es sollten thematisch und inhaltlich feststehende Aufträge an Künstler vergeben werden, die mit Arbeitern aus Betrieben gemeinsam das gestellte Thema verarbeiten und in Gruppen zusammen umsetzen.7 Dabei wurde eine Liste von Aufgaben zusammengestellt. Themen waren u.a. Stahlwerk Riesa; Thema: Stahlguß, Walzwerk, Karl- Liebknecht Schacht; Thema: Kohle, Hennecke Bewegung; Maschinenausleihstation; Thema: Traktoreneinsatz, Bündnis Arbeiter- Bauern. Nach der Festlegung der Bilder wurden Künstler festgelegt, die eben diese Themen umsetzen8. Dazu bestimmte die künstlerische Leitung am 14. 04. 49 die Künstler, die neben Sachsen auch aus Berlin Leipzig und Chemnitz kommen sollten.9
Am 30. Juni 1949 konnte Gerd Caden10 an die SMA11 zehn Künstlerkollektive mit ihren konkreten Themen nennen. Am 5. Juli sollten schließlich alle Kollektive einen Entwurf mit Originalfarbe und im Maßstab 1:5 bzw. für große Werke 1:10 der künstlerischen Leitung vorlegen.12 Die vorgelegten Arbeiten und Lichtpausen der Entwürfe wurden überarbeitet, dann akzeptiert und zur Ausführung frei gegeben.
Als Ende August dann die Sitzung der Ausstellungsjury stattfand kam es zu einem Konflikt zwischen der Ausstellungsleitung und den Vertretern des Zentralsekretariats der SED. Die Vertreter erzwangen den Zutritt zur Hochschule und vermuteten Sabotage, als fast alle Ateliers geschlossen waren. Max Grabowski sah in Caden und der von ihm geführten künstlerischen Leitung einen Unsicherheitsfaktor , denn ihr künstlerisches Niveau war nach seiner Meinung nach zu sehr der bürgerlichen Vergangenheit verhaftet. Es wurden trotzdem alle 13 Wandbilder während der Ausstellung ausgestellt. Die Künstler erhielten ein Honorar von etwa 500- 600 Mark13. Die Werke schufen die Künstler auf Hartfaserplatten, die so besser verkauft werden sollten. Leider kam es nur zum Verkauf von zwei Bildern, von dem das Wandbild „Berufsschulung“ als einziges erhalten blieb. Alle nicht verkauften Werke zerschnitt man aus Gründen der Materialknappheit Ende der fünfziger Jahre und funktionierte sie zu Ausstellungswänden um.14
Schließlich schrieb Stephan Heymann an Wilhelm Pieck: Der Versuch mit Hilfe großer Wandbilder über Probleme des Aufbaus herauszukommen, ist im wesentlichen mißglückt.
Die 13 Wandbilder wurden von neun Kollektiven und vier einzelnen Künstlern gestaltet :1. Hans Christoph, Martin Hänisch, Werner Hofmann: „Steinkohle“; 2. Heinz Hamisch, Alfred Hesse, Rolf Krause: „Stahlwerk Riesa“; 3. Siegfried Donndorf, Willy Illmer, Fritz Tröger: „Großkraftwerk Hirschfelde“; 4. Karl- Erich Schaefer, Paul Sinkwitz, Willy Wolff: „Reichsbahnausbesserungswerk“; 5. Rudolf Bergander, Walther Meining, Franz Nolde: „Meißen- Keramik“; 6. Max Möbius, Fritz Skade: „Maschinenausleihstation“; 7. Erich Gerlach, Kurt Schütze: „Berufsschulung“; 8. Max Erich Nicola, Jürgen Seidel: „Feinmechanik Zeiß- Ikon; 9. René Graetz, Arno Mohr, Horst Strempel: „Metallurgie Hennigsdorf“; 10. Bernhard Kretzschmar: „Vorwärts zur Tat“; 11. Wilhelm Lachnit: „Begegnung“; 12. Willy Jahn: „Neubauern“; 13. Hans Kinder: „Tanz“.15
[...]
1 Jan. 49- Sept. 50 Leiter Abt. Kultur und Erziehung des ZK der SED
2 Kunstdokumentation SBZ/DDR 1945- 1990: Aufsätze, Berichte, Materialien; Hrsg.: Günter Feist, Eckart Gillen, Beatrice Vierneisel; DuMont Buchverlag Köln; 1996; S.:795
3 Auftrag: Kunst; Hrsg.: Monika Flacke ; Klinkhardt & Biermann; München/ Berlin; S.: 31
4 Kunstdokumentation SBZ/ DDR ; S.: 467
5 1948- 50 Rektor d. HS f. angew. Kunst B.- Weißensee u Ministerialdir. Zentr.verw. f. Volksbild. Berlin
6 Wandbilder sind keine Gelegenheitsarbeit; Herbert Gute; in ND: 11. 10. 1949
7 Protokoll über die 3. Sitzung der künstlerischen Leitung 9.4.1949
8 Beschluß in der Sitzung der künstlerischen Leitung vom 25.03.49
9 Protokoll über die Sitzung der künstlerischen Leitung vom 14.04.49
10 Leiter der 2. Deutschen Kunstausstellung DD, Abgeordnete der prov. Volkskammer, Leiter Auftragskommision f. künstlerische Arbeiten, Sachsen
11 Sowjetische Militäradministration
12 Auftrag: Kunst...S.: 33
13 Siehe: Rechnungsbericht, 23.2.1950 in: Bundesarchiv Potsdam, R2/2077
14 Auftrag: Kunst... S.: 35
Häufig gestellte Fragen
Was war der geschichtliche Hintergrund der Wandbildaktion?
Die Wandbildaktion fand im Rahmen der 2. Deutschen Kunstausstellung statt, die am 10. September 1949 in Dresden eröffnet wurde. Die Ausstellung umfasste etwa 680 Exponate aus allen vier Zonen Deutschlands. Allerdings entsprach die Ausstellung nicht den Erwartungen der Partei an eine neue, sozialistische Kunst, da sie als eine Schau des Formalismus kritisiert wurde.
Wann entstand die Idee, Wandgemälde schaffen zu lassen?
Die Idee, Wandgemälde zu schaffen, entstand auf der dritten Sitzung des "Arbeitsausschusses für die 2. Deutsche Kunstausstellung Dresden 1949". Es wurde vorgeschlagen, 10 verschiedene Großbetriebe der sächsischen Wirtschaft für die thematische Bearbeitung heranzuziehen, wobei der Zweijahresplan im Mittelpunkt stehen sollte.
Welchen Zweck sollten die Wandbilder erfüllen?
Die Wandbilder sollten thematisch und inhaltlich feststehende Aufträge an Künstler vergeben, die gemeinsam mit Arbeitern aus Betrieben das Thema verarbeiten und in Gruppen umsetzen. Sie sollten als visuelles Anschauungsobjekt dienen und die Umgestaltung der Wirtschaft sowie das Thema Arbeit in den Vordergrund rücken.
Wie lief der Auswahlprozess der Künstler und Themen ab?
Es wurde eine Liste von Aufgaben zusammengestellt, die Themen wie Stahlwerk Riesa, Karl-Liebknecht Schacht, Hennecke Bewegung, Maschinenausleihstation und Bündnis Arbeiter- Bauern umfasste. Nach der Festlegung der Bilder wurden Künstler ausgewählt, die diese Themen umsetzen sollten. Die künstlerische Leitung bestimmte die Künstler, die neben Sachsen auch aus Berlin, Leipzig und Chemnitz kommen sollten.
Wie wurden die Entwürfe begutachtet und freigegeben?
Die Künstlerkollektive legten Entwürfe mit Originalfarbe und im Maßstab 1:5 bzw. 1:10 der künstlerischen Leitung vor. Die vorgelegten Arbeiten und Lichtpausen der Entwürfe wurden überarbeitet, akzeptiert und zur Ausführung freigegeben.
Gab es Konflikte im Zusammenhang mit den Wandbildern?
Ja, es gab einen Konflikt zwischen der Ausstellungsleitung und den Vertretern des Zentralsekretariats der SED, die Sabotage vermuteten. Max Grabowski sah in Caden und der künstlerischen Leitung einen Unsicherheitsfaktor, da ihr künstlerisches Niveau seiner Meinung nach zu sehr der bürgerlichen Vergangenheit verhaftet war.
Was geschah mit den Wandbildern nach der Ausstellung?
Alle 13 Wandbilder wurden während der Ausstellung ausgestellt. Die Künstler erhielten ein Honorar von etwa 500-600 Mark. Nur zwei Bilder wurden verkauft, wobei das Wandbild "Berufsschulung" als einziges erhalten blieb. Die nicht verkauften Werke wurden Ende der fünfziger Jahre aus Gründen der Materialknappheit zerschnitten und zu Ausstellungswänden umfunktioniert.
Wer gestaltete die 13 Wandbilder?
Die 13 Wandbilder wurden von neun Kollektiven und vier einzelnen Künstlern gestaltet:
- Hans Christoph, Martin Hänisch, Werner Hofmann: "Steinkohle"
- Heinz Hamisch, Alfred Hesse, Rolf Krause: "Stahlwerk Riesa"
- Siegfried Donndorf, Willy Illmer, Fritz Tröger: "Großkraftwerk Hirschfelde"
- Karl- Erich Schaefer, Paul Sinkwitz, Willy Wolff: "Reichsbahnausbesserungswerk"
- Rudolf Bergander, Walther Meining, Franz Nolde: "Meißen- Keramik"
- Max Möbius, Fritz Skade: "Maschinenausleihstation"
- Erich Gerlach, Kurt Schütze: "Berufsschulung"
- Max Erich Nicola, Jürgen Seidel: "Feinmechanik Zeiß- Ikon"
- René Graetz, Arno Mohr, Horst Strempel: "Metallurgie Hennigsdorf"
- Bernhard Kretzschmar: "Vorwärts zur Tat"
- Wilhelm Lachnit: "Begegnung"
- Willy Jahn: "Neubauern"
- Hans Kinder: "Tanz"
- Citar trabajo
- René Plaul (Autor), 1999, Die Wandbildaktion: Zwischen Idee und Wirklichkeit- Kulturpolitische Ansätze in der SBZ/ DDR, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96104