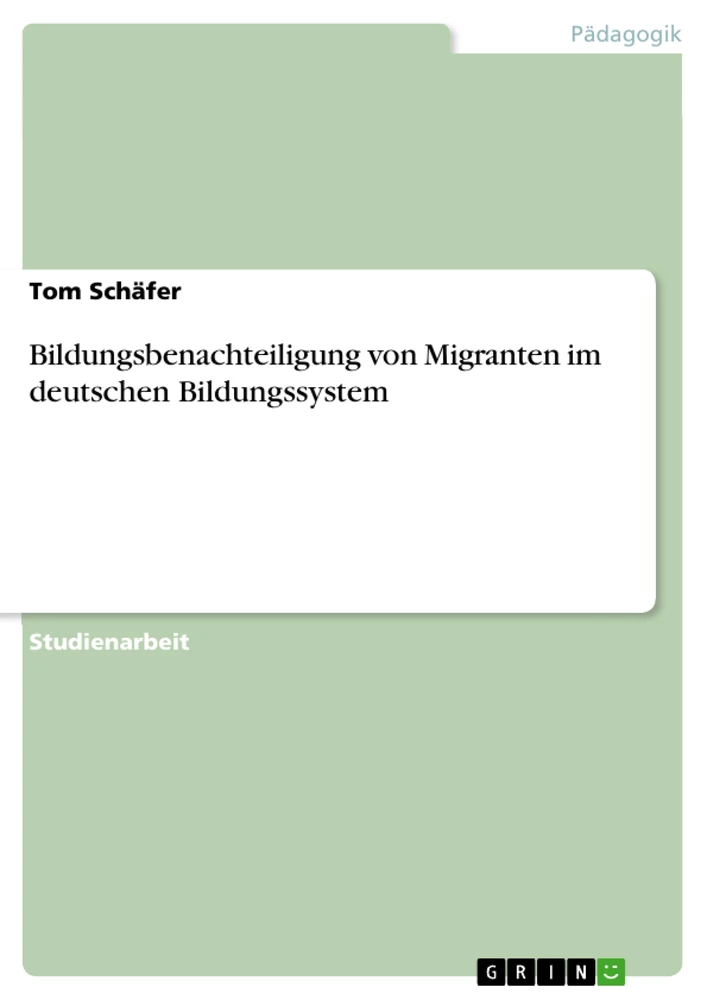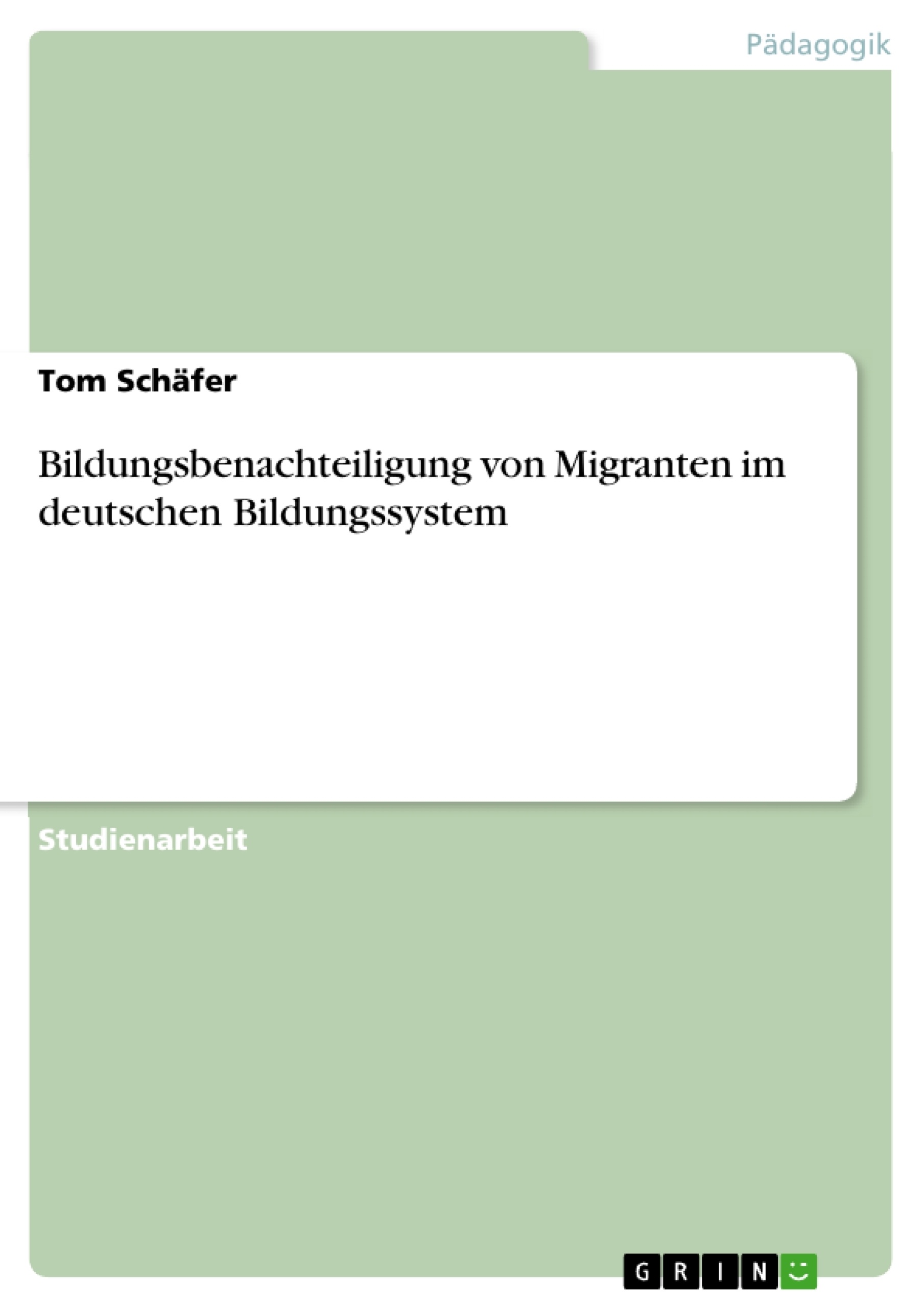In der Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit Kinder mit Migrationshintergrund für ihre Benachteiligung eigenverantwortlich sind oder das Bildungssystem sie vernachlässigt. Dazu werden im ersten Teil die Begriffe Migration und Diskriminierung erläutert. Im nächsten Teil werden die beiden gegensätzlichen Erklärungsversuche zur Benachteiligung betrachtet mit einem kleinen Einblick in die PISA-Studie. Im letzten Teil sollen Perspektiven und mögliche Verbesserungen der Probleme einen Ausblick geben, um den Schulalltag von Migrantenkindern zu bewältigen.
Der Spracherwerb von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist elementar, da das komplette Bildungssystem darauf ausgelegt ist, in deutscher Sprache zu kommunizieren und zu unterrichten. Umso höher jedoch das Einreisealter der Kinder und eine tiefere Einbindung in ihre Herkunftskultur ist, desto schwieriger ist der Erwerb der deutschen Sprache. Viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sprechen zu Hause ihre Muttersprache und daraus folgt eine schlechtere Voraussetzung für eine Selbstbestimmung im Bildungssystem. Nach PISA und IGLU hat sich ergeben, dass fast 50% der Jugendlichen aus Migrantenfamilien die elementare Stufe der Lesekompetenz nicht erreichen. Wie sollen diese Jugendlichen in Deutschland integriert werden, wenn der Spracherwerb als Basis für jegliche Bildung und schulischer Erfolg gilt? Die Chancen, die eine solche Mehrsprachigkeit mit sich bringt, wurden nicht erkannt. Sie gilt eher als eine Last.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und theoretische Vorüberlegungen
- 2. Begriffe „Migration“ und „Diskriminierung“
- 3. Ursachen und Erklärungen für die Nachteile der Kinder und Jugendlichen aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem
- 3.1 Individuelle Aspekte
- 3.2 PISA-Studie
- 3.3 Institutionelle Diskriminierung
- 4. Förderung / Perspektiven für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
- 5. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert, inwieweit diese Benachteiligung auf Eigenverschulden oder institutionelle Diskriminierung zurückzuführen ist. Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis für die Ursachen und Folgen der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern zu entwickeln und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Migration und Diskriminierung für das deutsche Bildungssystem
- Individuelle und institutionelle Faktoren, die zur Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern beitragen
- Die Rolle der PISA-Studie in der Diskussion um die Bildungsbenachteiligung
- Möglichkeiten zur Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
- Der Spracherwerb und seine Bedeutung für den schulischen Erfolg von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und erläutert die theoretischen Hintergründe der Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern. Das zweite Kapitel beleuchtet die Begriffe „Migration“ und „Diskriminierung“ und zeigt die verschiedenen Gründe für Migration auf. Das dritte Kapitel widmet sich den Ursachen und Erklärungen für die Nachteile von Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem. Es werden sowohl individuelle als auch institutionelle Faktoren betrachtet, die zu einer Benachteiligung beitragen können.
Schlüsselwörter
Bildungsbenachteiligung, Migration, Diskriminierung, Migrantenfamilien, PISA-Studie, Spracherwerb, Integration, Inklusion, Bildungschancen, Deutsch als Fremdsprache.
- Quote paper
- Tom Schäfer (Author), 2017, Bildungsbenachteiligung von Migranten im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/961205