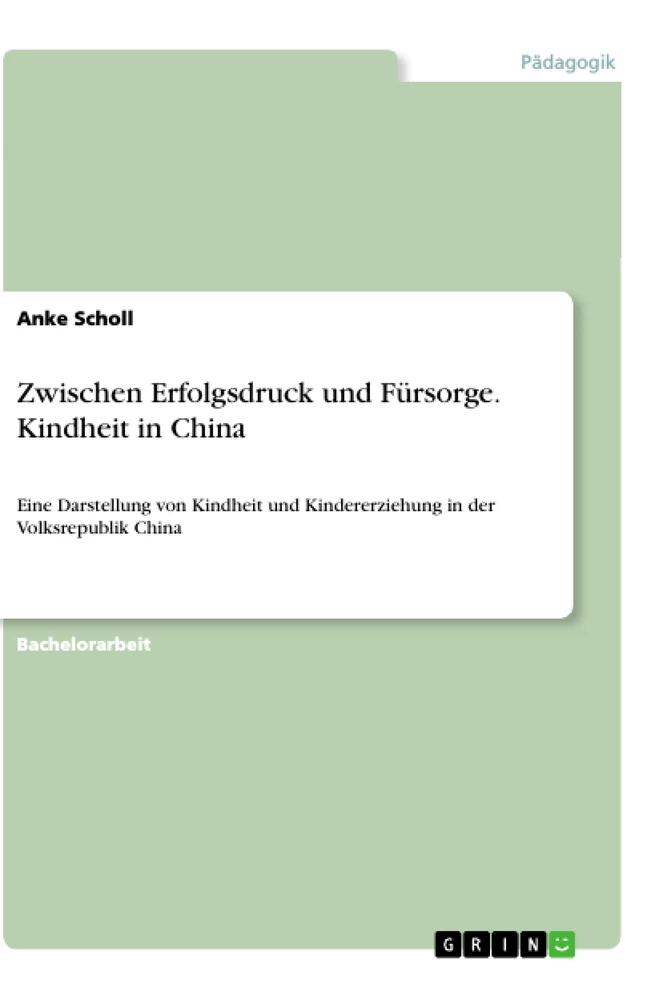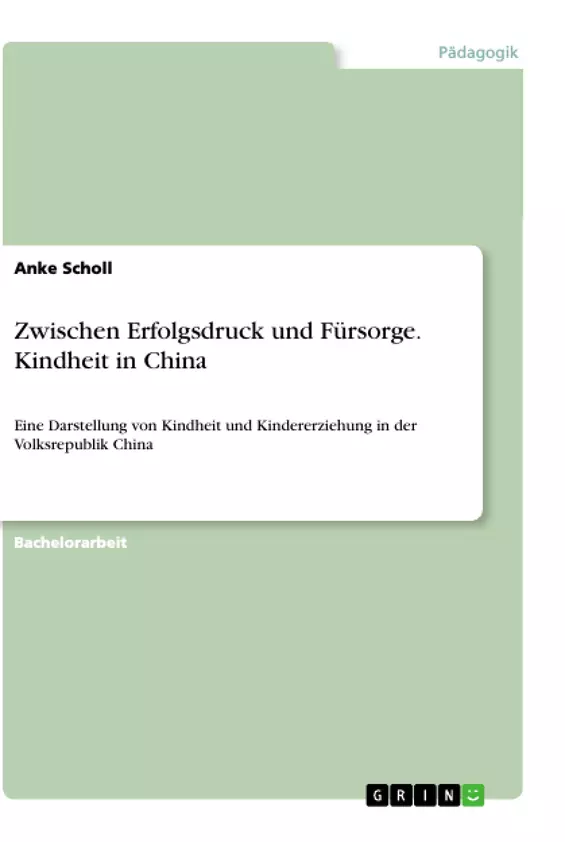Der chinesische Erziehungsstil und das chinesische Bildungssystem sind ein viel diskutiertes sowie umstrittenes Thema. Vor diesem Hintergrund zielt die Arbeit darauf ab, einen Überblick über die Kindheit und die Kindererziehung in China zu geben. Grundlegend sind hier die folgenden Forschungsfragen: Welche Faktoren beeinflussen die chinesische Kindererziehung? Wie gestaltet sich die chinesische Kindererziehung am Beispiel des Kindergartens? Welche Chancen und Risiken lassen sich in der chinesischen Kindererziehung erkennen? Um diese Fragen zu beantworten, werden aktuelle Fachliteratur diskutiert und die einzelnen Forschungsfragen als Leitfragen der einzelnen Kapitel verstanden. Zunächst werden soziokulturelle Faktoren aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Kultur dargestellt. Im Anschluss wird die frühkindliche Erziehung am Beispiel des Kindergartens betrachtet. Abschließend werden die Chancen und Risiken für die Kindesentwicklung aufgezeigt, die sich aus den Forschungsergebnissen ergeben. In diesem Zusammenhang werden das Modell des Wertequadrats nach Schulz von Thun hinzugezogen sowie die Begriffe Individualismus und Kollektivismus diskutiert. Im Ergebnis der Arbeit wird deutlich, dass traditionelle kollektivistische Erziehungsmethoden tief in der chinesischen Gesellschaft verankert sind – sowohl im familiären als auch im schulischen Kontext. Gleichzeitig sind individualistisch orientierte Ansätze insbesondere im frühkindlichen Bildungsbereich zu verzeichnen. Diese Entwicklung lässt hoffen, dass sich individualistische Tendenzen weiter fortsetzen und dass sich daraus ein Erziehungskonzept entwickelt, welches die Prinzipien einer individualistischen sowie kollektivistischen Kindererziehung gleichermaßen aufweist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Erläuterungen
- Begriffsannäherung
- Die Kindererziehung in China
- Politik
- Politisches System
- Bildungspolitik
- Historische Entwicklung
- Aktuelles Bildungswesen
- Bildungssystem
- Selektionsmechanismen
- Gesellschaft
- Kollektivismus
- Chinesische Familie
- Wandel der Erziehungsvorstellungen
- Erziehung durch die Großeltern
- Ein-Kind-Politik
- Zwei-Kind-Politik
- Kultur
- Konfuzianismus
- Fünf Beziehungen
- Kindespietät
- Klugheit
- Selbstkultivierung
- Zusammenfassung
- Frühkindliche Erziehung in China am Beispiel des Kindergartens
- Reformierung des Kindergartenwesens
- Reformen der zwanziger und dreißiger Jahre
- Reformen der fünfziger Jahre
- Reformen seit den achtziger Jahren
- Ausgestaltung der Kindergarten curricula
- Aktueller Stand der frühkindlichen Bildung
- Kindergärten
- Öffentliche und private Kindergärten
- Stadt-Land-Gefälle
- Professionalisierung pädagogischer Fachkräfte
- Qualitätssicherung
- Zusammenfassung
- Chancen und Risiken der chinesischen Kindererziehung
- Individualismus und Kollektivismus
- Individualismus und Kollektivismus in der Kindererziehung
- Merkmale individualistisch orientierter Kindererziehung
- Merkmale kollektivistisch orientierter Kindererziehung
- Wertequadrat nach Schulz von Thun
- Wertequadrat zu Individualismus und Kollektivismus
- Chancen und Risiken der Kindererziehung in China
- Chancen der Kindererziehung
- Risiken der Kindererziehung
- Zusammenfassung
- Einfluss soziokultureller Faktoren auf die chinesische Kindererziehung
- Analyse des frühkindlichen Bildungssystems, insbesondere der Kindergartenlandschaft
- Diskussion der Chancen und Risiken der chinesischen Kindererziehung im Hinblick auf die Kindesentwicklung
- Bedeutung von Individualismus und Kollektivismus im Kontext der chinesischen Kindererziehung
- Anwendung des Wertequadrats nach Schulz von Thun zur Erläuterung der verschiedenen Erziehungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Erforschung der Kindheit und der Kindererziehung in China. Sie analysiert die soziokulturellen Faktoren, die die chinesische Kindererziehung prägen, und beleuchtet insbesondere die Rolle des Kindergartens als wichtigen Bestandteil des frühkindlichen Bildungssystems. Die Arbeit untersucht auch die Chancen und Risiken, die sich aus den verschiedenen Erziehungsansätzen für die Kindesentwicklung ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Arbeit beleuchtet und die zentralen Forschungsfragen erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die soziokulturellen Faktoren, die die chinesische Kindererziehung beeinflussen, und umfasst dabei die Bereiche Politik, Gesellschaft und Kultur. Dabei werden politische Rahmenbedingungen wie die Bildungspolitik, das Bildungssystem und die Ein-Kind-Politik betrachtet. Die Rolle des Konfuzianismus und die Bedeutung der Familie in der chinesischen Gesellschaft werden ebenfalls diskutiert.
Kapitel 3 widmet sich der frühkindlichen Erziehung in China am Beispiel des Kindergartens. Es wird die historische Entwicklung des Kindergartenwesens betrachtet sowie die aktuellen Strukturen und Herausforderungen des Bildungsbereichs beleuchtet. Kapitel 4 schließlich untersucht die Chancen und Risiken der chinesischen Kindererziehung, wobei die Konzepte von Individualismus und Kollektivismus im Mittelpunkt stehen. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung und einem Fazit abgeschlossen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie chinesische Kindererziehung, frühkindliche Bildung, Kindergarten, Individualismus, Kollektivismus, Konfuzianismus, Bildungspolitik, Familie, Gesellschaft und Kultur. Sie beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen und analysiert die Auswirkungen auf die Kindesentwicklung.
- Quote paper
- Anke Scholl (Author), 2020, Zwischen Erfolgsdruck und Fürsorge. Kindheit in China, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/961348