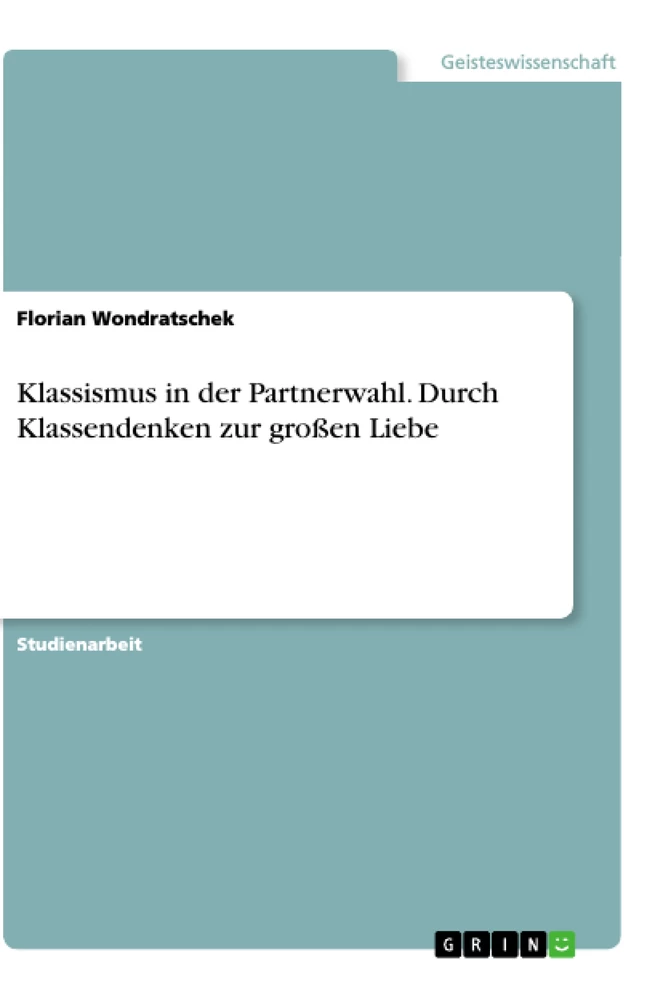Wie sehr beeinflusst Klassismus die Partnerwahlentscheidung? In dieser Arbeit wird diese Fragestellung mithilfe von interdisziplinären Studien aus der Soziologie, Sozial- und Evolutionspsychologie und der Familienökonomik länderübergreifend erforscht. Zudem erhebt die Arbeit den Anspruch, ein Verständnis dafür zu schaffen, inwieweit bei der Partnerwahl Entscheidungen auf Basis von klassistischen Denkweisen "diskriminierend" sind und welche individuellen und gesellschaftlichen Auswirkungen sie haben.
Da eine Liebesbeziehung jedoch nicht isoliert anhand von Voraussetzungen, Abläufe und Folgen im gesamtgesellschaftlichen Gefüge erklärt werden kann, sondern die Auswirkung sozialer Interaktionen mitberücksichtigt werden müssen, gibt es einen sozialpsychologischen Teil über die Partnerwahl. Hier wird anhand aktueller Studien von Gignac u. Zajenkowski (2019), sowie von Goleman (2020), insbesondere die Herzensbildung als neuer gültiger klassismusfreier Partnerwahlerklärungsansatz dargelegt.
Die Evolutionspsychologie hob die Bedeutung der sozialen Klasse bei einer Person hervor und auch medial öffentlich präsentierte der bekannte Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen im WDR einen Ansatz, nach welchem die Partnerwahlen über den Beruf nach einem hierarchischen Muster ablaufen. Um diese Thesen besonders unter soziologischer Perspektive zu analysieren und zu überprüfen, soll die Ausarbeitung den Titel "Durch Klassendenken zur großen Liebe?" tragen. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg wurde von Universitäten, wie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, besonderer Wert darauf gelegt, die 'Vorurteile des 'Klassenhochmutes' zu überwinden, was mithilfe dieser Arbeit ein Jahrhundert später ebenfalls versucht wird.
Inhalt
1. Einführung
2. Sozialer Status, Klasse und Klassismus
2.1. Sozialer Status und Klasse
2.2. Klassismus
3. Sozialstrukturelle, evolutionspsychologische und familienökonomische Erklärungsansätze
3.1. Der sozialstrukturelle Ansatz
3.2. Der evolutionärpsychologische Ansatz
3.3. Der familienökonomische Ansatz
4. Klassistische Diskriminierung in der Partnerwahl
4.1. Diskriminierung
4.2. Folgen klassistischer Diskriminierung
4.2.1. Individuelle Folgen der Diskriminierung
4.2.2. Gesellschaftliche Folgen der Diskriminierung
5. Sozialpsychologische Erklärungsansätze
5.1. Räumliche und physische Nähe
5.2. Werte und Einstellungen
5.3. Ehrlichkeit und Konfliktbewältigung
5.4. Bildung
6. Fazit
7. Abbildungsverzeichnis
8. Literaturverzeichnis
In der vorliegenden Ausarbeitung soll gendergerechte Sprache verwendet werden. Maskuline Wortverwendungen wie Partner sollen stets geschlechtsunabhängig verstanden werden.
Triggerwarnung: Für Lesende ist zu beachten, dass die Ausarbeitung emotionale Inhalte enthält, welche an erlebte Traumata erinnern oder in Situationen zurückversetzen können. Bei schwerwiegenden Problemen können sich Lesende an die Hotline 0800 5577330 wenden.
1. Einführung
Welche Kriterien entscheiden bei Menschen, dass eine Partnerwahl zustandekommt? Immer wieder wird diese komplexe Fragestellung mithilfe von interdisziplinären Studien erforscht, aus denen viele verschiedene Theorien abgeleitet wurden.
Die Evolutionspsychologie hob die Bedeutung der sozialen Klasse bei einer Person vor und auch medial öffentlich präsentierte der bekannte Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen im WDR einen Ansatz, nach welchem die Partnerwahlen über den Beruf nach einem hierarchischen Muster ablaufen (vgl. Bischoff 2018; vgl. Westdeutscher Rundfunk 2017). Um diese Thesen besonders unter soziologischer Perspektive zu analysieren und zu überprüfen, soll die Ausarbeitung den Titel „Durch Klassendenken zur großen Liebe?" tragen. Bereits nach dem ersten Weltkrieg wurde von Universitäten, wie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, besonderen Wert darauf gelegt, dass die „Vorurteile des Klassenhochmutes" überwunden werden müssen, was ebenfalls mithilfe dieser Arbeit ein Jahrhundert später versucht wird (vgl. Brintzinger 1996, 258).
Dazu soll zunächst erklärt werden, was unter dem Wort „Klasse“ eigentlich verstanden wird. Mit Verweis auf Max Weber wird deutlich, dass Partnerwahlen zur Identifizierung ständischer Lagen zentral waren, sowie den Zugang zu privilegierten Positionen einer Gesellschaft sichern sollten (Weber 1980, 179). Durch seine Beobachtungen zur Sozialstruktur soll der Abschottungsmechanismus erklärt werden, aus dessen Motiv Standesdünkel entsteht, der im nordamerikanischen Raum seit dem 20. Jahrhundert unter dem Überbegriff Klassismus bekannt ist. Ein ganzer Kapitelabschnitt wird sich daher mit der Klassismustheorie von Chuck Barone (1999) befassen, welche in drei Graden unterteilt.
Von dieser Grundlage aufbauend sollen drei verschiedene Partnerwahlerklärungsansätze vorgestellt werden, der sozialstrukturelle nach Klein (2000), der evolutionärpsychologische nach Buss und Barnes (1986) sowie der familienökonomische Ansatz nach Becker (1981). Die interdisziplinäre Begutachtung soll den Vorteil bringen, dass Partnerwahlen strukturenübergreifend gedacht werden sollten. Damit soll sich dem soziologischen Ziel, soziales Handeln deutend zu verstehen und seinen Ablauf und Wirkung ursächlich zu erklären, angenähert werden (vgl. Weber 1920, 1).
Um die Folgen tiefer zu betrachten, beschäftigt sich das nachfolgende Kapitel mit Diskriminierungen, die durch Klassismus bei Partnerwahlen ausgelöst werden. In diesem Abschnitt wird die neuartige Hypothese vertreten, dass Trennungen und Scheidungen diskriminieren können. Gestützt wird diese Aussage mit mehreren qualitativen Studien über allgemeine klassistische Diskriminierung, die sowohl die individuellen und gesellschaftlichen Folgen analysierten. Gleichzeitig werden psychoanalytische und paartherapeutische Forschungen von Roland Weber (2014) und Jürg Willi (1988 u. 1991) hinzugezogen, welche sich ebenfalls mit den individuellen Folgen und Trennungsmotiven auseinandersetzten, die ein Spannungsfeld zur Sozialstrukturtheorie erzeugen. Es werden Faktoren genannt, die ein klassistisches Diskriminierungskonstrukt weiter vorantreiben.
Das angesprochene Spannungsfeld wird im darauffolgenden Kapitel weitergeführt, in welchen die aus der Sozialpsychologie abgeleiteten Erklärungen für Partnerwahlen miteinfließen, um der übergeordneten Forschungsfrage „Durch Klassendenken zur großen Liebe“ ebenfalls transdiziplinär gerecht zu werden. Da Partnerwahlen nicht nur über das gesamtgesellschaftliche Gefüge erklärt werden können, müssen Gedanken, Gefühle und Verhalten, welche auch einen signifikanten Einfluss auf sie haben, mitbeleuchtet werden. Die Sozialpsychologie untersucht mitausschlaggebende Charaktereigenschaften für die Partnerwahl und versucht Angaben darüber zu machen, inwieweit diese langfristig und zufriedenstellend sein können. So werden in diesem Kapitel die psychosozialen Auswirkungen von räumlicher Nähe, von Werten und Einstellungen, von Ehrlichkeit und Konfliktbewältigungsfähigkeit, wie auch von Bildung angeführt werden. Gerade beim letzgenannten Punkt stellen die jüngsten Veröffentlichungen von Goleman (2020) sowie von Gignac und Callis (2020) ein neues Merkmalkonzept vor, mit welcher die bisherigen wissenschaftlichen Antworten, inwieweit Klasse die Partnerwahl beeinflusst, bahnbrechend verändert werden könnten.
Partnerwahlen außerhalb der heterosexuellen Orientierung werden in der Ausarbeitung nicht einbezogen, um den Fokus verstärkt auf Klassismus und heterosexuellen Partnerwahlen zu lenken.
2. Sozialer Status, Klasse und Klassismus
2.1. Sozialer Status und Klasse
Die Soziologie hat zur Analyse wichtiger Bereiche der sozialen Ungleichheit in modernen Gesellschaften zwei zentrale Konzepte entwickelt. Den älteren Begriff der Klasse und den jüngeren Begriff der Schicht (Geißler 2011, 69). Karl Marx erhob das Klassenkonzept bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer soziologischen Grundkategorie, Schicht dagegen erst in der Auseinandersetzung mit Marx (vgl. Geiger 1932, 191). Die sich wandelnde Struktur der sozialen Ungleichheit hat dazu geführt, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Verwendungen dieser Begriffe existiert (vgl. Geißler 2011, 69). Alle Klassenbegriffe und auch viele Schichtbegriffe lassen sich an drei gemeinsamen Kernpunkten charakterisieren (vgl. ebd.):
1. Vorhandene Klassen- und Soziallage: Bevölkerungen lassen sich in verschiedene Gruppen aufspalten, die sich in ähnlichen Klassen- oder Soziallagen befinden, welche an Merkmale bestimmt werden (vgl. ebd.). Die „Schichtdeterminaten“ nach Karl Marx können durch die Stellung von den Produktionsmitteln, durch Besitz- oder Einkommensverhältnisse und durch den Beruf identifiziert werden (Geiger 1932, 191).
2. Die Vorstellung von klassen- und schichttypischen Prägungen (Sozialisationsannahmen): Menschen, die in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen, machen ähnliche Erfahrungen. Die Klassenlage kann ihre Denkweise, ihre Vorstellungskraft, ihre Mentalität, ihre Interessen beeinflussen, sodass nach Marx Klassenbewusstsein, nach Bourdieu Klassenmentalität entsteht. Der Zusammenhang dieser Prägung ist allerdings nicht determiniert, sondern erhöht nur die Wahrscheinlichkeit und wird daher als klassentypisch beschrieben (vgl. Geiger 1932, 5). (Geißler 2011, 69)
3. Ableitbare klassen- und schichttypischen Lebenschancen: Aus den Klassen- und Schichtlagen resultieren klassen- und schichttypische Lebenschancen und - risiken (vgl. ebd.). Durch ungleiche herkunftssoziologische Grundkapitalien und Startbedingungen lassen sich auch unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für Lebenschancen ableiten (vgl. Veit 2019, 352).
Der Soziologe Max Weber stellte eine Sozialstruktur auf, in der sich Menschen in Bezug auf ihre ständische Lage unterscheiden. In einer gesellschaftlichen Schätzung werden die Lebensführungsart, die Erziehungsweise und das Abstammungs- oder Berufsprestige als Wertungsmerkmal betrachtet, aus denen der soziale Status abgeleitet wird.
Der Ausdruck solcher Klassenbezogenheit zeigt sich durch Kommonsalität, d.h. dass man sich vornehmlich in seiner Schichtungsblase bewegt (vgl. Weber 1980, 179). Aktuelle Forschungen legen nah, dass Abschottungen durch Social Media begünstigt werden und dass COVID-19 ebenenunabhängige Begegnungen erschweren (vgl. Mahrt 2014, 136; Gonzalez-Padilla/Tortolero-Blanco 2020, 121). Kommonsalität drückt sich auch darin aus, dass man ständische Traditionen pflegt, sich durch die priveligierte Lage ökonomische, politische und geistig-moralische Macht aneignet (monopolistische Appropriation), seine Partner millieuspezifisch aussucht und sich von niedriger wahrgenommen Klassen abgrenzt. (vgl. Weber 1980, 179)
Der dafür in der deutschen Sprache verwendete Begriff ist Standesdünkel, welcher den spezifischen Hochmut eines Standes oder einer Berufsgruppe gegenüber anderen, als „niedriger“ erachteten Ständen oder Berufen bezeichnet. Ursprünglich wurden mit dem Begriff das sogenannte standesgerechte Verhalten und die damit einhergehende entsprechende Einstellung von Teilen des Adels kritisiert. Diese Kritik machte sich beispielsweise an der Etikette fest, sich herablassend gegenüber niedrig wahrgenommenen Klassen zu verhalten und nicht unter seinem Stand zu heiraten. Obwohl immer noch vom Standesdünkel die Rede ist, lässt sich der Begriff heute synonym mit Klassendenken und Berufsdünkel verstehen.
Kurt Tucholsky hat ein solches Phänomen bereits in den Zwanzigern in Deutschland beschrieben:
„Der Berufsdünkel sitzt dem Deutschen tief im Blute - und statt nur über die Junker zu wettern, sollte er sich einmal die Geschichte der alten Zünfte ansehen, wie da nicht nur die „Bönhasen“ verfolgt wurden, was eine wirtschaftliche Maßnahme war, sondern wie der Schneider und der Schuster eine ins Mystische spielende Scheu vor dem eignen Tun hatten, einen Respekt vor sich selbst - was mehr zum Moralischen gehörte. Die Industrie hat nun merkwürdigerweise nicht den Ackerbau und die Beamten industrialisiert, sondern sie selbst ist verjunkert und administrativ überorganisiert worden - und was früher der Ritterstiefel und das treffliche Schwert waren, das ist heute das Wort „Großindustrieller“ und ein Kollektivwahnsinn, der nahezu alle Gruppen des Wirtschaftslebens erfaßt hat“ (Tucholsky 1926).
Wer sich mit der Erforschung von Klassenbildern beschäftigt, muss die politökonomischen Umstände berücksichtigen. Klassen erhalten sich insbesondere dadurch, dass eine Ungleichverteilung von Kapital mit Ungleichheiten in Bildung, Gesundheit, Wohnort, Zugang zu Kultur korrelieren (vgl. Kemper/ Weinbach 2016, 16f.). In einer Gesellschaft, in der kaum solche Korrelationen vorhanden sind, könnte nach Marxschen Verständnis eine „klassenlose Gesellschaft“ entstehen. Die Anti-Klassentheorie des konservativen Soziologen Helmut Schelsky prognostizierte eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“, der durch den Verlust der Klassenspannung und sozialen Hierarchie gekennzeichnet ist (vgl. Schelsky 1979, 327). Der Massenkonsum von materiellen und geistigen Gütern könne dafür sorgen, dass sich ein einheitlicher Lebensstil herausbilde, der als „kleinbürgerlich-mittelständisch“ bezeichnet wird (vgl. ebd.). Die Arbeiterschicht und das ehemalige Besitz- und Bildungsbürgertum würden als einheitliche Klasse wahrgenommen werden (vgl. ebd.). Allerdings lässt sich feststellen, dass in der Bundesrepublik weiterhin die Korrelationen von Ungleichheiten existieren, in welchen Klassenspezifika immer noch nachweisbar sind (vgl. Groß 2008, 42; vgl. Georg 2015, 295; vgl. Kessler 2016, 22; vgl. Alisch 2017, 505; vgl. Esser/Hoenig 2018, 425).
2.2. Klassismus
In den Vereinigten Staaten setzte sich um 1900 als sozialwissenschaftlicher Begriff der Klassismus durch, welcher Vorurteile oder Diskriminierung aufgrund des sozialen Status bezeichnet, und derzeit wieder eine Renaissance erlebt. Der Begriff classism wurde ähnlich wie sexism und racism gebildet, um zu betonen, dass Diskriminierung nicht nur aufgrund von ethnisch bedingtem Rassismus oder auf Basis des Geschlechtes, sondern auch aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse stattfindet.
In den Sozialwissenschaften besteht ein weitgehendes Einvernehmen darüber, dass es sich bei Rassismus, Sexismus und Klassismus „um Herrschaftsverhältnisse handelt, die zusammenwirken, die sich gegenseitig verstärken, sich ähneln, aber doch nie ganz ineinander aufgehen“ (Roß 2004, 18; vgl. Hooks 2000, 3).
Klassismustheorien sehen die Auseinandersetzung zwischen Klassen als Hauptwiderspruch im Sinne des Marxismus, Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht oder Ethnizität als „Nebenwidersprüche“. Sie wollen vor allem verhindern, dass die Diskussion über Klassendiskriminierung gegenüber Sexismus und Rassismus als Diskriminierungsformen weiter in den Hintergrund gerät. Betont wird auch die Überschneidung verschiedener Unterdrückungsformen, wie sie beispielsweise von der Intersektionalitäts-Theorie formuliert wird.
Während vermehrt Fälle eines Klassismus beschrieben werden, der „niedrigere“ Klassen diskrimiert (downward classism), soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass es auch einen Klassismus nach „oben“ gibt, der upward classim genannt wird (Liu 2011, 199). „Klassismus nach oben begegnet uns in Vorurteilen und Diskriminierung gegen Personen, die man einer höheren Klasse zurechnet“ (Liu 2011, 200). Eine Form davon ist beispielsweise, jemanden als elitär, Snob oder Spießer wahrzunehmen oder abzustempeln (Zitelmann 2019, 38). Im zwischenmenschlichen Bereich kann sich Klassismus nach oben auch in Form von Eifersucht und Neid manifestieren. Zwar räumen andere Sozialwissenschaftlerinnen ein, „dass Vorurteile auch vonseiten der ArbeiterInnenklassen [sic!] zum Beispiel gegenüber Reichen und Intelektuellen existieren“ (Kemper/ Weinbach 2016, 23). Die Diskriminierung leistet einen maßgeblichen Beitrag zu einer vereinnahmten Denkweise der Herabsetzung und Abwertung von Menschen (vgl. Kemper/ Weinbach 2016, 51). Klassismus ist eine Form von Unterdrückung, die als eine Kombination von Vorurteilen und Macht verstanden werden kann, welche auch beim Sexismus und Rassismus funktioniert (vgl. Zitelmann 2019, 38). Allerdings kann downward und upward classism nicht gleichgesetzt werden. „Mitglieder der dominierten und der dominanten Gruppe hätten wechselseitig Vorurteile gegeneinander, doch nur die dominierenden Gruppen haben auch die Macht, ihre Vorurteile mittels Unterdrückung strukturell wirksam werden zu lassen“ (Kemper/ Weinbach 2016, 51). Dabei ist hochumstritten, ob es ein oben und ein unten gibt, wer den Maßstab festlegt, dass Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen unterschiedlich viel wert sein können oder ob die Macht und Dominanz von scheinbar herrschenden sozialen Klassen eventuell konstruiert sind. Klassismus-Analysen setzen aber die Formulierung von Klasse als Konstruktion voraus, da Klassismus ein System der Zuschreibung von Werten und Fähigkeiten beschreibt, „die aus dem ökonomischen Status heraus abgeleitet oder besser: erfunden und konstruiert werden“ (Kemper/ Weinbach 2009, 17). Deshalb braucht es „Stereotype reflektierende und dekonstruierende Untersuchungen und Theoretisierungen, wie sie für die Frage der Gendersozialisation mittlerweile zahlreich produziert werden“ (Kemper/ Weinbach 2009, 21).
Die Klassismustheorie vom Wirtschaft- und Sozialwissenschaftler Chuck Barone unterteilt den Klassismus in drei Ebenen.
Makroebene: Hierbei handelt es sich um eine systembedingte Unterdrückung einer Klasse, welches durch ein bestimmtes politökonomisches System reproduziert wird. Ein Beispiel dafür ist, wenn eine Arbeit als unzureichend bezahlt empfunden wird und sie dadurch auch gesellschaftlich nicht wertgeschätzt wird (vgl. Barone 1999, 7 u. 26). Barone geht davon aus, dass Kapitalismus an sich bereits klassistisch, bzw. dass Antiklassismus antikapitalistisch sei (vgl. Barone 1999, 11).
Mesoebene: Auf dieser Ebene geht es um die Unterdrückung einer Schicht auf Gruppenebene durch das Übernehmen von negativen Vorurteilen gegenüber Angehörigen einer „niedrigeren“ Klasse, u. a. mit Unterstützung von Social Media. Ein antiklassistischer Akt wäre die Forderung nach einer kritischeren Medienarbeit.
Mikroebene: Die Ebene beschäftigt sich mit der Unterdrückung auf Einzelebene durch individuelle Einstellungen, Identitäten und Interaktionen (vgl. Barone 1999, 9). Dagegen könnten in pädagogischen Räumen Anti-Klassismus-Trainings analog zu den AntiRassismus-Trainings helfen, um individuelle klassistische Einstellungen zu überwinden (vgl. ebd.).
Klassismustheorien sind im deutschsprachigen Raum bisher kaum verbreitet, da im europäischen Diskurs vor allem die Begriffe Kapitalsorten, Habitus und symbolische Gewalt, die Pierre Bourdieu geprägt hat, eine Rolle spielen (vgl. Seidel 2017).
In Hinblick auf die Ausarbeitung ist nun ein Fundament geschaffen worden, was unter Klassismus verstanden wird. Im fortlaufenden Abschnitt soll nun analysiert werden, inwieweit explizit bei Partnerwahlen dieses klassistische Denken verankert ist.
3. Sozialstrukturelle, evolutionspsychologische und familienökonomische Erklärungsansätze
Ob Klassismus bei der Partnerwahl eine Rolle spielt, sollte beantwortet werden können, wenn sehr differenziert analysiert werden kann, wie Partnerschaften eigentlich zustande kommen. Bei der Partnerwahl handelt es sich um die Auswahl einer anderen Person für eine Partnerschaft. Allerdings stellen sie einen so umfangreichen Vorgang dar, dass auch die Art seiner Erforschung, große Hindernisse mitbringen: So ist es für viele Menschen in einer Partnerschaft kompliziert, konkrete Charakteristika zu deklarieren, die veranlassen, dass sie ihre Wahlperson lieben, da einige Merkmale auch unbewusst zustande kommen.
Grundsätzlich gibt es für Partnerwahlen zwei Hypothesen. Die Homogamie („Gleich und gleich gesellt sich gern“), die eine Ähnlichkeit hinsichtlich Nationalität, sozioökonomischem Status, Bildungsniveau, Alter, Ethnie und Religionszugehörigkeit, aber auch der physischen Merkmale postuliert und die Hypothese der Heterogamie („Gegensätze ziehen sich an“) (vgl. Spektrum 2000).
3.1. Der sozialstrukturelle Ansatz
Unter welchen Rahmenbedingungen sich Personen mit homogenen Eigenschaften (Homogamie) und heterogenen Eigenschaften (Heterogamie) zusammentun, versuchen sozialstrukturelle Studien, Modelle der Familienökonomik und psychologische Analysen herauszuarbeiten.Von großer Bedeutung für diese Ausarbeitung ist die Angabe, dass in der Bundesrepublik vorzugsweise in einer ähnlichen Berufsschicht geheiratet wird, was auch neuere Forschungen immer wieder bestätigen (vgl. Pappi 1976, 229; vgl. Mayer 1977, 207; vgl. Handl 1988, 112; vgl. Blossfeld/ Timm 2003). Während Ende 1950 etwa die Hälfte aller Männer und Frauen innerhalb der gleichen Schicht heiratete, sind es nun sogar 60 Prozent in der Bundesrepublik (vgl. Burow 2015). Insofern kann bereits eine Tendenz zum Klassismus gemutmaßt werden.
Thomas Klein (2000) geht davon aus, dass eine „weitverbreitete Homogamie“ auf dem Partnermarkt Grenzen setzt, wenn die Eigenschaften nicht gleichermaßen verteilt sind. Eine unterschiedliche Bildungsverteilung soll dabei in den älteren Generationen nicht unwesentlich zu dem traditionellen Bildungsgefälle zwischen Ehepartnern beigetragen haben. Unter dem Punkt „Homogamieregel“ wird veranschaulicht, dass bei einer ungleichen Bildungsverteilung unter der Annahme der Homogamieregel nur ein Teil der Bevölkerung zusammenkam, während der Rest ohne Partner bleibt oder zu „abweichendem Verhalten“ gezwungen ist. (vgl. Klein 2000, 231)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Realisierung eines moderneren, egalitären Familienbilds kann andererseits ebenfalls an Partnermarktgegebenheiten stoßen. In Bezug auf individuelle Präferenzen wird im Rahmen der Wettbewerbsthese weit häufiger unterstellt, dass alle einen möglichst attraktiven Partner bzw. eine möglichst attraktive Partnerin suchen, mehr oder weniger unabhängig von der eigenen Attraktivität - die Familienökonomik spricht von einer Konkurrenz. Als Konsequenz dieses Marktprozesses haben Personen mit gleicher Attraktivität die größte Chance auf eine Partnerschaft. Bei unterschiedlicher Verteilung (z. B. unterschiedlicher Bildungsverteilung) wird deutlich, dass im Grunde nicht der Ausgleich der absoluten Attraktivität, sondern der der relativen Attraktivität auf dem Heiratsmarkt ausschlaggebend ist. So finde der relativ attraktivste Mann die relativ attraktivste Frau, der Zweitattraktivste die Zweitattraktivste usw., selbst wenn sich jeweils in der Partnerschaft die Attraktivität der Partner deutlich unterscheidet. Dieses Zusammenwirken von Heiratsmarktrestriktionen mit individuellen Präferenzen ist auch in Abbildung unter „Maximierungsmotiv“ berücksichtigt. (vgl. Klein 2000, 232)
In den Neunzigern wurde dieses Partnerschaftsmodell allerdings durch einen handlungstheoretischer Erklärungsansatz reformiert, welcher den Verzicht auf Partnerschaft und den gestiegenen Akademisierungsgrad von Frauen mitberücksichtigt. Auf den Partnermarkt hat dies erhebliche Auswirkungen: Ein freiwilliger oder unfreiwilliger Verzicht auf Partnerschaft hängt von den Merkmalen ab, an denen sich die Partnerwahl orientiert. In Bezug auf die sozialstrukturelle Partnerwahl geht das Modell davon aus, dass besser gebildete, erwerbstätige Frauen tendenziell eher keine Partnerschaft eingehen, weil sie von dem alten Marktmechanismus wenig profitieren. Nach dem Modell würde folglich „der Markt an Männer eines höheren sozialen Status“ deutlich geringer sein, was längerfrisitg dafür sorgt, dass in derselben Schicht geheiratet wird. Diese Verengung des Heiratsmarkts ist in der Abbildung unter dem Stichpunkt „Freiwillige Partnerlosigkeit“ illustriert (vgl. ebd.).
Klein geht davon aus, dass im Laufe des Alters es zu einer Verringerung der homogamen Sozialstruktur kommt. Als Begründung wird angeführt, dass sich auch der Partnermarkt mit zunehmendem Lebensalter verändere, da mit zunehmendem Alter eine wachsende Zahl potentieller Partnerinnen in demselben Altersbereich bereits in einer stabilen Partnerschaft gebunden ist. Er prognostiziert, dass der homogam gesuchte Partner entweder schon vergeben ist oder so selten wurde, dass er über geographische Distanzen und andere Hindernisse hinweg kaum noch kennenzulernen ist. (vgl. Klein 2000, 233)
Im Falle einer homogamistischen Einstellung wird eine Verkleinerung des Partnermarkts als eine „Verschlechterung“ betrachtet, da entweder diejenigen mit einer geringen Bindungsneigung auf dem Markt übrig blieben oder diejenigen, die keiner (mehr) haben wollte (vgl. Klein 2000, 233f.). Gerade weil in dieser Theorie eine „Verschlechterung“ postulliert wird, vermutet sie klassistische Entscheidungsmuster bei der Partnerwahl.
Dass mehr Leute als früher im transatlantischen Raum in einer Schicht heiraten, könnte auf ein Homogamiegleichgewicht hinweisen, bei dem lediglich ein minimaler Männerüberschuss unvermittelt bleibt (vgl. ebd.; vgl. Rüffer/ Klein 1999, 43; vgl. Burow 2015). Diese Vermutung wurde bereits im Jahr 2000 aufgenommen. Jedoch lässt sich bis jetzt eine neue Form des Ungleichgewichtes am Partnermarkt feststellen, da seit 2017 bei den 30 bis 34-Jährigen erstmals mehr Frauen (30%) als Männer (27%) Hochschulabschlüsse erwarben und mit steigender Tendenz daher auch mehr prestigeträchtige Berufe ergreifen (vgl. Statistisches Bundesamt 2017). Es ist annehmbar, dass im Falle dieser Umkehr mehr Frauen aus höher deklarierten Berufsständen allein bleiben werden. Wissenschaftliche Ausarbeitungen können im Laufe dieses Jahrzehnts klären, ob der Homogamitäts-Mythos weiterhin Bestand haben wird oder die Partnerwahl zukünftig anders erklärt werden kann. In Mittel- und Lateinamerika beispielsweise entwickeln sich Partnerwahlen immer unabhängiger von Berufstand und Bildungsgleichheit (Palos/ Cebré/ Lopez-Ruiz 2009, 33f.). Lateinamerika galt einst als Hochburg für schichthomogame Partnerwahlen. 88 Prozent in Mexiko aller Geheirateten in Mexiko hatten 1970 ungefähr eine ähnliche Berufsausbildung. Doch bis zur Jahrtausendwende veränderten sich die Partnerschaften enorm. Einerseits liegt die Homogamitätsquote unter der deutschen, andererseits gibt es jetzt Staaten, in denen innerhalb der Partnerschaft eher Frauen die bessere Ausbildung besitzen, als umgekehrt. Dies ist in Kolumbien, Argentinien und Brasilien der Fall.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Verteilung der Partnerwahlen nach dem Grad der Homogamie in Prozent im Jahr 2000 (1970)
Die Gründe für diesen Unterschied lassen sich unter Berücksichtigung der soziopolitischen Gegebenheiten erklären. Es wird davon ausgegangen, dass das Bildungsgefälle in Lateinamerika sich immer mehr verringert (vgl. Palos et al. 2009, 36). Zudem lassen sich in vielen lateinamerikanischen Staaten antikapitalistische Grundwerteausrichtungen erkennen, welche eine viel kollektivistischere Denkweise über den Menschen haben, zum anderen ist der Klassismus fester Bestandteil in den Lehrplänen und wird evaluiert (vgl. Domingues 2017, 39f.; vgl. Ocampo/ Lopez 2019, 49). Somit ist das Phänomen eines Anstiegs von berufshomogamen Partnerschaften kein internationales, sondern ein vornehmlich westliches.
3.2. Der evolutionärpsychologische Ansatz
Immer wieder kann man in der jüngeren Literatur der Evolutionären Psychologie nachlesen, dass Männer sich bei der Partnersuche eher an physischer Attraktivität orientieren, Frauen eher am sozialen Status (vgl. Bischoff 2018).
Die Studien beziehen sich auf evolutionspsychologische Modelle, die Buss und Barnes (1986) initiierten. Nach dem Ansatz sei das Grundziel bei einer Partnerwahl die Maximierung des Reproduktionserfolgs, wodurch sich unterschiedliche Strategien bei der Suche verfolgen. Männer würden nach diesem Ansatz mehr Nachkommen zeugen wollen und daher möglichst promiskuitiv sein, während Frauen hingegen weniger promiskuitiv wären und für den maximalen Reproduktionserfolg eher darauf bedacht sind, einen Partner zu finden, der die Frau und die gemeinsamen Nachkommen möglichst gut unterstützen kann (vgl. Buss/ Barnes 1986, 564). Aus diesem Grund sollten Frauen diesem Ansatz nach bei der Partnerwahl auf den sozialen Status ihres Partners fokussiert sein (vgl. Franzen/Hartmann 2001, 203f.). Männer achten demnach auf die Attraktivität, die sie über ihren sozialen Status eintauschen, weswegen auch von der Austauschtheorie gesprochen wird (vgl. Hakim 2010, 504).
Genau dieser Ansatz entspricht dem sozialstrukturierten Partnerwahlsmodell der freiwilligen Partnerlosigkeit, die auch bei Klein (2000) vorzufinden ist.
Kritisch muss angemerkt werden, dass die Präferenzprofile nicht pauschalisierend für Geschlechterbeuteschemen angenommen werden sollten, da innerhalb der Studie mögliche patriarchale Gesellschaftsstrukturen eingewirkt haben. Buss und Barnes (1986) weisen sogar ausdrücklich darauf hin, dass ihre Studie auf der Annahme basiert, dass Frauen typischerweise von Macht ausgeschlossen sind und daher als Objekte des Austauschs angesehen werden und sie aufgrund ihrer eingeschränkten Wege, Partner mit Macht verbundenen Merkmale wie Erwerbsfähigkeit und Hochschulbildung finden wollen (vgl. Buss/ Barnes 1986, 579). In Folgestudien wird deutlich gemacht, dass Partnerwahl-Präferenzen vom Grad der Geschlechtergleichstellung einer Gesellschaft abhängen (vgl. Eagly/ Wood 1999, 415; vgl. McClintock 2014, 575; vgl. Ruck 2014, 250).
3.3. Der familienökonomische Ansatz
Der Nobelpreisträger Gary S. Becker vertritt ein mikroökonomisches Partnerschaftsmodell auf soziale Sachverhalte. Er ist der Ansicht, dass alles menschliche Verhalten anhand eines allgemeinen ökonomischen Ansatzes untersucht werden kann und versucht so zu erklären, wie Partnerentscheidungen zustande kommen (vgl. Becker 1981, 7).
Laut Beckers Theorie (1981) müssten zwei Grundprinzipien für eine Partner- oder Heiratsentscheidung erfüllt sein:
1. Jeder Mensch versucht sein bestes Gegenstück zu bekommen. Aus diesem Grund wird die Partnersuche wie ein Wettbewerb behandelt (Wirth 2000, 32). Dieser Markt bezeichnet Becker als Heiratsmarkt (vgl. Becker 1981, 226).
2. Wenn beide ein höheres Nutzenniveau erhalten als vom Alleinleben, kann eine gemeinsame Haushaltsführung (Heirat, nichteheliche Lebensgemeinschaft...) entstehen.
Menschen sind nach Becker rationale Akteure, die nach einer Maximierung ihres Nutzens streben. Nach dem Modell tritt man folglich nur in eine Beziehung ein, wenn sie durch eine Zusammenlegung ihrer persönlichen Ressourcen effizient einen so genannten Mehrwert produzieren können. (vgl. Becker 1982, 228f.)
In Partnerschaften, die nach dem ökonomischen Ansatz nach Becker als Produktionsgemeinschaften betrachtet werden, sind „ commodities “ Güter oder Leistungen, die der Befriedigung von Wohlfahrtsbedürfnissen dienen, die jedoch nicht am Markt erworben, sondern nur innerhalb von Partnerschaften produziert werden können (Huinink/Konietzka 2007, 131). Für eine effektive Produktion dieser Güter ist es notwendig, dass sich Personen zu Paaren verbinden (vgl. Becker 1981, 228f.). Obwohl auch Becker tendenziell davon ausgeht, dass Charaktereigenschaften weitgehend komplementär sind, vermutet er, dass nur diejenigen in eine Partnerschaft eingehen, bei denen es durch die Zusammenlegung zweier gegensätzlicher Eigenschaften zu einer positiven Korrelation kommt (vgl. Becker 1981, 235).
Vorteilhafte Wechselbeziehungen seien in den Bereichen Intelligenz, Erziehung, Alter, Ethnie, monetaristischer Reichtum, Herkunftsland, Größe und körperliche Attraktivität entscheidend (vgl. Becker 1981, 117). Je höher die Nutzenmaximierung, desto zufriedener ist die Partnerschaft und je niedriger der Nutzen, desto unzufriedener werden die Ehepartner und desto höher wird das Risiko einer Trennung (Nave-Herz 2004, 170).
Der ökonomische Ansatz tritt allerdings auf eine wirtschaftliche Berechnungsgrenze, da Priosierungen zwischen zwei Menschen stets voneinander abweichen können. Wenn in einer Beziehung Bereiche völlig bedeutungslos erachtet werden, spielt eine Abweichung oder Übereinstimmung keine Rolle auf die Beziehung. Die individuelle Wertermittlung hängt jedoch stets von den Bindungserfahrungen innerhalb der eigenen Familienhistorie ab (vgl. Wunderlich 2012, 47). Die Erfahrungen aus dem Eheleben der Eltern sowie Erfahrungen und vermitteltes Wissen in Schule und früher Berufskarriere beeinflussen die Erwartungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an die Ehe und ihren zukünftigen Partner (Frenzel 1995, 63).
4. Klassistische Diskriminierung in der Partnerwahl
4.1. Diskriminierung
Alltagsprachlich wird unter Diskriminierung ein abwertendes Sprechen und benachteiligendes Handeln verstanden, dem negative Emotionen und Stereotype zu Grunde liegen (Scherr 2016, 2). In der Soziologie dagegen wird Diskriminierung, im Gegensatz zur Sozialpsychologie, als ein genuin soziales Phänomen in den Blick genommen, das nur dann angemessen verstanden werden kann, wenn nicht nur Vorurteile und ihre Verbreitung als Ursache in den Blick genommen werden, sondern auch darüber hinaus reichende gesellschaftliche, strukturelle oder organisationelle Kontexte berücksichtigt werden (vgl. Feagin/ Eckberg 1980, 4).
Erst mit einer Erweiterung des Verständnisses von Diskriminierung kann deutlich gemacht werden, dass die Entstehung, Verbreitung und Bedeutung diskriminierender Einstellungen und Praktiken nur dann zureichend verstanden werden kann, wenn die Zusammenhänge mit gesamtgesellschaftlichen Strukturbildungen sowie mit Formen der Diskriminierung berücksichtigt werden, die in die Strukturen von Organisationen und Institutionen eingeschrieben sind. Dabei hat die soziologische Forschung zu berücksichtigen, dass bedeutsame Formen von Diskriminierung, wie der Klassismus, sich über lange Zeiträume hin entwickelt und verfestigt hat (vgl. Halfdanarson/ Vilhelmssson 2016, 33f.).
4.2. Folgen Rassistischer Diskriminierung
Im zweiten und dritten Kapitel wurden bereits Elemente aufgezeigt, die Klassismus innerhalb der Partnerwahl begünstigen. In diesem Kapitelabschnitt sollen die Folgen davon veröffentlicht werden, indem auch die Art der Diskriminierung angesprchen wird. Es ist bislang ein völlig neues Forschungsfeld, klassistische Diskriminierungsweisen bei Partnerwahlen darzustellen. Aus diesem Grund muss sich an Maßstäben der Diskriminierungsforschung bedient werden, welche konkretisieren, ab wann von Diskriminierung unter dem Motiv des Klassismus gesprochen werden kann. In Bezug auf die Partnerwahl müssen auch mehrere Grundsätze miteinfließen: Es gibt nach Menschenrecht eine gültige freie Wahl des Partners, welche eine freie und uneingeschränkte Willenseinigung beinhaltet (vgl. Vereinte Nationen 1948). Insofern sollte darauf hingewiesen werden, dass mitnichten ein Anspruch auf eine Partnerschaft erzeugt werden kann, allerdings ist der Prozess der Partnerwahl kein rechtsfreier Raum: Im Grundgesetz (GG) ist verankert, dass niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden darf (vgl. Art. 3 Absatz 3 GG). Unter Berücksichtigung der Familienökonomik, welche die Partnerwahl als Produktionsgemeinschaft von gemeinsamen immateriellen Güter und Leistungen betrachtet, soll zugespitzt werden, ob eine Ablehnung eines Partnergesuchs anhand von klassistischer Merkmale diskriminierend sei.
Wenn die Abfuhr des Partners aufgrund eines Nichtentsprechens einer gewünschten Klasse erfolgt, handelt es sich um eine sozial diskriminierende Praxis auf Mesoebene nach Barone, da einem Angehörigen der vermuteten Klasse stereotype Interessen zugeschrieben werden (vgl. Barone 1999, 11). Manchmal erfolgt der Klassismus auch unbewusst, in welcher lediglich Interessensungleichheit als Demarkationspunkt vorgeschoben wird. Aus diesem Grund wird die Hypothese vertreten, dass Ablehnungen von Partner, unabhängig ob vor, während oder zum Abschließen einer Beziehung, diskriminieren können. Zugleich soll nicht unterschlagen werden, dass sich eine Trennung aufgrund von Charaktereigenschaften nicht immer auf ein stereotypes klassistisches Weltbild beziehen muss, sondern auch unabhängig davon erfolgen kann.
4.2.1. Individuelle Folgen der Diskriminierung
Wie stark individuelle Folgen einer Diskriminierung vom Ablehnungszeitpunkt abhängen, kann aufgrund einer marginalen Forschungslage nicht eingeschätzt werden. Allerdings lassen sich die Folgen mit dem Wissen über Klassismusdiskriminierung und psychoanalytischen und paarherapeutischen Forschungen nachvollziehen.
Bricht eine Partnerschaft ab, breiten sich zunächst Trennungsschmerzen aus, in denen sich alle oftmals gekränkt und abgewertet fühlen. Die Leidenden entwickeln Scham- und Schuldgefühle aufgrund des irrationalen Verhaltens ihres Partners (vgl. Willi 1991, 124f.). Spielten bei der Trennung klassistische Gründe eine Rolle, speziell nach einer lang dauernden Partnerschaft, wird dies jede neue Beziehung aufgrund der vorangegangenen Diskriminierungserfahrungen stärker belasten, da Trennungen mit ihren damit einhergehenden Enttäuschungen das gesamte Leben prägen und beeinflussen (vgl. Willi 1991, 127f.). Es wurde tiefergehend erforscht, dass Menschen, denen eine vermeintlich niedrige Klasse attestiert wurde, ein Traumatrigger und ein negatives Selbstkonzept erwerben können (vgl. Dörre/ Scherschel/ Booth/ Haubner/ Marquardsen/ Schierhorn 2013, 198). Diese können eine Problem- und Blockadenspirale herbeiführen und die Situation, sowohl beruflich als auch partnerschaftlich, prekärer machen (vgl. ebd.; vgl. Dackweiler/ Rau/ Schäfer 2020, 111). Erlebte klassistische Diskriminierungserfahrungen sind durch wiederkehrende Muster charakterisiert, z.B. durch mangelnde Unterstützung, häufige Abwertung oder durch das belastende Gefühl vieler Menschen, „dass sie nicht zurückkönnen“, im Fall eines sozialen Aufstiegs (vgl. Meulenbelt 1988, 85-99). Des Weiteren suggiert die Abwertungstendenz auch eine tatsächliche Klassenexistenz, welche politische Sprengkraft besitzt. So wird die Einschätzung geteilt, dass „die Folgen dieser jahrzehnte- und jahrhundertelang den Arbeitern und Arbeiterkindern einsoufflierten Minderwertigkeit“ in Aggressionen übergehen könnte (vgl. Glawion 2019, 62).
Obwohl es durchaus soziologische oder evolutionärpsychologische Erklärungsansätze für Partnertrennungen mit Klassenmotiv gibt, hält die Psychoanalyse besonders bei längeren Beziehungen auch projektives Verhalten für möglich. Es kann durchaus auch angenommen werden, dass Minderwertigkeitsgefühle in anderen Bereichen oder das Verfolgen eigener Wünsche im anderen, eine Trennung auslösen (vgl. Willi 1988, 167). Klassistische, sexistische oder rassistische Gründe würden so nur als Vorwand benutzt werden. Es gibt Phasen innerhalb der Beziehung, in denen die intra- und interindividuellen Balanceabweichungen groß werden, besonders in der konfliktintensiven zweiten und dritten Phase einer Beziehung nach Roland Weber (2014). Dies zeigt sich daran, dass niemand klein beigeben will, man sicher ist, den falschen Partner erwischt zu haben und negative Eigenschaften beim Gegenüber gefunden werden. Werden diese Abweichungen zu groß, kann es zu einer innerpsychischen Abspaltung kommen, wo alle mit dem wertidentischen Bewusstsein nicht übereinstimmende Inhalte auf eine Person übertragen wird (vgl. Weber 2014).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Beziehungsphasenmodell nach Weber (2014)
Doch sebst wenn ein klassistisches Trennngsmotiv aus psychoanalytischer Perspektive nur ein Vorwandsmotiv für Projektion wäre, kann ein solches die obengenannten Probleme auf der Gegenseite hinterlassen.
4.2.2. Gesellschaftliche Folgen der Diskriminierung
Interindividuelle Folgen können sich auch direkt auf die Gesellschaft auswirken. Wenn Klassismus als Trennungsmotiv gewählt wird, droht downward classism postwendend upward classism auszulösen, was für die Verfestigung von klassistischen Vorurteile sorgt. Die Diskriminierung kann folglich einen selbsterhaltenden Charakter aufweisen (vgl. Scherr 2016, 3). Denn die Folgen von Diskriminierung in der Vergangenheit können zu bestimmten sozialen Verhältnissen oder in diesem Fall zu Partnerwahlen als Teil der Gesellschaftsordnung führen, welche Benachteiligungen, Bildungsungleichheiten, Festlegungen auf bestimmte berufliche Positionen wahrscheinlicher machen (vgl. ebd.). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die gesellschaftlich sichtbaren Auswirkungen von Diskriminierung nicht als Folge sozialer Strukturen und Prozesse analysiert, sondern lediglich als Ausdruck der vermeintlich typischen Eigenschaften einer diskriminierten Minderheit interpretiert werden, was zu einer Bestätigung von eingespielten Praktiken und Stereotypen führt (vgl. ebd.). Diese Aufrechterhaltung kann nach der Intersektionalitätstheorie dazu führen, dass auch Sexismus und Rassismus in der Gesellschaft ineinandergreifen. Es kommt zu einer Verinnerlichung und Anerkennung von Aberkennungsstrukturen zugunsten einer eigenen subjektiven Aufwertung und Abgrenzung von nicht gewünschten Lebensperspektiven und Coping mit Entwertungsgefühlen (Kemper/ Weinbach 2016, 51). Nach Weinbach (2020) überlagere die tief sexistische Verankerung in klassistischen und rassistischen Stereotypen die reale Situation der von Armut betroffenen Frauen und die Verantwortung von Männer (vgl. Weinbach 2020, 117). Durch die Inanspruchnahme von Stigmatisierungspraktiken behauptet sich die patriarchale Struktur einer Gesellschaft und kann dadurch reproduziert werden (vgl. Weinbach 2020, 118).
In den meisten Gesellschaften lässt sich deshalb immer noch beobachten, dass Männer und Frauen unterschiedliche Status einnehmen (Ridgeway/ Bourg 2004, 231). Allgemein finden sich Statusüberzeugungen, die einer Gruppe mehr Bedeutung, mehr Kompetenz oder mehr spezifische Fähigkeiten zuschreibt. Viele dieser gesellschaftlich konstruierten Statusüberzeugungen legitimieren die Statusungleichheit dieser Gruppen. Männern wird mehr Kompetenz im Zusammenhang von beruflichen und technischen Problemen zugeschrieben, während Frauen mehr Kompetenz bei Beziehungsproblemen und Haushaltsvorgaben übertragen wird. (vgl. Athenstaedt/ Alfermann 2011, 20)
Auffällig ist, dass die Zuschreibungen warmherzig und expressiv als „statusniedrig“ beschrieben werden, während kompetent und ehrgeizig als „statushöher“ angesehen wird (vgl. Conway/ Pizzamiglio/ Mount 1996, 30). Prentice und Carranza (2002) gehen davon aus, dass diese Geschlechterstereotypen die Gesellschaftsstruktur aufrechterhalten, es aber die Interaktion zwischen den beiden Geschlechtern erleichtern könne. Jedoch kann ebenso der Nebeneffekt auftreten, dass durch eine Korrespondenzverzerrung geschlechterunabhängig Klassismus ausgelöst wird. Kein Geschlecht mag sich in die statusniedrigeren Muster drängen, weshalb statusniedrig angesehene interpersonelle Talente wie Expressivität strategisch unterdrückt werden, um als „höherklassig“ zu gelten (vgl. Kuche 2019, 2). Dies führt zu einer fortschreitenden Entwertung von sozial-emotionaler Fähigkeiten, deren Auswirkungen sich in mehreren Bereichen widerspiegeln: Systemrelevante soziale Berufe sind gering bezahlt, werden in der Bundesrepublik weitgehend von Frauen ausgeführt und haben viele offenen Stellen aufgrund seiner hohen Belastbarkeitsrate (vgl. Hipp/ Kelle 2016, 17; vgl. Dathe/ Paul/ Stuth 2012, 4). Da so Klassismus auf Makroebene verfestigt wird, treffen an dieser Stelle die Befürchtungen der Intersektionalitätstheorie zu. Über die Auswirkung von sozial-emotionalen Entwertungstendenzen auf die Partnerwahl, wird im fünften Kapitel noch eingegangen.
Warum das Überlegenheitsdenken überhaupt noch eine Rolle spielen kann, lässt sich soziologisch mit Abstiegsängsten erklären (vgl. Lengfeld/ Hirschle 2009, 394). Ausgelöst werden die Ängste durch Flexibilisierungsmaßnahmen, höhere Berufserwartungen, das Ausbleiben eines progressiven Grundsicherungssystems in Deutschland und das Wissen über Systemschwächen, die für ökonomische und soziale Benachteiligungen führen (vgl. Lengfeld/ Hirschle 2009, 394; vgl. Bude 2014, 27; Raske 2017, 32). Darüber hinaus wird angenommen, dass die eigenen Ängste sich auf die Partnerwahlen übertragen und so sich Gesellschaftswidersprüche in Beziehungskonflikte übertragen.
Gestiegene Trennungsraten in Partnerschaften und schlechte Erfahrungen mit der eigenen Familienbiographie haben selbstverständlich auch einen Einfluss darauf, dass das Vertrauen in Partnerschaften geringer wird. Diese Entwicklung könnte durch eine zunehmende Berufsattribuierung verstärkt werden, wodurch weniger Möglichkeiten gegeben werden, in berufsexternen Bereich einen Partner zu finden. Damit erhöht sich abermals die Wahrscheinlichkeit, dass weiterhin am herkömmlichen Familienbild festgehalten wird, in welchem Männer von Frauen in Bezug auf die Haushaltsstruktur abhängig sind und die Kinder erziehen, während Frauen von ihren Männern beschützt und ernährt werden (vgl. Weinbach 2020, 112f.; vgl. Halfdanarson/ Vilhelmssson 2016, 33f.).
Für Paare, die aus diesem System ausbrechen wollen, steigt der gesellschaftliche Druck, es anders zu machen. Partnerschaften könnten davor zurückgehalten werden, ihr gemeinsames Lebenskonzept auszuleben, wenn eine Person aufgrund von Abstiegsängsten problematisiert, dass es der Mehrheitsmeinung widerspricht - was in der Konsequenz besondere, nicht dem Mehrheitssystem entsprechende Lebenskonzepte immer mehr zurückdränge. Dieser Effekt kann durch die Rolle der Medien als Gatekeeper verstärkt werden. (vgl. Noelle- Neumann 1980, 145)
Eine Zunahme dieser intersektionalen Struktur kann dazu beitragen, dass es nicht nur auf individueller Ebene, sondern gesamtgesellschaftlich zu Radikalisierungen kommen kann (vgl. Beck 2008, 318).
5. Sozialpsychologische Erklärungsansätze
Gäbe es eine Allzweckerklärung, wie die Partnerwahl funktioniert, würden wohl kaum so viele Gespräche über die Liebe geführt werden.
Das Spannungsfeld zwischen sozialstrukturellen und psychoanalytischen Partnerwahlen soll durch Erklärungsansätze aus der Sozialpsychologie ergänzt werden. Eine über alle Fachdisziplinen übergreifende Analyse soll die These „Durch Klassendenken zur großen Liebe“ besser beleuchten. Damit soll deutlich gemacht werden, dass Partnerwahlen eben nicht nur anhand von Voraussetzungen, Abläufe und Folgen im gesamtgesellschaftlichen Gefüge erklärt werden können, sondern dass die Auswirkungen sozialer Interaktionen auf die Gedanken, die Gefühle und das Verhalten auf das Individuum mitberücksichtigt werden müssen. Deshalb werden im folgenden Abschnitt sozialpsychologische Kernelemente aufgezeigt, die für Partnerwahlen relevant sind.
5.1. Räumliche und physische Nähe
Es kann davon ausgangen werden, dass sich Personen nicht zufällig begegnen, sondern das sozial strukturierte Gelegenheiten die Häufigkeit des Treffens sich ähnelnder Personen bestimmen. Räumliche Nähe entwickelt sich so zu einem wesentlichen Faktor bei der Partnerwahl. Der Soziologe James Bossard stellte fest, dass 30 Prozent der befragten Ehepaare vor ihrem Kennenlernen bloß einen Hausblock oder weniger voneinander entfernt gewohnt hatten (vgl. Bossard 1932, 221f.). Nur 18 Prozent heirateten jemanden von außerhalb der Stadt (vgl. ebd.). Nach der sogenannten Fokustheorie finden Partnerwahlen nicht in abstrakten sozialen Räumen statt, sondern die sozialen Aktionsräume sind eher recht klein (vgl. Hill/ Kopp 2013, 165). Besonders in der Phase des Kennenlernens spielen nach Feld (1981) die Aspekte der sozialen Umgebung eine Rolle, um die herum gemeinsame soziale Aktivitäten organisiert werden.
„A focus is defined as a social, psychological, legal, or physical entity around which joint activities are organized“ (Feld, 1981, 1016).
Partnerschaften können bei gemeinschaftlichen Aktivitäten entstehen, z.B. über politisches (NGO, Partei, Gewerkschaft, AStA, Jugendrat,...), sportliches, soziales, kulturelles Engagement oder über gemeinsame Aktivitäten zwischen Familien. Die Frage, wie viel Zeit man für welche Aktivität investiert, beeinflusst das Partnerwahlverhalten und soll es so vorstrukturieren.
Werden häufiger die gemeinsamen sozialen Interaktionen positiv bewertet, umso wahrscheinlicher werden sie positive Gefühle füreinander entwickeln (vgl. Bossard 1932, 223f.; vgl. Feld 1981, 1026). Somit kann räumliche Nähe jemanden automatisch sympathischer machen, da mit den Personen häufiger diskutiert wird und, wie aus der Kontakthypothese hervorgeht, (klassistische) Vorurteile abgebaut werden (vgl. Bossard 1932, 223.; vgl. Allports 1954). Diese Umstände benachteiligen Fernbeziehungen, welche sowieso schon zeitlich durch das Pendeln herausfordernd sein können, schwerwiegend, da geringerer Kontakt Vorurteile aufbauen kann. Die Distanz wird dabei von multilokal lebenden Personen im Vergleich zu lokal verwurzelten Personen eher akzeptiert (Rüger/ Schier/ Feldhaus/ Ries 2014, 135). Die räumliche Trennung zwischen Partnern, Familienmitgliedern oder Generationen konnte sich bisher allerdings nur in wenigen Regionen in Europa und den USA durchsetzen, auf anderen Kontinenten gibt es dieses Phänomen viel seltener, auch weil es kaum akzeptiert bzw. gewünscht ist (Hank 2009; Reher 1998, 226).
Innerhalb der Beziehung spielt die physische Nähe ebenfalls eine signifikante Rolle. Das Sexualverhalten zählt dabei als physiologisches Grundbedürfnis beider Geschlechter (vgl. Maslow 1943, 381). Es gibt eine Korrelation, dass Sex die Beziehungszufriedenheit steigern kann (vgl. Fischbach/Bartsch/Rietzsch 2017, 62f.). Paare, die mehrmals pro Woche Geschlechtsverkehr haben, geben zu 95 Prozent an, zufrieden zu sein (vgl. Fischbach et al. 2017, 63). Der Akt, miteinander zu schlafen, sagt aber per se nichts über die Qualität einer Beziehung aus. Aus Forschungen der Soziobiologie und der Primatengenetik wurde bekannt, dass der damit verbundene Körpergeruch Informationen über Partnerqualitäten weitergeben kann, welche das Sexualverhalten des Partners steuert und Signale über eine mögliche Partnerwahl aussenden (vgl. Fink 2006, 738). Solche genetischen Faktoren beeinflussen unbewusst Partnerwahlen, die Größe seines Gewichts wird aber insbesondere bei einer künstlichen Überdeckung von Duftstoffen und Pflegeprodukten als klein betrachtet (vgl. ebd.). Und trotzdem zeigt sich auf diese Weise, dass auch interne Faktoren eine Rolle für Liebesbeziehungen spielen können.
5.2. Werte und Einstellungen
Werte und Grundeinstellungen spielen nach der Sozialpsychologie bei Partnerschaften eine fundamentale Rolle: Mehrere Studien geben an, dass die Partnereigenschaften im Bereich der existenziellen Wertvorstellungen und sozialen Normen homogam sind (vgl. Bauer/Ganser 2006, 6). Wahrgenommene gemeinsame Werteorientierungen erleichtern den Rapport, die gegenseitige Offenheit und den emotionalen Austausch (Spektrum 2000). Zu den wichtigen Gemeinsamkeiten zählen die politischen Überzeugungen (vgl. Harris Interactive 2018; Burkart 2020, 8). Die politische Einstellung spiegelt sich häufig in den sozialen Werten wider und letztere haben einen sehr großen Einfluss auf die zukünftige Lebensgestaltung. Insofern könnten offenkundige rassistische, sexistische und klassistische Tendenzen schnell erkannt und mit den eigenen Einstellungen abgeglichen werden, jedoch können Einstellungen auch unbewusst weitergetragen werden, was gerade bei dem eher unbekannten Klassismus häufiger der Fall sein kann.
Im Bereich der Hobbys und Interessen gibt es unterschiedliche Haltungen, wie relevant sie für die Partnerwahl sind. Einerseits arbeitete die qualitative, jährlich erscheinende US-Studie „The Happiness Index - Love and Relationships in America“ heraus, dass Gemeinsamkeiten in diesem Bereich insbesondere in der Anfangsphase hilfreich sein können und die Beziehung stabilisieren können (vgl. Harris Interactive 2018). Es ist davon auszugehen, dass deswegen die meisten Online-Partnervermittlungsinstitute hobby- und interessenshomogame Konzepte nutzen. Studien aus dem europäischen Raum kommen dagegen zum Ergebnis, dass Gemeinsamkeiten in diesen Bereichen überschätzt sind (vgl. Schneewind/ Wunderer 2001; Benölken 2019, 174). Größere Übereinstimmungen als bei konkreten Hobbys finden sich bei gemeinsamen Werten. Es mache auch einen Unterschied, wann sich ein Paar kennenlernt: Paarberater gehen davon aus, dass sich im jungen Alter gemeinsame Aktivitäten erst noch im Laufe der Beziehung entwickeln (vgl. Dignös 2015, 11). Vor allem zukünftige Lebensprojekte können eine Beziehung stabilisieren, z.B. der Entschluss, Kinder zu bekommen oder die Entwicklung eines gemeinsamen Haushaltes (ebd.). Es lassen sich auch diametrale Studienergebnisse finden, welche nahelegen, dass bei der Partnerwahl speziell bei den Interessen und Hobbies Unterschiede gesucht werden (Winch 1954; Reiss 2000).
Die Komplementaritätshypothese nach Winch (1954) geht davon aus, dass Personen bei ihrer Partnerwahl bewusst oder unbewusst Merkmale suchen, die sie selber nicht besitzen. Somit finden sich hier in ihren charakterlichen Eigenschaften und sozialstrukturellen Merkmalen sehr gegensätzliche Paare (Nave- Herz 2013, 135). Falls man einen Partner mit möglichst komplementären Eigenschaften findet, müsste sich eine maximale Befriedigung der Bedürfnisse beider Partner erreichen lassen. Winch spricht hierbei auch von einer Partnersuche nach der Person, die das größte Versprechen gibt, ihm oder ihr die größtmögliche Befriedigung zu bieten (vgl. Winch 1954). Aus diesem Grund wird die Hypothese auch Need- Complementary-Theory genannt (vgl. Nave-Herz 2013, 135). Dieser klar erkennbare ökonomische Ansatz kann damit begründet werden, dass durch die Unterschiedlichkeit kreatives Lernen gefördert werden kann, da die Partnerschaft Synergieeffekte freisetzt (vgl. Burow 2015). Statt es als Ablehnung zu empfinden, wenn der oder die Liebste das gleiche Hobby nicht teilen will, sollten ungleiche Talente und Interessensneigungen als Chance gesehen werden (Dignös 2015, 11). Sie können fachliche und soziale Defizite aufarbeiten, sich gegenseitig herausfordern, ergänzen und beide zu Höchstleistung anspornen (vgl. Burow 2000, 17).
Eine Psychologie-Forschergruppe der Universitäten Wellesley und Kansas gehen in ihrer 2016 getätigten Studie mit 1.500 Paaren davon aus, dass in Partnerschaften vor allem die Gemeinsamkeiten geteilt werden sollten, welche ihnen am Herzen liegen (vgl. Bahns/ Crandall/ Gillath/ Preacher 2017, 345f.). Personen mit sexueller Enthaltsamkeit werden demnach Schwierigkeiten mit Partner haben, die kopulativ sind. Hinzu kommt, dass Menschen sich von ihren Partnern kaum beeinflussen lassen, sodass Paare lernen müssen, mit bestehenden Dissonanzen effektiv umzugehen (vgl. ebd.). Dies gelingt allerdings offenbar nur in unterschiedlichem Maß (vgl. ebd.).
5.3. Ehrlichkeit und Konfliktbewältigung
Die Sozialpsychologie zeigt weitere Charaktereigenschaften auf, die für die Beziehungsstabilität entscheidend sind und welche ähnlich sein sollten, um Konfliktphasen in der Partnerschaft erfolgreich zu meistern. Während Gemeinsamkeiten in der Aufgeschlossenheit, Perfektionismus und Geselligkeit kaum etwas über die Chancen eines Paares aussagen, sind Ähnlichkeiten in der Empathie und Verletzlichkeit bedeutsam (vgl. Hudson/ Fraley 2014, 119).
Diese Bereiche sind für die Konfliktbewältigungsstrategie unabdingbar und werden bei extrem großer Konfliktquellen, wie z.B. unterschiedliche Bedürfnisse nach Nähe, genutzt (vgl. Dignös 2015, 11). Doch für die Möglichkeit einer Konfliktbewältigung ist die Ehrlichkeit Kernvoraussetzung, die zu echter Nähe führt, wenn beide Partner sich in ihren Bedürfnissen zeigen und kennenlernen (vgl. ebd.). Damit wird die Basis für offene Kommunikation gelegt, und indem sie ihre Gefühle, Ängste, Sorgen, Träume und Wut mitteilen, bereichert es die Beziehung (vgl. Harris Interactive 2018). Auch wenn zunächst Streit entsteht, sind ehrliche Paare auf lange Sicht gesehen meist die glücklicheren (vgl. ebd.). Wenn Gefühle verstellt werden oder keine Aussprache stattfindet, kann es zu einer Eskalation, im Worst-case- Szenario zu einer Trennung kommen, da die ganze Zeit eigene Impulse unterdrückt wurden (vgl. ebd.). Nach dem 2014 verstorbenen Stuttgarter Paartherapeuthen Roland Weber gebe es Beziehungsphasen zu durchlaufen, in denen gerade solche Macht-, Revier- und Konkurrenzkämpfe üblich seien (vgl. Weber 2014). In einer Partnerschaft gehe es darum, Konflikte gerade in so einer Phase auszutragen, zu überstehen und Wünsche des anderen nach Nähe und Distanz zu respektieren (vgl. ebd.; vgl. Nave-Herz 2013, 135). Wie bereits im vierten Kapitel angedeutet, kann die Entwertung von sozial-emotionalen Eigenschaften die Konfliktfähigkeit in Beziehungen senken, was unter anderem auf die klassistische Diskriminierungsweise zurückgeführt werden kann.
5.4. Bildung
Über die Bildungshomogamie zeigen sich in der Sozialpsychologie überraschende Abweichungen. Zwar zeigen jüngere Studien aus dem transatlantischen Raum ebenfalls wie in der Sozialstrukturtheorie, dass beide Geschlechter meist Partner bevorzugen, die ihnen in der Intelligenz gleichen (vgl. Gignac/ Zajenkowski 2019, 44). Tatsächlich aber sind Paare nicht glücklicher miteinander, wenn sie in IQ-Tests ähnlich abschneiden (vgl. ebd.). Auch ein IQ über der 110 ist grundsätzlich weniger erwünscht, da etwa 60 Prozent der Befragten sich sorgten, dann selbst nicht kompatibel zu sein, und 40 Prozent befürchten, dass es einem hochintelligenten Partner an sozialen Fertigkeiten mangeln könnte (vgl. Gelitz 2020). Die Studienautoren weisen darauf hin, dass viele die stereotype Vorstellung haben, dass außergewöhnlich intelligente Menschen unter zwischenmenschlichen Problemen leiden (vgl. ebd.). Geschlechterunabhängig spielt der IQ bei der Partnerwahl allerdings weniger eine Rolle als angenommen, sondern insbesondere die sogenannte emotionale Intelligenz, die auch EI bezeichnet wird (vgl. Gignac/ Callis 2020). Sie ist eine durch Erziehung erworbener Besitz einer reichen und differenzierten Gefühls-, Empathie- und Empfindungsfähigkeit und ist auch unter dem Wort „Herzensbildung“ bekannt (vgl. Goleman 2011, 55). Auch andere deutschsprachige wissenschaftliche Forschungen untersuchen den Gegenstand wie Liebertz (2014) mit der Form der pädagogischen Vermittlung und Döring-Seipel (2001) mit einer Diagnostizierbarkeit (vgl. Liebertz 2014; Otto/ Döring-Seipel/ Grebe/ Lantermann 2001, 181).
„Nicht angehäuftes Wissen ist das Gütekriterium für einen gebildeten Menschen. Er braucht darüber Schlüsselqualifikationen aus dem Reich des Herzens, der Emotionalität und der Menschenkenntnis“ (Liebertz 2014).
Für die Ausarbeitung ist diese Information deshalb so relevant, weil sie in den Klassismustheorien keine Berücksichtigung gefunden hat, jedoch einen erherblichen Anteil auf die Partnerwahl und deren Erfolgswahrscheinlichkeit besitzt. Menschen mit hoher EI lassen häufiger ihre Gefühle zu, wodurch sie auch die Zuschreibungen „expressiv“ und „warmherzig“ erhalten (vgl. Conway et al. 1996, 30). Dass solche Zuschreibungen als „statusniedrig“ angesehen werden, obwohl sie in Partnerschaften zum einen die Grundlage für eine offene und ehrliche Kommunikation legen, stellt einen signifikanten Widerspruch zur klassistischen Status- und Berufsorientierung bei der Partnerwahl dar. Es existiert das Paradoxon, dass herzensgebildete Menschen über ein klassistisches Statusdenken als minderwertig betrachtet werden, jedoch gleichzeitig mit ihrer emotionalen Intelligenz bestmögliche Krisenbewältigungsfähigkeiten für eine Partnerschaft mitbringen (vgl. Goleman 2020, 115f.; vgl. Hudson/ Fraley 2014, 119f.). In zahlreichen soziologischen Partnerwahlsstudien wurde bislang die Herzensbildung nicht eingebunden, bzw. stark vernachlässigt, da ihre Bedeutung für Partnerwahlen erst kürzlich nachgewiesen werden konnte. Über zukünftige Langzeitstudien könnte überprüft werden, ob sie die Kerndeterminate über die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Partnerwahl darstellt und so den, auf den transatlantischen Raum reduzierten, noch gültigen Partnerwahlerklärungsansatz der starren Berufs- und Bildungshomogamie ablöst. Im Falle einer Bestätigung ließe sich fast schon romantisch klingend sagen, dass bei der Partnerwahl „Herz vor Klasse“ entscheidet.
6. Fazit
Eine tiefreichende Beantwortung der Fragestellung, ob „Klassendenken zur großen Liebe“ führen kann, ist in der Ausarbeitung mithilfe soziolgischen, sozialpsychologischen, familienökonomischen und psychoanalytischen Merkmalen getätigt worden.
Die Hausarbeit konnte feststellen, dass es aus den Forschungen der Sozialpsychologie, der Familienökonomik, als auch aus den Sozialwissenschaften viele Faktoren gibt, welche die Partnerwahl beeinflussen und es sich bestätigen lässt, dass klassistische Faktoren bei Partnerwahlen eine ernstzunehmende Rolle spielen. Unterschiede im Bildungssystem können erklären, weswegen eine Ähnlichkeit von Bildung und Berufstand in mehreren lateinamerikanischen Staaten eine immer bedeutungslosere Rolle spielen, während im transatlantischen Raum berufshomogame Partnerwahlen ansteigen.
Dass die soziale Klasse insbesondere bei Frauen ein Beuteschema ist, was in evolutionspsychologischen Studien oder im Partnerwahlmodell der „Freiwilligen Partnerlosigkeit“ suggeriert wird, kann nicht pauschalisierend angenommen werden, da die Studie die Einwirkung von möglichen patriarchalen Gesellschaftsstrukturen unberücksichtigt lässt. Wenn Partnerwahlen klassistisch motiviert sind, verfestigten sich Stereotypen über Menschen, denen eine Klasse nachgesagt wird, wodurch klassistische Diskriminierungen verstärkt werden, die den Diskriminierungskreislauf selbstverstärken. Nach der Intersektionalitätstheorie wird durch innergesellschaftlichen Klassismus, Rassismus und Sexismus vergrößert. Zudem kann es einen gesellschaftlichen Reproduktionsdruck vom Entsprechen von Rollenbildern geben, der von Medien mitunterstützt werden kann. Durch die Interdisziplinität konnte festgestellt werden, dass auch nicht in jedem Fall, wo klassistisch eine Partnerwahl abgebrochen wird, Klassismus der eigentliche Grund sein muss. Die Psychoanalyse hat festgestellt, dass es ebenso ein Vorwand für projektives Verhalten sein könnte, in welchem alle Inhalte, die nicht mit der eigenen Wertidentität übereinstimmen, auf eine Person übertragen werden. Weil auch Abstiegsängste für projektives Verhalten eine Rolle spielen, könnte eine weitere Forschungsfrage abgeleitet werden, ob der soziale Status in Partnerwahlen egalisiert wird, wenn man die individuellen Abstiegsängste beseitigen könnte. Da für viele Abstiegsängste Systemmechanismen verantwortlich sind, wie eine erhöhte Arbeitsmarktflexibilität oder andere sozioökonomischen Benachteiligungen, wäre eine Erforschung jedoch komplex.
Im sozialpsychologischen Teil der Arbeit ließ sich beobachten, dass die Charaktereigenschaften nicht immer homogam sein müssen, sondern es auch hetereogame Zusammenhänge bei der Partnerwahl geben kann, welche einen Mehrwert für kreatives Lernen herstellen können. Entscheidend sind Gemeinsamkeiten nur dann, wenn sie einem selbst in der Beziehung am Herzen liegen (vgl. Bahns et al. 2017, 435f.). Überraschend hat die Sozialpsychologie den bildungshomogamen Ansatz relativiert, da der IQ kaum relevant für eine Partnerschaft sei, sondern vielmehr die Herzensbildung entscheidend ist. Mit ihr werden die größten Chancen vermutet, dass Konflikte erfolgreich gelöst werden, die für die Langfristigkeit einer Beziehung relevant sind. Einen großen Widerspruch gibt es, weil durch das Statusdenken eben diese sozial-emotionale Fähigkeit als minderwertig abgestempelt wird. Es ist möglich, dass diese interpersonellen Begabungen bewusst unterdrückt werden, um vom sozialen Status höher betrachtet zu werden, weswegen daraus folgende Hypothese abgeleitet werden kann: Wenn die emotionale Intelligenz bei Personen sinkt, nimmt auch die Konfliktbewältigungsfähigkeit in Beziehungen ab. Dies könnte erklären, weswegen die Trennungsrate derzeit so hoch ist und das Vertrauen in Partnerschaften so gering. Zudem kann angenommen werden, dass besonders emanzipative Frauen die minderwertig betrachteten Eigenschaften ablegen, da sie aufgrund patriarchaler Depriviligierung stärker sich über den eigenen Status definieren. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, müssten nach Erkenntnissen dieser soziologischen Hausarbeit, Männer und Frauen gleichgestellt werden, Klassismus als Diskriminierungsform verstärkt thematisiert werden und emotionale Intelligenz im jungen Bildungsalter gefördert werden.
Offengelassen soll werden, ob die derzeitige Werteentwicklung von Beziehungen im transatlantischen Raum tatsächlich bewusst gesellschaftlich akzeptiert wird oder ob sie innerlich abgelehnt wird und ein tief sitzender Wunsch nach Systemveränderungen vorherrscht, welcher die Bedingungen für eine Liebesbeziehung im 21. Jahrhundert humanistisch, und damit frei vom Klassendenken, gestaltet.
7. Abbildungsverzeichnis
Alle Daten der Abbildungen wurden auf ihre Aktualität am 17. September 2020 überprüft.
Abb.1: Partnerwahlstrukturen. Modernisiertes Modell aus: Klein, Thomas (2000). Partnerwahl zwischen sozialstrukturellen Vorgaben und individueller Entscheidungsautonomie. In: ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation. Band 20. Heft 3. S. 232. Ergänzte Datengrundlage aus: Palos, Albert/ Cebré, Anna/ Lopez-Ruiz, Luis (2009). Uniones consensuales y matrimonios en América Latina: ^dos patrones de homogamia educativa? In: Papeles de Poblacion. Band 15. Heft 60. Universidad Autonoma del Estado de México. Mexico-City. S. 33.
Abb.2: Verteilung der Partnerwahlen nach dem Grad der Homogamie in Prozent im Jahr 2000 (1970). Aus: Palos, Albert/ Cebré, Anna/ Lopez-Ruiz, Luis (2009). Uniones consensuales y matrimonios en América Latina: ^dos patrones de homogamia educativa? In: Papeles de Poblacion. Band 15. Heft 60. Universidad Autonoma del Estado de México. Mexico-City. S. 34.
Abb.3: Beziehungsphasenmodell nach Weber (2014). Daten aus: Weber, Roland (2014). Vom Verschwinden der Liebe. In: Jung Journal Heft 31: Liebeszauber. März 2014. Verlag opus magnum. Stuttgart.
8. Literaturverzeichnis
Alle Quellen wurden auf ihre Funktionalität am 17. September 2020 überprüft.
Alisch, Monika (2018). Sozialräumliche Segregation: Ursachen und Folgen. In: Huster, Ernst- Ulrich/ Boeckh, Jürgen/ Mogge-Grotjahn, Hildegard (2018). Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung. Springer. Wiesbaden. S. 503-522.
Allports, Gordon (1954). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley. Reading.
Athenstaedt, Ursula/ Alfermann, Dorothee (2011). Geschlechterrollen und ihre Folgen. Eine sozialpsychologische Begutachtung. Kohlhammer. Stuttgart.
Bahns, Angela/ Crandall, Chris/ Gillath, Omri/ Preacher, Kristopher (2017). Similarity in relationships as niche construction: Choice, stability, and influence within dyads in a free choice environment. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 112. Heft 2. S. 329-355.
Barone, Chuck (1999). Race, Gender & Class. In: Gender & Class Journal. Band 6. Heft 3. S. 5-33.
Bauer, Johannes/Ganser, Christian (2006). Münchner Studie zu Partnerwahl und Partnerschaft. Ludwigs-Maximillian-Universität. Institut für Soziologie. München. URL: https://www.ls4.soziologie.uni- muenchen.de/aktuelle forschung/abgeschlos forschungsprojekte/partnerstudie/partnerstudi e.pdf
Beck, Ulrich (2008). Jenseits von Klasse und Nation: Individualisierung und Transnationalisierung sozialer Ungleichheiten. In: Soziale Welt. Band 59. S. 301-325.
Becker, Gary (1981). A Treatise on the Family. Harvard University Press.
Benölken, Heinz (2019). Baustein 5: In erfüllender Partnerschaft leben. In: Benölken, Heinz (2019). Fit für gute 120 Jahre. Springer. Wiesbaden. S. 165-180.
Bischoff, Hans-Werner (2018). Liebesstile aus psychologischer Sicht. In: Forschung & Lehre. Band 25. Heft 12/18. Bonn.
Blossfeld, Hans-Peter/ Timm, Andreas (2003). Who marries whom? Educational systems as marriage markets in modern societies. Kluwer-Verlag. Dordrecht.
Bossard, James (1932). Residential Propinquity as a Factor in Marriage Selection. In: American Journal of Sociology. Band 38. S. 219-224.
Brintzinger, Klaus-Rainer (1996). Die Nationalökonomie an den Universitäten Freiburg, Heidelberg und Tübingen 1918-1945: Eine institutionenhistorische, vergleichende Studie der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten und Abteilungen südwestdeutscher Universitäten. In: Hohenheimer volkswirtschaftliche Schriften. Heft 21. Peter Lang International Academic Publishers. Berlin.
Bude, Heinz (2014). Gesellschaft der Angst. Hamburger Edition Verlag. Hamburg.
Burkart, Günter (2020). Familie und Paarbeziehung. In: Handbuch Familie: Gesellschaft, Familienbeziehungen und differentielle Felder. S. 1-20.
Burow, Olaf-Axel (2000). Ich bin gut - wir sind besser. Erfolgsmodelle kreativer Gruppen. Klett-Cotta Verlag. Stuttgart.
Burow, Olaf-Axel (2015). Herausragende Leistungen durch Lernfreude. In: BildungsTV vom 13. März 2015. 19:31-20:00. URL: https://www.youtube.com/watch?v=IEWNmqQi E&t=624s
Buss, David/ Barnes, Michael (1986). Preferences in human mate selection. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 5. S. 559-570.
Conway, Michael/ Pizzamiglio, Teresa/ Mount, Lauren (1996). Status, communality, and agency: Implications for stereotypes of gender and other groups. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 71. Heft 1. S. 25-38.
Dackweiler, Regina-Maria/ Rau, Alexandra/ Schäfer, Reinhild (2020). Frauen und Armut - Feministische Perspektiven. Verlag Barbara Budrich. Berlin/ Toronto.
Dathe, Dietmar/ Paul, Fransiska/ Stuth, Stefan (2012). Soziale Dienstleistungen: Steigende Arbeitslast trotz Personalzuwachs. In: WZBrief Arbeit. Band 12. Heft 5. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Berlin.
Domingues, José (2017). Subjetividad colectiva. In: Cuadernos De Teoria Social. Band 3. Heft 6. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. S. 38-48.
Dignös, Eva (2015). Paare im Freizeitstress: Gemeinsame Hobbys sind nicht alles. In: Aachener Zeitung vom 31. Juli 2015. S. 11.
Dörre, Klaus/ Scherschel, Karin/ Booth, Melanie/ Haubner, Tine/ Marquardsen, Kai/ Schierhorn, Karen (2013). Bewährungsproben für die Unterschicht? Soziale Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik. Campus-Verlag. Frankfurt am Main/ New York.
Eagly, Alice/ Wendy, Wood (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. In: American Psychologist. Band 54. S. 408-423
Esser, Hartmut/ Hoenig, Kerstin (2018). Leistungsgerechtigkeit und Bildungsungleichheit. In: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Band 70. S. 419-447.
Feagin, Joe/ Eckberg, Douglas (1980). Discrimination: Motivation, action, effects, and context. In: Annual Review of Sociology. Band 6. Heft 1. S. 1-20.
Feld, Scott (1981). The Focused Organization of Social Ties. In: American Journal of Sociology. Band 86. Heft 5. S. 1015-1035.
Fink, Bernhard/ Sövegjarto, Olivia (2006). Pheromone, Körpergeruch und Partnerwahl. In: Der Gynäkologe. Band 9. Springer. Wiesbaden. S. 731-739.
Fischbach, Lisa/Bartsch, Beatrice/Rietzsch, Juliane (2017). ElitePartner Studie 2018 - So liebt Deutschland Beziehungsängste, Dating-Trends und Sexhäufigkeit. Institut Fittkau & Maaß Consulting GmbH. Im Auftrag von Elitepartner.
Franzen, Axel/Hartmann, Josef (2001). Die Partnerwahl zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Eine empirische Studie zum Austausch von physischer Attraktivität und sozialem Status. In: Klein, Thomas (2001). Partnerwahl und Heiratsmuster. Sozialstrukturelle Voraussetzungen der Liebe. S. 183-206.
Frenzel, Hansjörg (1995). Bildung und Partnerwahl. In: ZUMA Nachrichten. Band 19. Heft 36. S. 61-88.
Geiger, Theodor (1932). Die soziale Schichtung des deutschen Volkes. Soziographischer Versuch auf statistischer Grundlage. Enke-Verlag. Stuttgart.
Geißler, Rainer (2011). Klassen und Schichten im Schmelztiegel? Kontroversen um Begriffe, Theorien und Modelle. In: Geißler, Rainer (2011). Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. Springer. Wiesbaden. S. 69-89.
Gelitz, Christiane (2020). Partnerwahl - Meine intelligentere Hälfte. In: Spektrum Wissenschaft vom 13. August 2020. Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft. Heidelberg. URL: https://www.spektrum.de/news/intelligenz-kriterium-bei-der-partnerwahl/1758606
Georg, Werner (2015). Transmission kulturellen Kapitals und Statuserwerb Eine Analyse der Entwicklung zwischen dem 15. und 45. Lebensjahr. In: SozW Soziale Welt - Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung. Band 66. Nomos-Verlag. Baden-Baden. S. 281-300.
Gignac, Gilles/ Zajenkowski, Marcin (2019). People tend to overestimate their romantic partner's intelligence even more than their own. In: Intelligence. Band 73. Heft März-April 2019. Elsevier. Amsterdam. S. 41-51.
Gignac, Gilles/ Callis, Zoe (2020). The costs of being exceptionally intelligent: Compatibility and interpersonal skill concerns. In: Intelligence. Band 81. Heft Juli-August 2020. Elsevier. Amsterdam.
Glawion, Sven (2019). Als Arbeitertochter unter Marx' Erben: Eine Lesart zu „Klassenliebe“ von Karin Struck. In: Revista de Estudos Alemaes. Band 8. Heft 5. Universidade de Brasilia Nücleo de Estudos de Linguas e Culturas Germânicas. S. 45- 72.
Goleman, Daniel (2011). Emotionale Intelligenz. 11. Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag. München.
Goleman, Daniel (2020). Emotionale Intelligenz. 20. Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag. München.
Gonzalez-Padilla, Daniel/Tortolero-Blanco, Leonardo (2020). Social media influence in the COVID-19 Pandemic. In: Int. braz j urol. Band 46. Heft 1. Madrid. S. 120-124.
Groß, Martin (2008). Klassen, Schichten, Mobilität. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden.
Hakim, Catherine (2010). Erotic Capital. In: European Sociological Review. Band 26. S. 499518.
Halfdanarson, Guömundur/ Vilhelmssson, Vilhelm (2016). Historische Diskriminierungsforschung. In: Scherr, Albert (Hrsg) (2016). Handbuch Diskriminierung. Springer. Wiesbaden. S. 25-37.
Handl, Johann (1988). Berufschancen und Heiratsmuster von Frauen. Empirische Untersuchungen zu Prozessen sozialer Mobilität. Campus-Verlag. Frankfurt am Main.
Hank, Karsten (2009). Generationenbeziehungen im alternden Europa: Analysepotenziale und Befunde des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. In: Zeitschrift für Familienforschung/Journal of Family Research. Band 21. Heft 1. S. 86-97.
Harris Interactive (2018). The Happiness Index: What Makes a Couple ‘Perfectly Happy?' Im Auftrag für Eharmony. Gemeinsame Pressemitteilung vom 8. Februar 2018. URL: https://www.eharmony.com/dating-advice/relationships/the-happiness-index-what-makes-a- couple-perfectly-happy/ Hill, Paul/ Kopp, Johannes (2013). Theoretische Perspektiven der Familiensoziologie. In: Hill, Paul/ Kopp, Johannes (2013). Familiensoziologie - Grundlagen und theoretische Perspektiven. Springer. Wiesbaden. S.51-120.
Hipp, Lena/ Kelle, Nadiya (2016). Nur Luft und Liebe? Die Entlohnung sozialer Dienstleistungsarbeit im Länder- und Berufsvergleich. Expertise. Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin.
Hooks, Bell (2000). Where We Stand: Class Matters. Psychology Press. London. Hudson, Nathan/ Fraley, Chris (2014). Partner similarity matters for the insecure: Attachment orientations moderate the association between similarity in partners' personality traits and relationship satisfaction. In: Journal of Research in Personality. Band 53. S. 112-123
Huinink, Johannes/Konietzka, Dirk (2007). Familiensoziologie - Eine Einführung. CampusVerlag. Frankfurt am Main.
Kemper, Andreas/ Weinbach, Heike (2009). Klassismus. Eine Einführung. 1. Auflage. Unrast-Verlag. Münster.
Kemper, Andreas/ Weinbach, Heike (2016). Klassismus. Eine Einführung. 2. Auflage. Unrast-Verlag. Münster.
Kessler, Sebastian (2016). Die Verwaltung sozialer Benachteiligung: Zur Konstruktion sozialer Ungleichheit in der Gesundheit in Deutschland. Dissertation an der Universität Ulm. Springer. Wiesbaden.
Klein, Thomas (2000). Partnerwahl zwischen sozialstrukturellen Vorgaben und individueller Entscheidungsautonomie. In: ZSE: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation. Band 20. Heft 3. S. 229-243.
Kuche, Coline (2019). Soziale Klassenunterschiede in Emotionsregulation. In: Burzan, Nicole (Hrsg.) (2019). Komplexe Dynamiken globaler und lokaler Entwicklungen. Verhandlungen des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen. .Band 39.
Lengfeld, Holger/ Hirschle, Jochen (2009). Die Angst der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg. Eine Längsschnittanalyse 1984-2007. In: Zeitschrift für Soziologie. Band 38. Heft 5. Lucius & Lucius Verlag. Stuttgart. S. 379-398
Liebertz, Charmaine (2014). Herzensbildung - Wie Eltern sie vermitteln können. In: Spiel und Zukunft. Das Online-Portal für Eltern. Zell. URL: https://www.spielundzukunft.de/de- de/de DE/content/blog-5014504/herzensbildung---wie-eltern-sie-vermitteln-koennen-9191
Liu, William (2011). Social class and classism in the helping professions: Research, theory, and practice. Sage Press. London/Singapore/New Delhi/ Thousand Oaks.
Mahrt, Merja (2014). Vom Lagerfeuer zur filter bubble - Konsequenzen der Nutzung digitaler Medien für die Integrationsfunktion von Medien. In: Kleinen-von Königslöw, Katharina/ Förster, Kati (Hrsg.)(2014). Medienkonvergenz und Medienkomplementarität aus Rezeptions- und Wirkungsperspektive. Nomos-Verlag. Baden-Baden. S. 127 - 146.
Maslow, Abraham (1943). A Theory of Human Motivation. In: Psychological Review. Band 50. Heft 4. S. 370-396.
Mayer, Karl (1977) Statushierarchie und Heiratsmarkt. In: Handl, Johann/ Mayer, Karl/ Müller, Walter (Hrsg.) (1977). Klassenlagen und Sozialstruktur. Campus-Verlag. Frankfurt am Main/New York. S. 155-232.
McClintock, Elizabeth (2014). Beauty and Status: The Illusion of Exchange in Partner Selection? In: American Sociological Review. Band 79. S. 575-604.
Meulenbelt, Anja (1988) Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus. Aus dem Niederländischen von Silke Lange. Rowohlt Verlag. Reinbek.
Nave-Herz, Rosemarie (2004). Familie heute. Wandel der Familienstrukturen und Folgen für die Erziehung. Primus-Verlag. Darmstadt.
Nave-Herz, Rosemarie (2013). Ehe- und Familiensoziologie: Eine Einführung in Geschichte, theoretische Ansätze und empirische Befunde. Beltz-Verlag. Weinheim.
Noelle-Neumann, Elisabeth (2001). Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung - unsere soziale Haut. 6. Auflage. Langen Müller Verlag. München.
Ocampo, Tatiana/ Lopez, Carolina (2019). La formacion socio humanistica en el curriculo de las facultades de odontologia en Colombia. In: Revista Investigaciones Andina. Band 21. Heft 38. S. 39-61.
Otto, Jürgen/ Döring-Seipel, Elke/ Grebe, Martin/ Lantermann, Ernst-Dieter (2001). Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung der wahrgenommenen emotionalen Intelligenz. In: Diagnostica. Band 47. S. 178-187.
Palos, Albert/ Cebré, Anna/ Lopez-Ruiz, Luis (2009). Uniones consensuales y matrimonios en América Latina: ^dos patrones de homogamia educativa? In: Papeles de Poblacion. Band 15. Heft 60. Universidad Autonoma del Estado de México. Mexico-City. S. 9-41.
Pappi, Franz (1976). Soziale Schichten als Interaktionsgruppen. Zur Messung eines deskriptiven Schichtbegriffs. in: Lepsius, Mario (Hrsg.) (1976). Zwischenbilanz in der Soziologie. Verhandlungen des 17. dt. Soziologentages. Enke-Verlag. Stuttgart. S. 223-242
Prentice, Deborah/ Carranza, Erica (2002). What women should be, shouldn't be, are allowed to be, and don't have to be: The contents of prescriptive gender stereotypes. In: Psychology of Women Quarterly. Band 26. Heft 4. Princeton University. S. 269-281.
Raske, Franziska (2017). Sektion Methoden der empirischen Sozialforschung. Empirische Analyse von Krisen und Umbrüchen II - Datenanalyse. In: Rotine der Krise - Krisen der Rotinen. 37. Kongress der deutschen Gesellschaft für Soziologie. Universität Trier. Trier.
Ridgeway, Cecilia/ Bourg, Chris (2004). Gender as Status: An Expectation States Theory Approach. In: The Psychology of Gender. Guilford-Verlag. New York. S. 217-241.
Reher, David (1998). Family ties in Western Europe: Persistent contrasts. In: Population and Development Review. Band 24. Heft 2. S. 203-234.
Reiss, Steven (2000). Who am I? The 16 Basis Desires that Motivates our Behavior and Define our Personality. New York.
Roß, Bettina (2004). Migration, Geschlecht und Staatsbürgerschaft : Perspektiven für eine antirassistische und feministische Politik und Politikwissenschaft. VS-Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden.
Ruck, Nora (2014). Schönheit als Zeugnis. Evolutionspsychologische Schönheitsforschung und Geschlechterungleichheit. Springer. Wiesbaden.
Rüffer, Wolfgang/ Klein, Thomas (1999). Bildungshomogamie im internationalen Vergleich: empirische Untersuchungen für die USA, Österreich, Ungarn und Deutschland. In: Zeitschrift für Familienforschung. Band 11. Heft 2. S. 28-58.
Rüger, Heiko/ Schier, Michaela/ Feldhaus, Michael/ Ries, Tammy (2014). Einstellungen zur Akzeptanz räumlicher Distanz in erwerbsbedingt multilokalen Lebensformen. In: Zeitschrift für Familienforschung, 26. Jahrg. Heft 2/2014. S. 121-143
Schelsky, Helmut (1979). Auf der Suche nach der Wirklichkeit. Diederichs-Verlag. München.
Scherr, Albert (2016). Soziologische Diskriminierungsforschung. In: Scherr, Albert (Hrsg) (2016). Handbuch Diskriminierung. Springer. Wiesbaden.
Schneewind, Klaus/ Wunderer, Eva (2001). Was hält Ehen zusammen? In: Materialband zum Projekt. Institut für Psychologie der Universität München. München.
Seidel, Eberhard (2017). Soziale Herkunft hat Folgen. In: Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage (Hrsg.) (2017). Themenheft Klassismus. Berlin.
Spektrum (2000). Lexikon der Psychologie. Partnerwahl. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg.
Statistisches Bundesamt (2017). Anteil der Akademikerinnen bei 30- bis 34-Jährigen doppelt so hoch wie vor einer Generation. Pressemitteilung Nr. 332 vom 6. September 2018. Wiesbaden.
Tucholsky, Kurt (1926). Standesdünkel und Zeitung. In: Wrobel, Ignaz (1927). Die Weltbühne. Nr. 11 vom 16. März 1926. Berlin. S. 417.
Veit, Thomas (2019). Anatomie der konservativen Destruktivität: Eine leidens-und kulturtheoretische Studie zum Konservativen Charakter. Lit-Verlag. Berlin.
Vereinte Nationen (1948). Eheschließung, Familie. In: Vereinte Nationen (1948). Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sitzung 183. Kennung: A/RES/217/A. Ratifizierung am 10. Dezember 1948. Paris. Art. 16.
Weber, Max (1920). Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der Verstehenden Soziologie. 1. Auflage. Mohr. Tübingen.
Weber, Max (1980). Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Auflage. Mohr. Tübingen.
Weber, Roland (2014). Vom Verschwinden der Liebe. In: Jung Journal Heft 31: Liebeszauber. März 2014. Verlag opus magnum. Stuttgart.
Weinbach, Heike (2020). „Klassismus“: eine Analysekategorie für Frauenarmutskontexte. In: Dackweiler, Regina-Maria/ Rau, Alexandra/ Schäfer, Reinhild (Hrsg.) (2019). Frauen und Armut - Feministische Perspektiven. Barbara Budrich Verlag. Opladen/ Berlin/ Toronto.
Westdeutscher Rundfunk (2017). Für alle tolle Frauen, die noch Single sind. In: Kölner Treff vom 8. Oktober 2017. URL: https://www.facebook.com/koelnertreffwdr/videos/1195813767435064/
Willi, Jürg (1988). Die Zweierbeziehung, Spannungsursachen / Störungsmuster / Klärungsprozesse / Lösungsmodelle - Analyse des unbewußten Zusammenspiels in Partnerwahl und Paarkonflikt. Rowohlt-Verlag. Hamburg.
Willi, Jürg (1991). Was hält Paare zusammen? Der Prozeß des Zusammenlebens in psychoökologischer Sicht. 1. Auflage. Rowohlt-Verlag. Hamburg.
Winch, Robert (1954). The Theory of Complementary Needs in Mate-Selection: An Analytic and Descriptive Study. In: American Sociological Review. Band 19. Heft 3. S. 241-249
Wirth, Heike (2000). Bildung, Klassenlage und Partnerwahl. Eine empirische Analyse zum Wandel der bildungs- und klassenspezifischen Heiratsbeziehungen. Springer VS. Wiesbaden.
Wunderlich, Stefanie (2012). Das Konstrukt der Beziehungs- und Bindungspersönlichkeit und sein Einfluss auf die Partnerschaftsqualität. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, Fachbereich Psychologie der Universität Hamburg. Hamburg.
Zitelmann, Rainer (2019). Die Gesellschaft und ihre Reichen: Vorurteile über eine beneidete Minderheit. FinanzBuch Verlag. München.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der soziale Status und wie hängt er mit Klasse und Klassismus zusammen?
Der soziale Status wird durch gesellschaftliche Wertung von Lebensführung, Erziehung, Abstammung und Berufsprestige bestimmt. Klasse bezieht sich auf die Stellung in Bezug auf Produktionsmittel, Besitz, Einkommen und Beruf. Klassismus bezeichnet Vorurteile und Diskriminierung aufgrund des sozialen Status, ähnlich wie Sexismus und Rassismus.
Welche Erklärungsansätze für Partnerwahl werden vorgestellt?
Es werden drei Erklärungsansätze vorgestellt: der sozialstrukturelle Ansatz (Homogamie vs. Heterogamie, Bildungsverteilung), der evolutionspsychologische Ansatz (physische Attraktivität vs. sozialer Status) und der familienökonomische Ansatz (Nutzenmaximierung, Produktionsgemeinschaft).
Was versteht man unter Homogamie und Heterogamie bei der Partnerwahl?
Homogamie bedeutet, dass sich ähnliche Menschen zusammenfinden (z.B. gleiche Nationalität, sozioökonomischer Status, Bildung). Heterogamie hingegen bedeutet, dass sich Gegensätze anziehen.
Welche Rolle spielt Klassismus bei der Partnerwahl?
Die Ausarbeitung untersucht, inwieweit klassistisches Denken bei Partnerwahlen verankert ist. Es wird argumentiert, dass Ablehnungen aufgrund von Klasse diskriminierend sein können und sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Folgen haben.
Welche individuellen Folgen kann klassistische Diskriminierung haben?
Individuelle Folgen können Trennungsschmerz, Scham- und Schuldgefühle, negatives Selbstkonzept und Trauma-Trigger sein. Diese Erfahrungen können neue Beziehungen belasten und die soziale Situation verschärfen.
Welche gesellschaftlichen Folgen hat klassistische Diskriminierung?
Gesellschaftliche Folgen können die Verfestigung von Vorurteilen, die Aufrechterhaltung von Ungleichheiten in Bildung und Beruf, sowie die Überschneidung mit Sexismus und Rassismus sein. Es droht eine Abwertung sozial-emotionaler Fähigkeiten.
Welche sozialpsychologischen Faktoren beeinflussen die Partnerwahl?
Räumliche und physische Nähe, gemeinsame Werte und Einstellungen, Ehrlichkeit und Konfliktbewältigung, sowie Bildung spielen eine Rolle. Überraschenderweise ist die emotionale Intelligenz (EI) wichtiger als der IQ.
Was ist emotionale Intelligenz (EI) und warum ist sie wichtig?
Emotionale Intelligenz (EI) beschreibt Empathie- und Empfindungsfähigkeit. Sie ist wichtig, weil sie die Basis für offene Kommunikation und erfolgreiche Konfliktbewältigung in Beziehungen legt. Menschen mit hoher EI werden aber im Klassismus oft als statusslow abgestempelt.
Welche Rolle spielen Werte und Einstellungen bei der Partnerwahl?
Gemeinsame Werte erleichtern den Rapport, die Offenheit und den emotionalen Austausch. Politische Überzeugungen und soziale Normen sind wichtige Gemeinsamkeiten. Auch zukünftige Lebensprojekte können eine Beziehung stabilisieren.
Was sind die Kernpunkte des Textes "Durch Klassendenken zur großen Liebe?"
Der Text analysiert, ob Klassendenken die Partnerwahl beeinflusst. Es werden verschiedene Erklärungsansätze, die Folgen klassistischer Diskriminierung und sozialpsychologische Faktoren betrachtet. Emotionale Intelligenz wird als wichtiger Faktor für erfolgreiche Beziehungen hervorgehoben.
- Quote paper
- Florian Wondratschek (Author), 2020, Klassismus in der Partnerwahl. Durch Klassendenken zur großen Liebe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962048