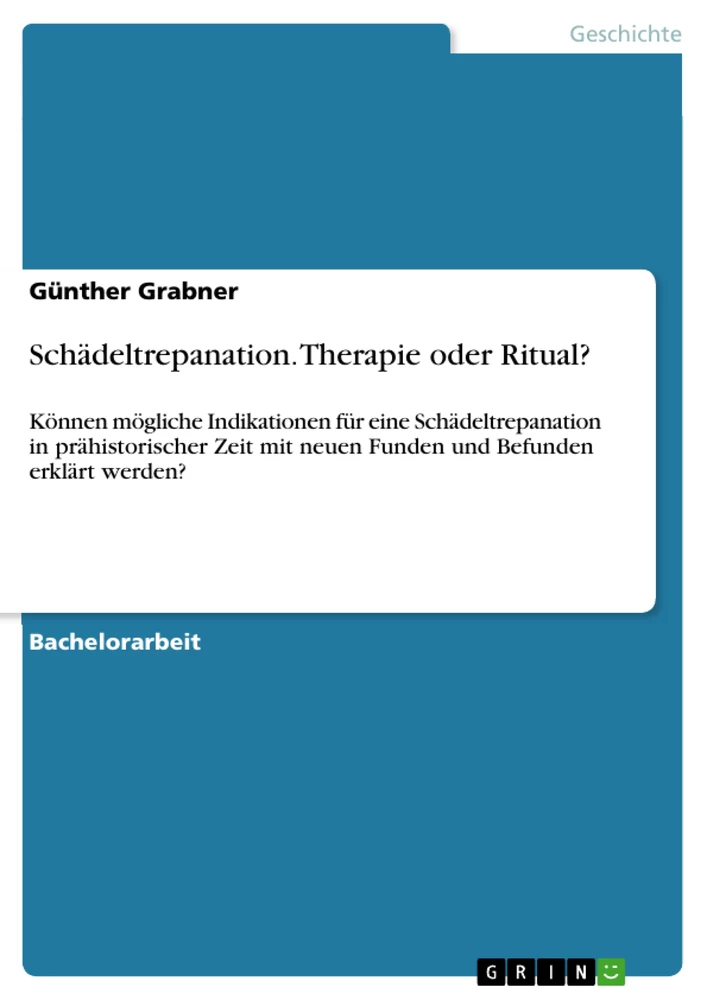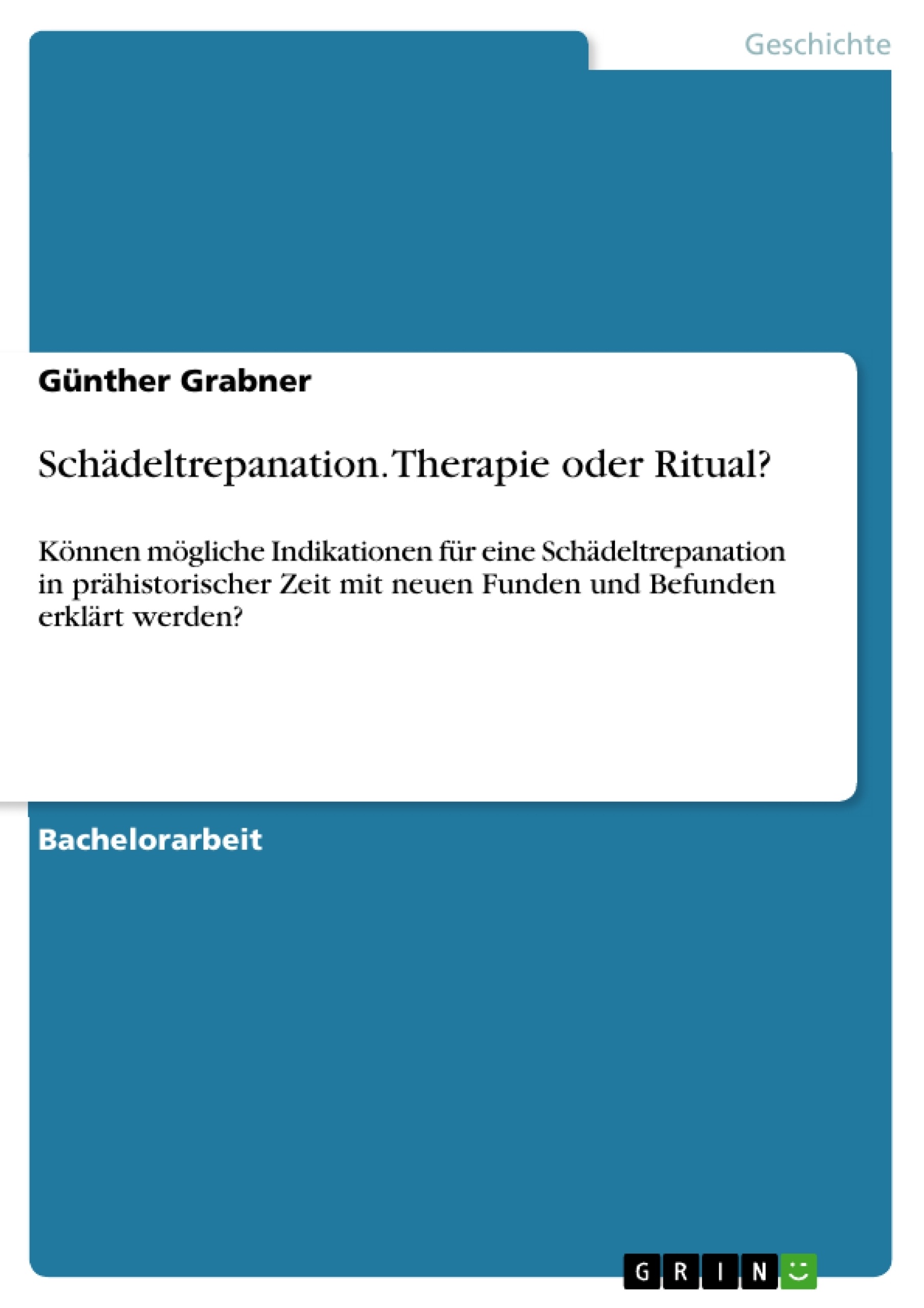Trepanationen in prähistorischer Zeit bleiben letztlich ein Mysterium hinsichtlich ihrer Indikationen, ihrer „detaillierten medizinischen Handhabung“ und der dabei schon erzielten exzellenten Ergebnisse, was das Überleben unter diesen archäischen Bedingungen betrifft.
Analysiert man das gegenwärtige anthropologische, pathologisch-anatomische und auch diachronische archäologische Wissen der mitteleuropäischen Zone nach verschiedenen und einander komplementär ergänzenden Gesichtspunkten, dann kommt man zu dem Schluß, dass eher medizinische oder bestenfalls medizinische Indikationen mit „magisch-rituellem Kontext“ zum Tragen gekommen sind und keinesfalls ausschließlich „rituelle“ Vorstellungen bei der Durchführung dieser schwerwiegenden Eingriffe bestanden haben können.
Welche primären Leiden hingegen im Einzelfall für die Chirurgen der Ur- und Frühgeschichte ausschlaggebend waren, das Risiko für die ihnen anvertrauten Patienten zu übernehmen, wird dem forschenden Auge wohl in den meisten Fällen verborgen bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsgeschichte
- Pathologische Aspekte
- Trepanationstechniken
- Differentialdiagnosen
- Fundberichte
- Erste Berichte
- Motivation
- Großbritannien
- Irland
- Dänemark
- Portugal
- Süddeutschland und Schweiz
- Neolithikum
- Bronzezeit
- Latènezeit
- Die Mittelelbe-Saale-Schnurkeramik
- Österreich
- Neolithikum
- Bronzezeit
- Latènezeit
- Karte 1 und Tabelle 1 (zu Süddeutschland, Schweiz, Österreich)
- Weitere internationale Berichte
- Diskussion
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Schädeltrepanation in prähistorischer Zeit. Sie untersucht die Frage, ob die Indikationen für diese komplexen Eingriffe mit neueren Funden und Befunden erklärt werden können. Die Arbeit analysiert die Forschungsgeschichte, die pathologischen Aspekte, die Trepanationstechniken sowie die Differentialdiagnosen der Schädeltrepanation.
- Die Forschungsgeschichte der Trepanation
- Die Rolle der Trepanation in verschiedenen Kulturen
- Die möglichen Indikationen für die Durchführung von Trepanationen
- Die verschiedenen Techniken, die für die Trepanation eingesetzt wurden
- Die Überlebensraten von Trepanationen in prähistorischer Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsgeschichte, die pathologischen Aspekte, die Trepanationstechniken sowie die Differentialdiagnosen der Schädeltrepanation beleuchtet.
Im zweiten Kapitel werden Fundberichte aus verschiedenen Teilen Europas vorgestellt. Dabei wird der Fokus auf die Beurteilungen der Autoren hinsichtlich der medizinischen oder kulturellen/rituellen/spirituellen Trepanationen gelegt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Diskussion der Befunde aus dem mitteleuropäischen Raum (Süddeutschland, Schweiz, Österreich) und versucht, die Indikationen für die Trepanationen anhand der Fundumstände, der Beigaben, der Bestattungsart und des sozialen Status der Operierten zu erklären.
Die Arbeit endet mit einem Schlusskapitel, in dem die Ergebnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen werden.
Schlüsselwörter
Schädeltrepanation, Prähistorie, Medizin, Rituale, Archäologie, Anthropologie, Kulturgeschichte, Süddeutschland, Schweiz, Österreich, Mitteleuropa
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Schädeltrepanation?
Eine Trepanation ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem ein Loch in den Schädel gebohrt oder geschnitten wird, was bereits in prähistorischer Zeit praktiziert wurde.
War die Trepanation in der Urgeschichte ein Ritual oder eine Therapie?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass medizinische Indikationen im Vordergrund standen, oft jedoch in einem magisch-rituellen Kontext ausgeführt wurden.
Haben Menschen diese Eingriffe damals überlebt?
Erstaunlicherweise zeigen archäologische Funde exzellente Ergebnisse und hohe Überlebensraten, erkennbar an Verheilungsprozessen am Knochen.
Aus welchen Regionen gibt es Fundberichte?
Berichte stammen aus ganz Europa, unter anderem aus Großbritannien, Portugal, Süddeutschland, der Schweiz und Österreich (vom Neolithikum bis zur Latènezeit).
Welche Techniken wurden für die Trepanation genutzt?
In der Prähistorie wurden verschiedene Techniken wie Schaben, Bohren oder Schneiden mit Steinwerkzeugen angewandt, um die Schädeldecke zu öffnen.
- Citar trabajo
- Günther Grabner (Autor), 2019, Schädeltrepanation. Therapie oder Ritual?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962742