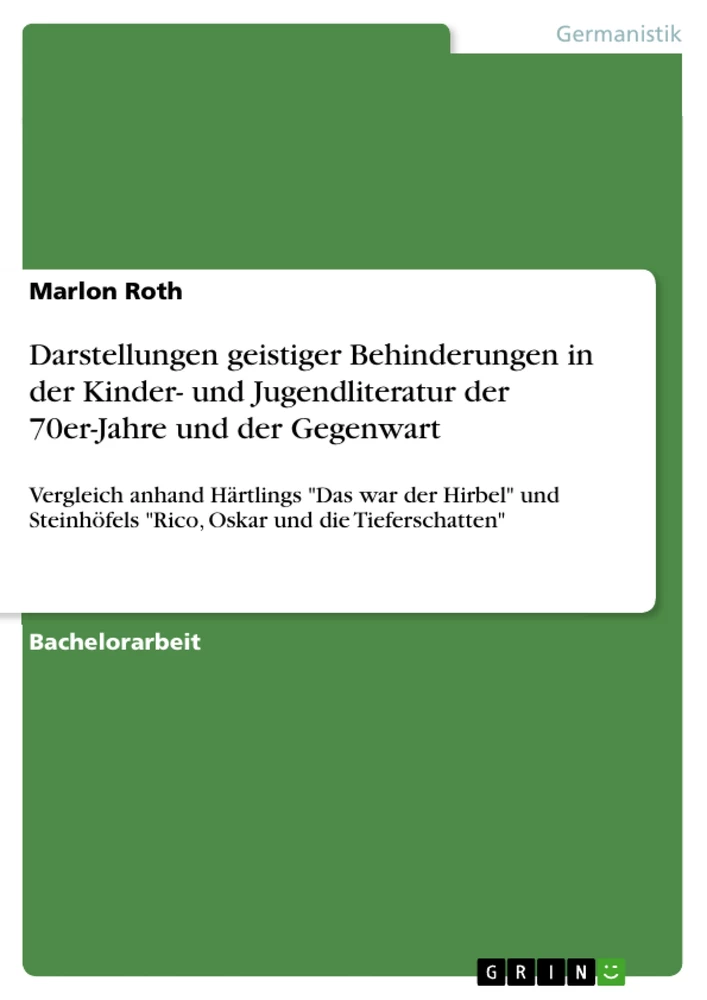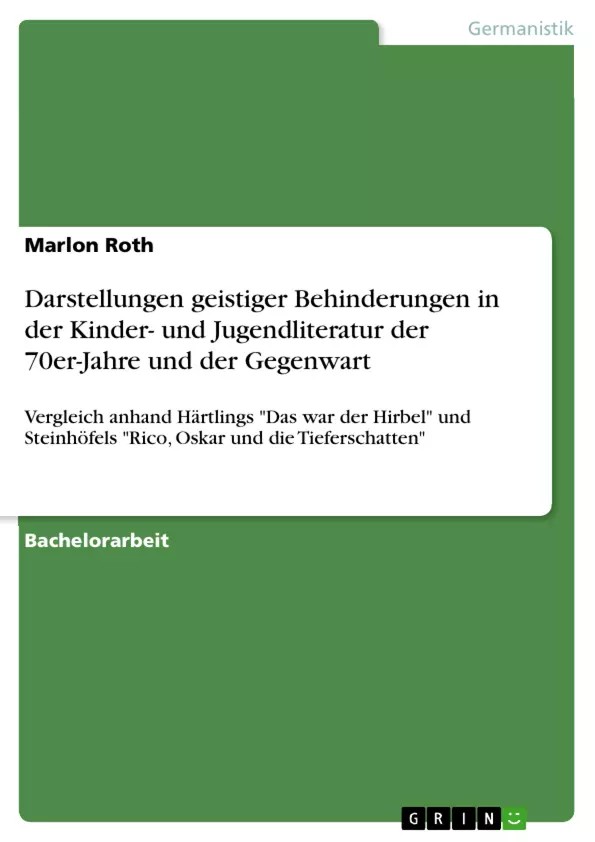In dieser Arbeit soll der Blick auf die Darstellung geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur gelegt werden, die in dieser Form der Literatur noch vernachlässigt zu sein scheint. Dabei stellt sich die Frage, wie geistige Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur in der Vergangenheit und der Gegenwart dargestellt wird. Aus diesem Grund soll in der vorliegenden Arbeit folgende Forschungsfrage beantwortet werden: Sind Veränderungen in der Darstellungsweise und der Intention erkennbar und wie sehr entsprechen sie jener gesellschaftlichen Einstellung?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, werden zwei zeitlich weit auseinanderliegende Werke der Kinder- und Jugendliteratur miteinander verglichen. Zum einen das 1973 erschienene Werk von Peter Härtling mit dem Titel „Das war der Hirbel“ und zum anderen das von Andreas Steinhöfel im Jahr 2008 veröffentliche „Rico, Oskar und die Tieferschatten“. In beiden Büchern wird das Leben eines Jungen mit einer geistigen Behinderung thematisiert. Auch gelten beide als innovative Werke ihrer Zeit.
„Das war der Hirbel“ erzählt die Geschichte des neunjährigen Hirbels, der sein Leben als ein Kind mit einer geistigen Behinderung in unterschiedlichen Pflegefamilien, Kliniken und Heimen fristen musste. Die Erzählung beschreibt einen dieser Heimaufenthalte in zwölf Einzelgeschichten, die von seinem Leben selbst berichten, aber auch von seinen Streichen gegenüber dem Hausmeister des Heims.
In „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ werden die Erlebnisse des zehnjährigen Fredericos, kurz Rico, in einer Tagebuch ähnlichen Geschichte in ebenfalls zwölf Kapiteln erzählt. Das Werk thematisiert das detektivische Aufspüren des Kindesentführers ‚Mister 2000‘ und die Rettung des hochbegabten Jungen namens Oskar durch den Hauptprotagonisten mit geistiger Behinderung.
Beide Bücher basieren damit auf derselben Grundlage, dem kindlichen Protagonisten mit geistiger Behinderung, sind jedoch in sehr unterschiedlichen Jahrzehnten verfasst worden und eignen sich daher für eine vergleichende Untersuchung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinierung
- 2.1 Der Terminus „geistige Behinderung“
- 2.2 Die Termini „Stereotyp“ und „Vorurteil“
- 3. Behinderung in der Gesellschaft
- 3.1 Umgang mit Behinderung nach 1945
- 3.2 Einstellungen gegenüber Kindern mit Behinderung
- 3.2.1 1970er Jahre
- 3.2.2 1990er Jahre
- 4. Darstellung von Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur
- 4.1 Thematisierung von Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur
- 4.2 Häufige Darstellungsmerkmale von Protagonisten mit Behinderung und ihre Intentionen
- 5. Analyse zweier zeitversetzter Werke
- 5.1 Darstellung der Protagonisten mit geistiger Behinderung
- 5.1.1 Hirbel
- 5.1.2 Rico
- 5.1.3 Vergleich
- 5.2 Darstellung der direkten Bezugspersonen/ des familiären Umfeldes
- 5.2.1 Hirbel
- 5.2.2 Rico
- 5.2.3 Vergleich
- 5.3 Darstellung der Gesellschaft
- 5.3.1 Hirbel
- 5.3.2 Rico
- 5.3.3 Vergleich
- 5.1 Darstellung der Protagonisten mit geistiger Behinderung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur, indem sie zwei Werke aus unterschiedlichen Jahrzehnten vergleicht: Peter Härtlings „Das war der Hirbel“ (1973) und Andreas Steinhöfels „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ (2008). Ziel ist es, Veränderungen in der Darstellungsweise und Intention aufzuzeigen und deren Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Einstellungen zu analysieren.
- Veränderung der Darstellung geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur im Zeitverlauf
- Einfluss gesellschaftlicher Einstellungen auf die literarische Darstellung von Behinderung
- Vergleichende Analyse der Protagonisten und ihrer Darstellung
- Analyse der Darstellung des familiären Umfelds und der Bezugspersonen
- Die Rolle der Gesellschaft in der literarischen Darstellung von Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Darstellung von geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur ein. Sie hebt die gesellschaftliche Ausgrenzung von Menschen mit geistiger Behinderung hervor und betont die Bedeutung von Kinderbüchern als Instrument zur Förderung positiver Einstellungen. Die Arbeit formuliert die Forschungsfrage nach Veränderungen in der Darstellungsweise geistiger Behinderung in der Literatur und deren Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Einstellungen. Die Auswahl von Härtlings „Das war der Hirbel“ und Steinhöfels „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ als Vergleichswerke wird begründet.
2. Begriffsdefinierung: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „geistige Behinderung“, „Stereotyp“ und „Vorurteil“. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Definition von geistiger Behinderung, die Herausforderungen bei der Vermeidung von Stigmatisierung und die verschiedenen Aspekte der intellektuellen und sozialen Beeinträchtigung. Die Unterscheidung zwischen Stereotyp und Vorurteil wird anhand wissenschaftlicher Literatur erläutert, wobei die kollektive Natur von Stereotypen und ihre Funktion bei der Vereinfachung von Realität hervorgehoben werden.
3. Behinderung in der Gesellschaft: Dieses Kapitel beschreibt den gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung nach 1945 in Deutschland, unter Berücksichtigung der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Es analysiert die Einstellungen gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung in den 1970er und 1990er/2000er Jahren anhand von Studien, um den Kontext für die literarische Analyse zu schaffen.
4. Darstellung von Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur: Dieses Kapitel untersucht die Häufigkeit der Darstellung verschiedener Behinderungsformen in der Kinder- und Jugendliteratur und analysiert häufige Merkmale der Darstellung von Protagonisten mit Behinderungen. Es legt den Grundstein für die anschließende Analyse der beiden ausgewählten Werke.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Kinder- und Jugendliteratur, Inklusion, Stereotyp, Vorurteil, gesellschaftliche Einstellungen, Darstellung von Behinderung, Vergleichende Literaturanalyse, Peter Härtling, Andreas Steinhöfel, „Das war der Hirbel“, „Rico, Oskar und die Tieferschatten“.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Darstellung geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur anhand eines Vergleichs zweier Werke: Peter Härtlings „Das war der Hirbel“ (1973) und Andreas Steinhöfels „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ (2008). Sie untersucht, wie sich die Darstellung im Laufe der Zeit verändert hat und wie diese Veränderungen mit gesellschaftlichen Einstellungen korrelieren.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte Veränderungen in der Darstellungsweise geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur aufzeigen und den Einfluss gesellschaftlicher Einstellungen auf diese Darstellung analysieren. Sie vergleicht die Protagonisten, ihr familiäres Umfeld und die Rolle der Gesellschaft in beiden Werken.
Welche Werke werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht „Das war der Hirbel“ von Peter Härtling (1973) und „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel (2008). Die Auswahl dieser beiden Werke aus unterschiedlichen Jahrzehnten ermöglicht eine Analyse der zeitlichen Entwicklung der Darstellung geistiger Behinderung.
Welche Aspekte werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse betrachtet die Darstellung der Protagonisten mit geistiger Behinderung (Hirbel und Rico), ihrer Bezugspersonen und ihres familiären Umfelds sowie die Rolle der Gesellschaft in beiden Werken. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Darstellungen und deren Interpretation im Kontext der jeweiligen gesellschaftlichen Einstellungen zu Behinderung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition (geistige Behinderung, Stereotyp, Vorurteil), Behinderung in der Gesellschaft (inkl. gesellschaftlicher Entwicklung und Einstellungen), Darstellung von Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur, Analyse der beiden Vergleichswerke (inkl. detaillierter Vergleich der drei Aspekte: Protagonist, Familie/Bezugspersonen, Gesellschaft) und Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Geistige Behinderung, Kinder- und Jugendliteratur, Inklusion, Stereotyp, Vorurteil, gesellschaftliche Einstellungen, Darstellung von Behinderung, Vergleichende Literaturanalyse, Peter Härtling, Andreas Steinhöfel, „Das war der Hirbel“, „Rico, Oskar und die Tieferschatten“.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie hat sich die Darstellung geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur im Laufe der Zeit verändert, und wie spiegelt diese Veränderung die Entwicklung gesellschaftlicher Einstellungen wider?
Welche Zeiträume werden in der gesellschaftlichen Analyse betrachtet?
Die gesellschaftliche Analyse betrachtet den Umgang mit Behinderung nach 1945 in Deutschland und konzentriert sich insbesondere auf die Einstellungen gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung in den 1970er und 1990er/2000er Jahren.
Wie werden Stereotype und Vorurteile in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit definiert die Begriffe „Stereotyp“ und „Vorurteil“ und untersucht, wie diese in der Darstellung geistiger Behinderung in den analysierten Werken zum Tragen kommen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
- Quote paper
- Marlon Roth (Author), 2020, Darstellungen geistiger Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur der 70er-Jahre und der Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962810