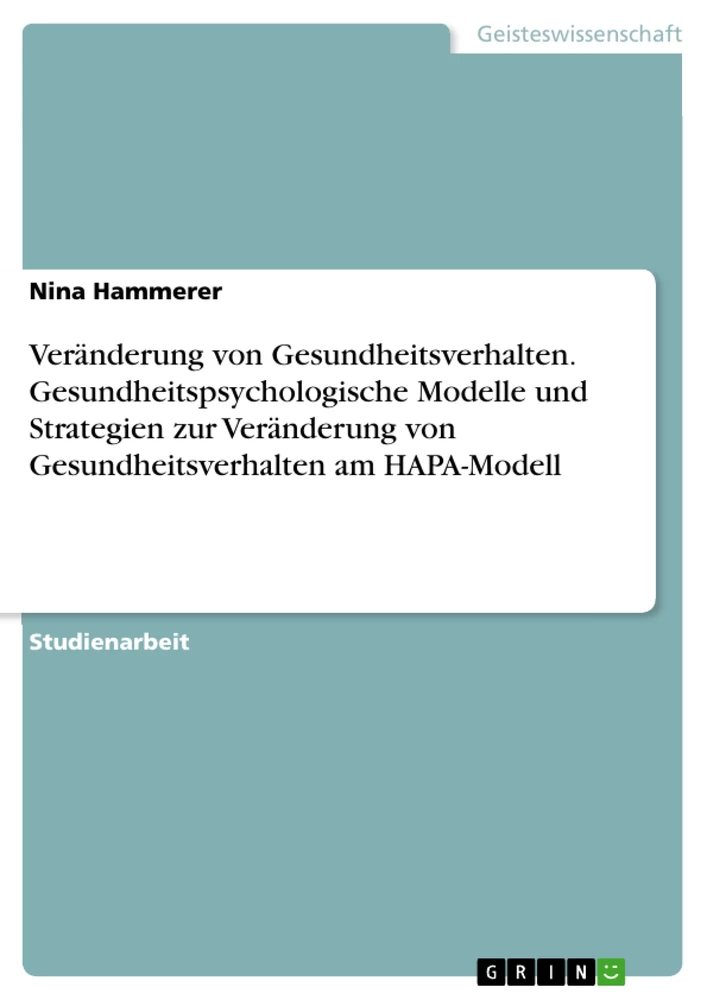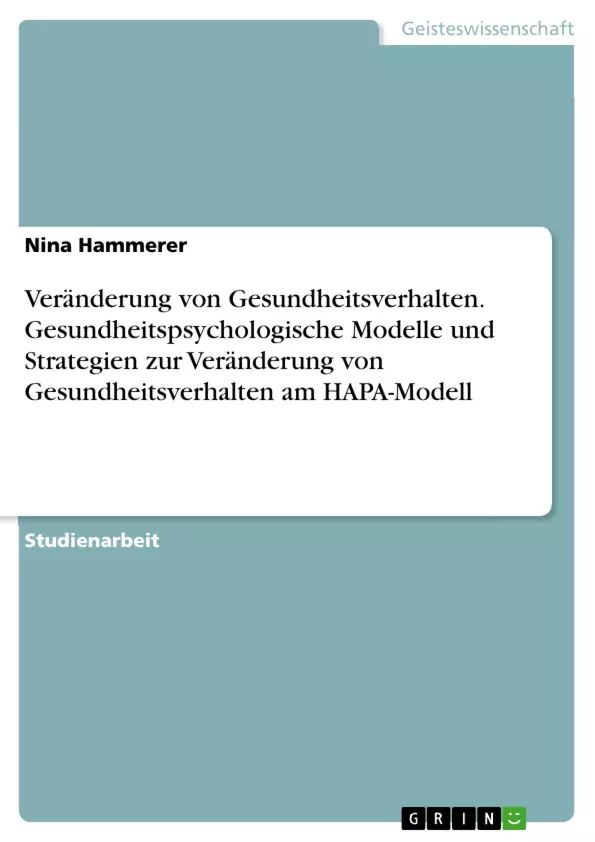Diese Arbeit liefert einen Überblick über verschiedene gesundheitspsychologische Theorien und Modelle. Außerdem wird das HAPA-Modell in einem praxisnahen Beispiel herangezogen, um Strategien zur Veränderung von Gesundheitsverhalten in der Anwendung darzustellen. Wie verläuft ein Motivationsprozess zur Verhaltensänderung? Wie können Personen dabei unterstützt werden, ihr Verhalten gesundheitsförderlich zu verändern? Welche Methoden gibt es und was gilt es zu beachten?
Ziel der Hausarbeit ist es, dem Leser themenbezogene Begrifflichkeiten zu erklären sowie Theorien und Modelle der Gesundheitspsychologie vorzustellen, um anschließend eines davon durch ein konkretes Praxisbeispiel näher zu erläutern. Zudem sollen die Grenzen der gesundheitspsychologischen Ansätze zu anderen Disziplinen diskutiert werden.
Dazu werden unter Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen in Bezug zu den Begriffen Gesundheit und Krankheit sowie das Fach Gesundheitspsychologie näher beleuchtet, um danach in Kapitel 3 eine Auswahl relevanter gesundheitspsychologischer Modelle sowie Theorien vorzustellen. Kapitel 4 widmet sich dem HAPA-Modell, eines der im Theorieteil vorgestellten Modelle, und zieht ein Beispiel heran, um die Anwendung in der Praxis zu erklären. Dabei werden konkrete Umsetzungen zur Verhaltensveränderung als auch mögliche Strategien detailliert erläutert. Letztendlich zeigt eine kritische Diskussion unter Kapitel 5 die Grenzen einer rein gesundheitspsychologischen Herangehensweise auf und stellt andere, für das Erreichen einer Verhaltensänderung wesentlichen Disziplinen, vor.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Genderhinweis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Gesundheitspsychologie
- 2.2. Gesundheit und Krankheit
- 2.3. Theorie und Modell
- 3. Gesundheitspsychologische Theorien und Modelle
- 3.1. Biomedizinisches Krankheitsmodell
- 3.2. Biopsychosoziales Gesundheitsmodell
- 3.3. Sozial-kognitive Lerntheorie
- 3.4. Theory of Reasoned Action und Theory of Planned Behavior
- 3.5. Health Belief Modell - Modell gesundheitlicher Überzeugungen
- 3.6. Transtheoretisches Modell der Verhaltensänderung
- 3.7. HAPA-Modell
- 4. Strategien für die Veränderung von Gesundheitsverhalten am HAPA-Modell
- 4.1. Darstellung des Beispiels
- 4.2. Präintentionale Phase
- 4.3. Postintentionale Phase
- 4.4. Präaktionale Phase
- 4.5. Aktionale Phase
- 4.6. Postaktionale Phase
- 5. Kritische Diskussion
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Themenfeld der Gesundheitspsychologie und untersucht verschiedene Theorien und Modelle, die sich mit der Veränderung von Gesundheitsverhalten befassen. Insbesondere wird das HAPA-Modell im Detail betrachtet und seine Anwendung anhand eines Praxisbeispiels verdeutlicht.
- Entwicklung und Wandel der Gesundheitspsychologie
- Relevante Theorien und Modelle zur Verhaltensveränderung im Gesundheitsbereich
- Das HAPA-Modell und seine Anwendung in der Praxis
- Grenzen der gesundheitspsychologischen Herangehensweise
- Bedeutung anderer Disziplinen für die Verhaltensveränderung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Gesundheitspsychologie und definiert zentrale Begriffe wie Gesundheit und Krankheit. Kapitel 3 stellt verschiedene gesundheitspsychologische Theorien und Modelle vor, darunter das biomedizinische Krankheitsmodell, das biopsychosoziale Gesundheitsmodell und die Theorie des geplanten Verhaltens. Kapitel 4 widmet sich dem HAPA-Modell und zeigt seine Anwendung anhand eines konkreten Praxisbeispiels auf. Die Kapitel 5 und 6 werden in diesem Preview nicht berücksichtigt, da sie die Schlussfolgerungen der Arbeit und die kritische Diskussion beinhalten.
Schlüsselwörter
Gesundheitspsychologie, Gesundheitsverhalten, Verhaltensänderung, Theorien, Modelle, HAPA-Modell, Biomedizinisches Krankheitsmodell, Biopsychosoziales Gesundheitsmodell, Sozial-kognitive Lerntheorie, Theorie des geplanten Verhaltens, Health Belief Modell, Transtheoretisches Modell.
- Arbeit zitieren
- Nina Hammerer (Autor:in), 2020, Veränderung von Gesundheitsverhalten. Gesundheitspsychologische Modelle und Strategien zur Veränderung von Gesundheitsverhalten am HAPA-Modell, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/963008