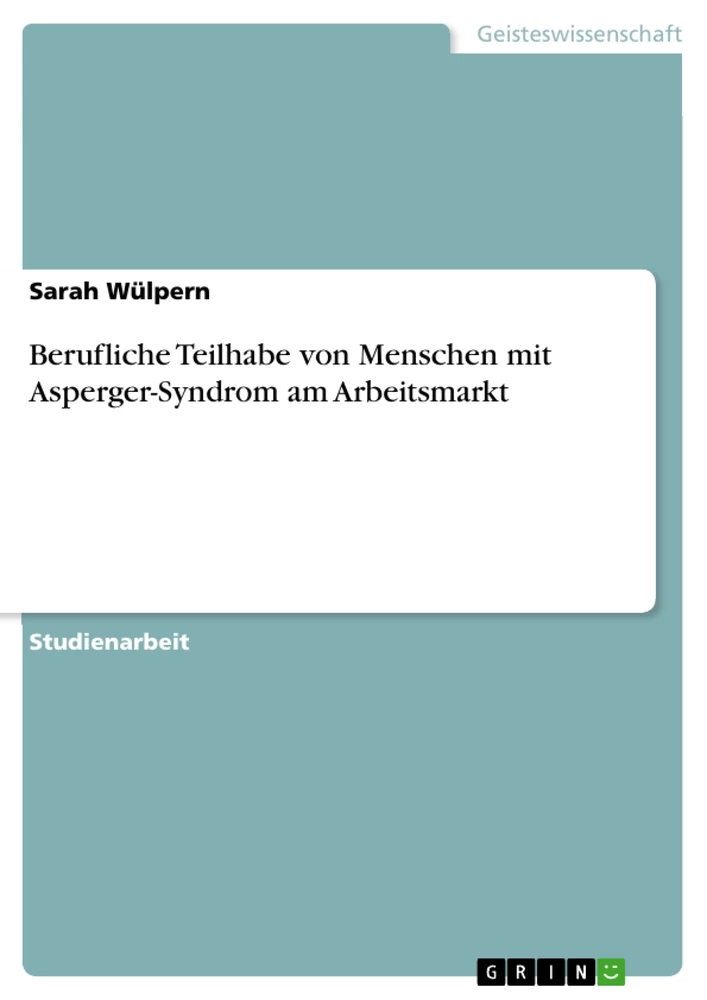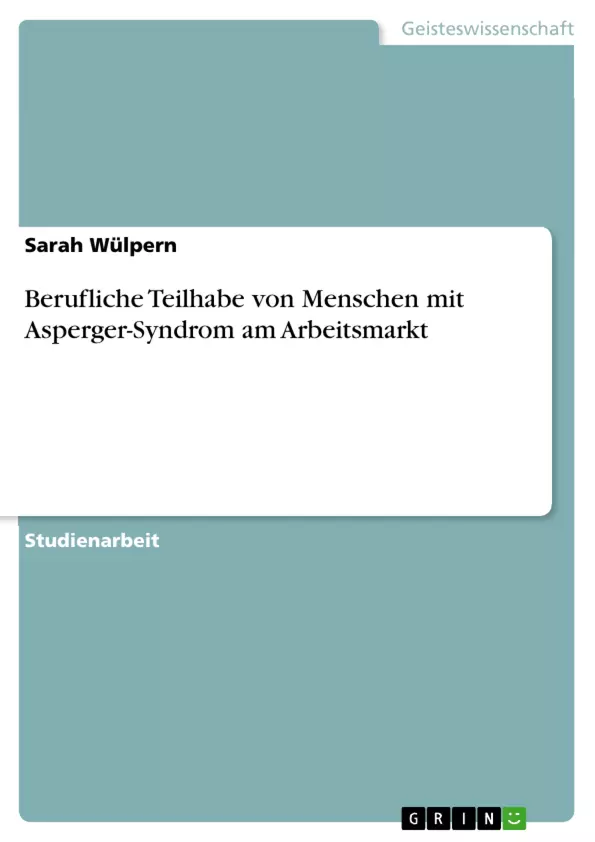Die Arbeit beschäftigt sich mit der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Asperger-Syndrom am Arbeitsmarkt. Bislang finden die lebenswichtigen Aspekte der Berufstätigkeit viel zu wenig Beachtung. Die Teilhabe am Arbeitsmarkt bildet einen wichtigen Faktor im Leben aller Menschen, so auch im Leben von Menschen mit Asperger-Syndrom. Sie trägt einen wesentlichen Teil zur Lebenszufriedenheit und zur sozialen Eingliederung bei. Die Beschäftigungssituation von autistischen Menschen ist seit über 20 Jahren als unzufriedenstellend zu bewerten.
Ziel der Arbeit ist es, Hürden und Chancen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt aufzuzeigen, sowie Möglichkeiten der besseren Eingliederung nahezulegen. Dazu wird im Kapitel 2 zunächst die Autismus-Spektrum-Störung allgemein und die Unterkategorie das Asperger-Syndroms kurz erläutert. Danach werden in Kapitel 3 Fakten zur aktuellen Situation aufgeführt und die Hürden, Stärken sowie Techniken näher analysiert. In Kapitel 4 wird das Unternehmen auticon vorgestellt, welches mit gutem Bespiel voran geht und einen erheblichen Teil zur besseren Eingliederung von Menschen mit Asperger-Syndrom beiträgt und vielen Menschen eine berufliche Zukunft ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Autismus-Spektrum-Störung
- Hintergrund
- Definition
- Das Asperger-Syndrom
- Hintergrund
- Kennzeichen
- Berufliche Teilhabe am Arbeitsmarkt
- Aktuelle Situation
- Einstieg in die Berufswelt
- Hürden
- Stärken
- Faktoren zur Inklusionserleichterung
- Akzeptanz
- Ruhige und stressarme Umgebung
- Struktur
- Einarbeitung
- Zeit geben
- Flexibilität zeigen und Inflexibilität zulassen
- Weniger Licht
- Nachsicht bei Kommunikation
- Zeit allein
- Allgemeine Rahmenbedingungen
- Das Unternehmen auticon
- Hintergrund
- Unternehmenskonzept
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Asperger-Syndrom am Arbeitsmarkt und analysiert die Herausforderungen, die sie im Berufsleben meistern müssen.
- Erläuterung der Autismus-Spektrum-Störung und des Asperger-Syndroms
- Analyse der aktuellen Situation von Menschen mit Asperger-Syndrom am Arbeitsmarkt
- Identifizierung von Hürden und Stärken, die mit dem Asperger-Syndrom im Berufsleben verbunden sind
- Vorstellung von Faktoren, die die Inklusion von Menschen mit Asperger-Syndrom am Arbeitsplatz erleichtern
- Das Unternehmen auticon als Beispiel für erfolgreiche Inklusion von Menschen mit Asperger-Syndrom
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen einleitenden Einblick in das Thema und die Relevanz der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Asperger-Syndrom. Kapitel 2 erläutert die Autismus-Spektrum-Störung und das Asperger-Syndrom. Dabei werden die Definition, die Geschichte und die Kennzeichen dieser Störung näher betrachtet.
Kapitel 3 analysiert die aktuelle Situation von Menschen mit Asperger-Syndrom am Arbeitsmarkt und beleuchtet die Hürden, die sie beim Einstieg in die Berufswelt erleben. Darüber hinaus werden die Stärken von Menschen mit Asperger-Syndrom und Faktoren, die die Inklusion am Arbeitsplatz erleichtern, diskutiert.
Kapitel 4 stellt das Unternehmen auticon vor, welches sich auf die Beschäftigung von Menschen mit Asperger-Syndrom konzentriert und erfolgreich ein integratives Unternehmenskonzept umgesetzt hat.
Schlüsselwörter
Asperger-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung, berufliche Teilhabe, Inklusion, Arbeitsmarkt, Hürden, Stärken, Unternehmen auticon
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Menschen mit Asperger-Syndrom Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt?
Hürden liegen oft in der sozialen Kommunikation, Reizüberflutung am Arbeitsplatz und mangelndem Verständnis der Arbeitgeber für die Besonderheiten der Autismus-Spektrum-Störung.
Welche Stärken bringen Autisten in das Berufsleben ein?
Häufige Stärken sind eine hohe Konzentrationsfähigkeit, Detailgenauigkeit, logisches Denken und eine ausgeprägte Zuverlässigkeit in strukturierten Aufgabenbereichen.
Was ist das Unternehmen „auticon“?
Auticon ist ein Unternehmen, das gezielt Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants einstellt und so ein integratives Geschäftsmodell erfolgreich umsetzt.
Wie kann ein Arbeitsplatz inklusiver gestaltet werden?
Durch eine ruhige, stressarme Umgebung, klare Strukturen, Nachsicht bei der Kommunikation und die Möglichkeit für Rückzugszeiten oder weniger helles Licht.
Was bedeutet berufliche Teilhabe für Menschen mit Asperger?
Sie ist ein wesentlicher Faktor für die Lebenszufriedenheit und soziale Eingliederung, wird aber seit über 20 Jahren als oft unzufriedenstellend bewertet.
- Quote paper
- Sarah Wülpern (Author), 2020, Berufliche Teilhabe von Menschen mit Asperger-Syndrom am Arbeitsmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/963360