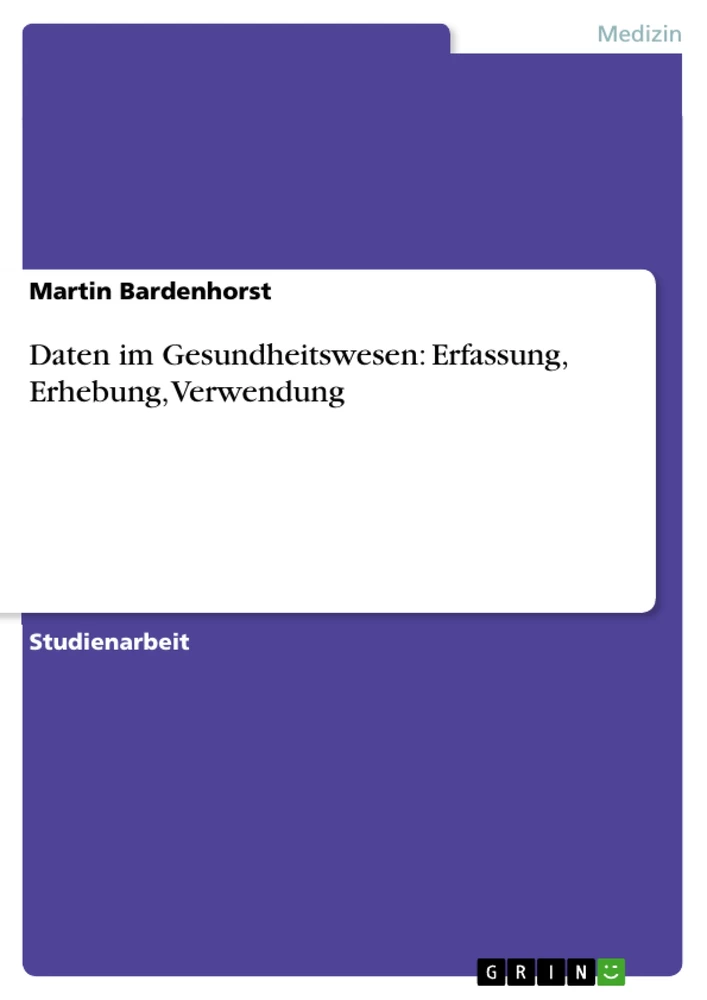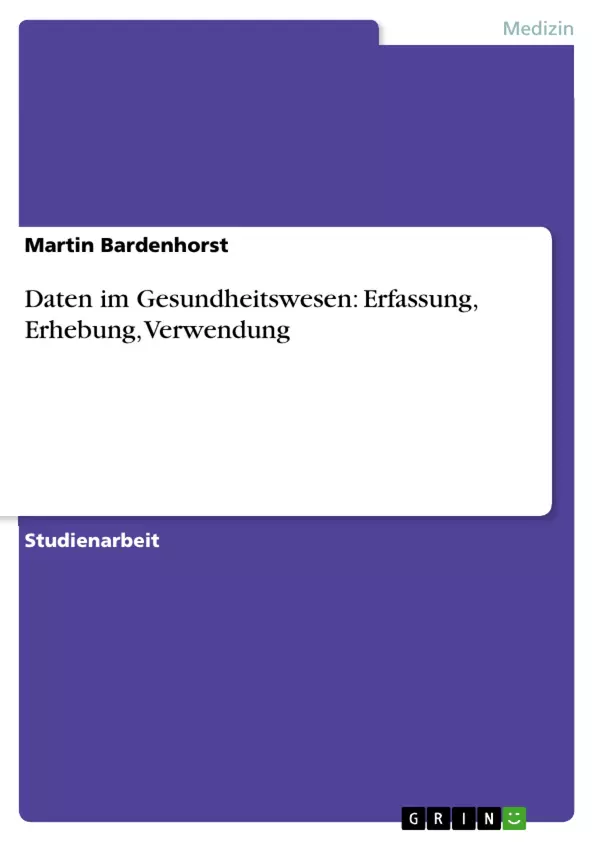Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
I. Einleitung
II. Ziele des Datenschutzes
1. Grundlagen des Datenschutzes
2. Geltungsbereich des BDSG
III. Sozialdaten und Sozialdatenschutz
1. Definition: Sozialdaten
2. Sozialgeheimnis
3. Datenerhebung
4. Datenerfassung und Datenübermittlung
IV. Daten im Bereich des Gesundheitswesens
1. Sozialdatenschutz bei den Krankenkassen
2. Personenbezogene Daten bei Krankenkassen und KV
3. Leistungsdaten
4. Weitere Verwendung der Daten im Gesundheitswesen
4.1. Risikostrukturausgleich und Medizinischer Dienst der Krankenkassen
4.2. Krebsregister
4.3. Gesundheitstelematik
V. Folgen der Gesundhe itsreform 2000: Gläsener Patient - Gläsener Arzt?
1. Gesetzesentwurf Gesundheitsreform 2000
2. Sozialdatenschutz: Änderungen durch die Gesundheitsreform 2000
2.1. Zentrale Erfassung und Auswertung von Patientendaten
2.2. Diagnoseverschlüsselung nach ICD 10
3. Standpunkte zu den vorgesehenen Änderungen
3.1. Datenschutz
3.2. Ärzteverbände
4. Neuregelung
VI. Weitere Entwicklung und Fazit
Literaturverzeichnis
Erklärung zur Haus-/Diplomarbeit gemäß § 26 Abs. 6 DiplPrüfO
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I. Einleitung
Mit dem 01.01.2000 soll die Gesundheitsreform 2000 in Kraft treten. Ziel ist es die Struktur des Gesundheitswesens zu verbessern. Damit soll die Qualität erhöht und gesichert , Wirtschaftlichkeit gewährleistet und die Beiträge stabil gehalten werden.
Ausreichend Finanzmittel sind vorhanden, um die erwähnten Ziele zu erreichen. Das Problem ist eine Differenz in der Versorgung verschiedener Bereiche. So gibt es auf der einen Seite Überversorgungen wie z. B. bei Operationen oder Untersuchungen, während auf der anderen Seite chronisch Kranke unterversorgt sind. Auch werden manche Gesundheitsberufe nicht berücksichtigt. Es müssen also Wege gefunden werden, diese Unterschiede abzubauen und die vorhandenen Mittel effektiv einzusetzen.1
Um den Handlungsbedarf für die Bereiche des Gesundheitswesens zu ermitteln, werden In- formationen benötigt. Bei der Sammelung dieser Auskünfte ist zu beachten, dass es sich um Daten aus persönlichen Bereichen handelt. Hier ergibt sich ein Interessenskonflikt. Zur Steue- rung des Gesundheitswesens werden diese Daten benötigt. Dies ist im Interesse der Allge- meinheit. Der Einzelne hat aber ein Recht auf den Schutz seiner Persönlichkeitssphäre, zu der auch seine Daten zählen.
Ich möchte in dieser Hausarbeit darstellen, wie der Schutz dieser Daten im Gesundheitswesen geregelt ist und für welche Aufgaben Daten gesammelt werden dürfen oder müssen. Außerdem gehe ich auf die vorgesehenen Änderungen der Gesundheitsreform 2000 im Bereich des Datenschutzes und der Datenerfassung ein
II. Ziele des Datenschutzes
1. Grundlagen des Datenschutzes
Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes sind im BDSG geregelt. Es wurde zum 01.01.1978 eingeführt. Dieses Gesetz trat zu vorher bereits geltenden Landesdaten- schutzvorschriften hinzu. Der Datenschutz wurde allgemein für den öffentlichen sowie den privaten Bereich festgelegt. Motiv für dieses Gesetz war die Befürchtung, dass der technische
Fortschritt bei der Arbeit mit Daten auch einen erhöhten Missbrauch zur Folge haben könnte.2
Die Ziele des BDSG sind im § 1 Abs. 1 BDSG definiert:
„Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinen Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“
Das Persönlichkeitsrecht gehört zu den Grundrechten, die vom Grundgesetz besonders geschützt werden.3 Mit dem BDSG soll insbesondere das Recht auf informelle Selbstbestimmung gewahrt werden.
„Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.“
Das BDSG spricht hier von Betroffenen.4 Im BDSG ist der Umgang mit diesen personenbezogenen Daten festgelegt. Es werden die Grundsätze aufgestellt, nach denen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.5
2. Geltungsbereich des BDSG
Uneingeschränkt gilt das BDSG für die öffentlichen Einrichtungen des Bundes wie z. B. Bundesbehörden. Für nicht öffentliche Stellen gilt das Gesetz, soweit diese personenbezogene Daten geschäftsmäßig, gewerblich oder beruflich nutzen. Für öffentliche Stellen der Länder ist der Anwendungsbereich durch eventuell vorhandene Datenschutzregelungen der Länder eingeschränkt. Diese sind dann vorrangig. Führen diese Stellen Bundesrecht aus oder handelt es sich um Rechtspflegeorgane, fallen sie wiederum unter das BDSG.6
Eine weitere Einschränkung erfährt das BDSG durch eventuell vorhandene bereichsspezifische Regelungen. In Bereichen, in denen die allgemeinen Regelungen des BDSG nicht ausreichen, werden durch spezielle Gesetze Normen entworfen, die den Datenschutz für diesen Bereich sowohl verschärfen als auch entkräften können. Als Beispiel sei das Sozialgesetzbuch genannt.7 Es enthält Datenschutzbestimmungen für den Bereich der Sozialversicherung.
III. Sozialdaten und Sozialdatenschutz
1. Definition: Sozialdaten
Das BDSG legt allgemeine Datenschutznormen fest. Für den Bereich der sozialen Sicherung wurden weitere spezielle Regelungen erlassen. Es gibt eine allgemeine Regelung im § 35 SGB I sowie erweiterte Regelungen durch die §§ 67ff SGB X. Diese gelten als Spezialrecht für den Sozialversicherungsbereich seit dem 01.01.1980 und betreffen den Schutz der Sozial- daten.8
Bei den Sozialdaten handelt es sich zum einen um personenbezogene Daten. Zum anderen fallen hierunter betriebs- oder geschäftsbezogene Daten mit Geheimnischarakter. Die Sozialdaten werden von den Sozialversicherungsträgern erhoben, verarbeitet oder genutzt.
Erheben beschreibt die Datenbeschaffung. Verarbeiten ist das Speichern, Sperren, Übermitteln und Löschen der Sozialdaten. Nutzen ist die Datenverwendung.9
Diese Daten werden von den Sozialversicherungsträgern benötigt, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie haben für die umfassende und schnelle Versorgung der Versicherten mit Sozialleistungen zu sorgen und die dafür notwendigen sozialen Dienste und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Der Zugang zu den Leistungen soll so einfach wie möglich sein.10
2. Sozialgeheimnis
Das Sozialgeheimnis ist ein Recht des Bürgers, dessen Sozialdaten bei einem Sozialversicherungsträger gespeichert sind. Die Sozialversicherungsträger haben die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Sozialdaten nur Befugten zur Verfügung stehen und auch nur an solche weitergegeben werden. Dies gilt auch für die Arbeit mit Sozialdaten innerhalb der Träger.11
Das Sozialgeheimnis steht auf derselben Ebene wie z. B. das Steuergeheimnis oder die ärztli- che Schweigepflicht. Kein Bürger soll durch die Inanspruchnahme von Sozialleistungen ei-nem stärkeren staatlichen Zugriff durch Bekanntgabe seiner Daten ausgesetzt sein als ande- re.12
Kontrolliert wird der Schutz des Sozialgeheimnisses vom Bundesbeauftragten für Datenschutz sowie von den Landesbeauftragten. Ab einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern sind auch die Sozialversicherungsträger verpflichtet, interne Datenschutzbeauftragte einzustellen. Diese überwachen die Einhaltung des Datenschutzes innerhalb des Trägers.13
3. Datenerhebung
Die Sozialversicherungsträger dürfen Sozialdaten nur soweit erheben, wie es im Rahmen ihrer Aufgaben notwendig ist. Es gilt der Grundsatz der Datenerhebung beim Betroffenen. Das bedeutet, dass sich bei der Erhebung der Träger zuerst an denjenigen wenden muss, dessen Daten er benötigt. Dabei ist der Grund für die Erhebung der Daten dem Betroffenen anzugeben, beim Vorliegen einer Rechtsvorschrift ist diese auch mitzuteilen.
Dieser Grundsatz gilt nicht uneingeschränkt. Eine Datenerhebung bei Dritten ist möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Dies kann der Fall sein, wenn die Erhebung beim Betroffenen einen zu großen Aufwand darstellt, eine andere Rechtsvorschrift eine Übermittlung vorschreibt oder die Interessen des Betroffenen durch die Übermittlung nicht gefährdet werden.14
Bei der Inanspruchnahme bestimmter Sozialleistungen ist der Betroffene gesetzlich verpflichtet, dem Sozialleistungsträger seine Sozialdaten zur Verfügung zu stellen. Auf diese Auskunftspflichten muss der Träger, bei dem die Leistungen beantragt oder genutzt wird, hinweisen. Es gibt generelle Auskunftspflichten, die einen größeren Bereich abdecken und spezielle Auskunftspflichten, die fallbezogen sind.15
Bei der Beantragung von Sozialleistungen hat der Betroffene alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung von Bedeutung sind. Als Beispiel für solche Mitwirkungspflichten können das persönliche Erscheinen oder für die Entscheidung über die Gewährung der Leistung notwendige ärztliche Untersuchungen angeführt werden.16
Die Mitwirkungspflichten sind nicht unbegrenzt. Bei Unzumutbarkeit der Erfüllung oder bei gefährlichen Untersuchungen kann die Mitwirkung abgelehnt werden.17 Der Sozialleistungsträger kann bei fehlender Mitwirkung die Leistung versagen oder entziehen. Der Betroffene muss hierauf hingewiesen werden. Weiterhin ist eine angemessene Frist zur Erfüllung der Pflicht zu setzen. Die Erfüllung kann nachgeholt werden.18
Für Verfahrensbeschleunigungen kann es vorkommen, dass der Betroffene um die freiwillige Angabe von Daten gebeten wird. Der Träger muss dann auf die Freiwilligkeit hinweisen und kann diese Angaben nicht erzwingen.
Einwilligungserklärungen des Betroffenen sind nötig, wenn Daten zur Antragsbearbeitung von anderen Stellen eingeholt werden müssen. Über die Tragweite und den Inhalt dieser Erklärung muss der Betroffene vorher aufgeklärt werden.
4. Datenerfassung und Datenübermittlung
Mit der Aufnahme einer Beschäftigung beginnt für den Arbeitnehmer in der Regel die Versicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung. Die Anmeldung wird vom Arbeitgeber vorgenommen. Somit gelangen die Sozialdaten in das System der sozialen Sicherung. Die personenbezogenen Daten werden nach der DEÜV an die einzelnen Sozialversicherungsträger weitergegeben. Die Krankenkassen sind die zentralen Stellen für diese Meldungen. Sie ziehen auch den Gesamtsozialversicherungsbeitrag vom Arbeitgeber ein, und sorgen für die richtige Aufteilung dieser Gelder auf die einzelnen Träger.19
Die in der Abbildung dargestellten Datenflüsse stellen den Regelfall dar. Besondere Versiche- rungsverhältnisse wie z. B. von Zivil - oder Wehrdienstleistenden sind nicht berücksichtigt. Die Daten der Angestellten werden direkt an die BfA nach Berlin übermittelt. Bei Arbeitern erhalten die LVAn die Daten nicht direkt. Sie werden zuerst an die Datenstelle der Rentenver-sicherungsträger übermittelt und von dort an die zuständige LVA weitergeleitet. Die Daten-stelle führt eine Datei aller vergebenen Versicherungsnummern mit Name des Versicherten und zuständigem Rentenversicherungsträger. Damit sollen Fehler wie z. B. Doppelvergabe von Nummern vermieden werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: DEÜV Datenflüsse, Quelle: o.V., Der Bürger und seine Daten S. 37
Die Meldungen der Arbeitgeber sollen durch elektronische Datenübertragung oder auf maschinell verwendbaren Datenträgern erfolgen.20 Für die Weiterleitung unter den Sozialversicherungsträgern ist die elektronische Datenübertragung vorrangig. Andere Verfahren sind nur in Ausnahmefällen zugelassen.21
Im SGB sind weitere Tatbestände beschrieben, in denen Sozialdaten übermittelt werden kön- nen. Hierzu zählen die Amtshilfe für Polizei und Staatsanwaltschaft oder die Verwendung der Daten für soziale Aufgaben sowie die Übermittlung für wissenschaftliche Forschung und Pla- nung.22 Die übermittelnde Stelle hat die Zulässigkeit der Übermittlung sicherzustellen, auch wenn die Übermittlung auf Antrag erfolgt.23 Eine Übermittlungsverpflichtung ergibt sich aber aus den §§ 67d ff. SGB X nicht. Solche weitergehenden Pflichten sind an anderer Stelle des SGB geregelt.24 So beruht die bereits erwähnte Pflicht zur Amtshilfe auf § 3 SGB X.
Eingeschränkt wird die Übermittlung durch die §§ 76-78 SBG X. Sozialdaten, die der Schweigepflicht des Arztes unterliegen, dürfen von den Sozialversicherungsträgern nur weitergegeben werden, wenn auch der Arzt im Rahmen dieser Pflicht dazu berechtigt ist. An das Ausland dürfen Sozialdaten nur für die Erfüllung sozialer Aufgaben, für Maßnahmen des Arbeitsschutzes und für Strafverfolgungen übermittelt werden. Empfänger, die nicht dem Sozialgeheimnis unterliegen, dürfen die ihnen übermittelten Daten nur zu den angegebenen Zwecken verwenden. Beispiele für solche Stellen sind Arbeitgeber oder Banken.
Weiterhin hat der Betroffene Rechte an seinen Sozialdaten. Er kann sich an den Bundesbeauf- tragten für Datenschutz wenden, wenn er seine Rechte verletzt sieht. Außerdem hat er ein Auskunftsrecht, kann Schadenersatz und die Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten verlangen.25
IV. Daten im Bereich des Gesundheitswesen
1. Sozialdatenschutz bei den Krankenkassen
Im 10. Kapitel des SGB V ist der Schutz der Sozialdaten für den Bereich der Krankenversi- cherung geregelt. Eingeführt wurden diese Normen mit dem GRG vom 01.01.1989. Im GSG vom 01.01.1993 wurden sie vervollkommnet. Die Normen orientieren sich an den allgemei- nen Datenschutzgrundsätzen des BDSG und treten ergänzend neben die bereits erwähnten Regelungen im SGB.
Die Krankenkassen sollen durch die oben genannten weitergehenden Bestimmungen die Möglichkeit erhalten, die Informationsflut im Gesundheitswesen zu bewältigen. Hierbei sollte insbesondere die maschinelle Datenverarbeitung genutzt werden. Die Kassen sollen einen umfassenderen Überblick über die Leistungen bekommen und in der Lage sein, die Wirt-schaftlichkeit und die Qualität der Leistungserbringer wirksam zu überprüfen. Insgesamt soll dadurch die Aufgabenerfüllung der Kassen verbessert werden.26
2. Personenbezogene Daten bei Krankenkassen und KV
Grundsätzlich dürfen die Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen personenbezogene Daten nur erheben und speichern, wenn es ihren Aufgaben dient. Diese Aufgaben sind in den §§ 284, 285 SGB V abschließend geregelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ärztliche und ärztlich verordnete Leistungen dürfen nur in Ausnahmefällen von den Kran- kenkassen versichertenbezogen gespeichert werden. Die Ausnahmen umfassen die Prüfung der Leistungspflicht und Leistungsgewährung, die Abrechnung mit den Leistungserbringern und anderen Leistungsträgern, die Überwachung des Wirtschaftlichkeitsgebots sowie die Rückzahlung von Beiträgen.27 Die KV darf versichertenbezogene Daten nur bei Wirtschaft- lichkeits- und Qualitätsprüfungen anwenden.28 Leistungserbringer- oder fallbeziehbar dürfen Daten für befristete Forschungsvorhaben gespeichert werden, wenn diese epidemiologischer Forschung, der Erforschung des Zusammenhangs von Arbeitsbedingungen und Erkrankungen oder der Erforschung lokaler Krankheitsschwerpunkte dienen.29
Die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung stellen jährlich eine Datenübersicht auf, die alle bei ihnen gespeicherten Sozialdaten enthält.30 Bei den Krankenkassen ist diese Aufstellung die Mitgliederdatei. Sie enthält Angaben zur Person des Versicherten wie Krankenversicherungsnummer, Name und Anschrift. Diese Daten werden auch zur Ausstellung der Krankenversicherungskarte verwendet.31
Die Krankenkasse darüber hinaus verpflichtet, ein Versichertenverzeichnis zu führen. Dieses muss alle notwendigen Daten für die Feststellung der Versicherungspflicht und Versicherungsberechtigung, zur Beitragsbemessung und Einziehung sowie zur Feststellung der Leistungsansprüche enthalten. Zu den Leistungsansprüchen zählt auch die Familienversicherung. Die Daten, die zur Feststellung dieses Anspruches benötigt werden, sind zu speichern.32 Für den Versicherten besteht eine Nachweispflicht für die Voraussetzungen.33
Die Sozialdaten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung nicht zulässig war oder wenn ihre weitere Speicherung für die Erfüllung der Aufgaben nicht mehr notwendig ist34. Bei einem Wechsel der Krankenkasse ist die alte Kasse verpflichtet, der neuen Kasse die notwendigen Daten für die Weiterführung der Versicherung mitzuteilen.
3. Leistungsdaten
Die Leistungsdaten werden von den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung zur Abrechnung benötigt. Die einzelnen Leistungserbringer sind verpflichtet, diese aufzuzeichnen und zu übermitteln.35 Der Umfang der aufzuzeichnenden Daten ist bei den verschiedenen Leistungserbringern unterschiedlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Diagnosen der Vertragsärzte der Krankenhäuser und Rehaeinrichtungen müssen nach dem ICD verschlüsselt werden. Näheres zum ICD wird unter Punkt V. 2.2 erläutert.
Aus den Daten, die von den Leistungserbringern übermittelt werden, egen die Krankenkassen folgende Dateien an:
- Leistungsdatei
- Sachleistungsdatei
- Abrechnungsdatei ambulanter ärztlicher Behandlung pro Quartal
- Arzt- Versichertenbezogene Datei pro Quartal
- Monatliche Datei der abgerechneten Arzneiversorgung
- Zahnersatzdatei36
In der Leistungs- und in der Sachleistungsdatei werden Informationen über die Leistungen gespeichert, mit denen die Krankenkasse direkt zu tun hat. Hierzu zählen Arbeitsunfähig-keitszeiten, Krankenhausaufenthalte oder das gezahlte Krankengeld.37 Diese Daten werden versichertenbezogen übermittelt oder liegen den Krankenkassen bereits vor und werden gespeichert.
Daten über die vertragsärztliche Versorgung werden von den Ärzten an die KV übermittelt. Hier werden sie zur Abrechnung der erbrachten Leistungen benötigt.38 Die KV darf diese Daten nur im Rahmen von Prüfverfahren, die die Wirtschaftlichkeit und die Qualität der vertragsärztlichen Leistungen betreffen, den Krankenkasse versichertenbezogen weiterleiten.39 Hierzu zählen die Auffälligkeits- und Zufälligkeitsprüfungen.40 Die Abbildung zeigt die wichtigsten Datenübermittelungen im Bereich der Krankenkasse.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 Datenflüsse im Rahmen der Abrechnung von Leistungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung, Der Bürger und seine Daten, S. 42
4. Weitere Verwendung der Daten im Gesundheitswesen
4.1. Risikostrukturausgleich und Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
Neben den im 10. Abschnitt des SGB V angegebenen Verwendungsarten für die Daten der Krankenkassen sind noch zwei weitere gesetzliche Regelungen in diesem Gesetzbuch bedeutend für den Umgang mit Versichertendaten.
Dazu gehört erstens der RSA, der jährlich zwischen allen gesetzlichen Krankenkassen durch- geführt wird. Mit ihm sollen die finanziellen Auswirkungen der unterschiedlichen Versicher- tenstruktur der einzelnen Kassen ausgeglichen werden. Zu den Strukturmerkmalen zählen Einnahmen der Mitglieder, Anzahl der Familienversicherten und die Alters- bzw. Ge- schlechtsverteilung. Die Krankenkassen erheben für jedes Geschäftsjahr die Beitragseinnah- men und die Leistungsausgaben. Als weiteres sind die beitragspflichtigen Einnahmen getrennt nach allgemeiner Krankenversicherung und Krankenversicherung der Rentner zu erheben. Zum 01.10. eines Jahres wird die Mitgliederanzahl und die Zahl der Familienversicherten getrennt nach Alter, Geschlecht und Mitgliedergruppe festgestellt. In Abständen von längs- tens drei Jahren sollen die Leistungsausgaben differenziert erfasst werden. Es erfolgt eine Trennung der Ausgaben und der Krankengeldtage nach Alter und Geschlecht. Zusätzlich sind die Krankengeldtage und Krankengeldausgaben in die verschiedenen Mitgliedergruppen zu gliedern.41 Die Ergebnisse der Datenerhebung müssen die Krankenkassen bis zum 31.05. des folgenden Jahres dem BMG vorlegen.42
Als weiteres sind die Krankenkassen in bestimmten Fällen verpflichtet, vor der Genehmigung oder der Fortsetzung von Leistungen ein medizinisches Gutachten einzuholen. Dies kann bei Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit, der Genehmigung von Kuren oder der Zahnersatzversor- gung der Fall sein. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen unterstützt diese bei der Klä- rung solcher medizinischer Fachfragen und stellt die benötigten Gutachten aus.43 Die Kran- kenkassen müssen dem MDK alle für die Beurteilungen notwendigen Daten zu Verfügung stellen. Der MDK darf diese nur zur Erfüllung seiner Aufgaben speichern. Nach fünf Jahren muss der MDK diese Daten löschen.44
4.2. Krebsregister
Mit dem Bundeskrebsregistergesetz vom 01.01.1995 wurden alle Bundesländer verpflichtet, bis zum 01.01.1999 Krebsregister aufzubauen. Es wird unterschieden zwischen klinischen Registern, die den individuellen Krankheitsverlauf von Patienten schildern und bevölkerungs- bezogenen Registern, in denen die Erkrankungsraten der Bevölkerung erfasst werden. Das Gesetz sieht die Verwendung beider Registerarten zur Aufstellung der Landesregister vor. Die Meldungen sollen über die klinischen Register erfolgen. Diese Meldungen müssen mit ein-heitlichen Meldebögen erfasst werden. Bisher ist das nur in einigen Bundesländern der Fall. Diese Meldebögen greifen auch auf internationale Standards zur Einordnung der verschiedenen Tumorarten zu, um die Studien vergleichbar zu machen.
Mit Hilfe der Informationen, die durch die Register zur Verfügung stehen, soll die Behand- lungsqualität bei Tumorerkrankungen gesichert und verbessert werden, wie z. B durch Ver- gleiche verschiedener Behandlungen und Therapien. Der Arzt kann sich und den Patienten auf denkbare Krankheiten im Zusammenhang mit dem Tumor vorbereiten. Auch werden neue Behandlungsverfahren schneller verbreitet, da durch die mögliche Online - Erfassung diese Register sehr aktuell sind und für Arzt und Patienten eine Informationsdrehscheibe darstellen. Ein weiteres Ziel ist eine verbesserte Betreuung während und nach der Erkrankung. Die Re- gister können als Beispiel die rechtzeitige Durchführung von Nachsorgeuntersuchungen ü- berwachen.45
4.3. Gesundheitstelematik
Gesundheitstelematik ist die Bezeichnung für die Verwendung moderner Kommunikations- und Informationssysteme im Gesundheitswesen. Beispiele hierfür sind das Internet als Infor- mationsmedium oder der Ersatz des Krankenscheins durch Chipkarten. Ziel ist eine schnelle- re, billigere und bessere Bereitstellung von Daten und Wissen für die verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens.46
Die Fortschritte durch die Telematik können von allen Beteiligten des Gesundheitswesens genutzt werden. Patienten können aktiver bei ihrer Behandlung mitwirken, da sich ihnen mehr Möglichkeiten bieten, Informationen über Erkrankungen und Behandlungen zu bekommen. Die Leistungserbringer können ihren Patienten eine qualitativ bessere Versorgung bieten. Ih- nen stehen mehr Daten über die Krankheitsgeschichte der Patienten zur Verfügung. Außer- dem verbreiten sich neue Therapie-, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten schneller.
Für die Wissenschaft bedeutet der schnelle Informationsaustausch eine Erleichterung von Diskussionen, die schneller zu neuen medizinischen Erkenntnissen führen können.
Eine verbesserte Datenbasis verdeutlicht die angefallenen Kosten und durchgeführten Leis-tungen im Gesundheitswesen. Das ermöglicht der Politik und der Verwaltung gezielte Eingriffe zur Verbesserung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Die Steuerung der Finanzierung wird vereinfacht.47
In Deutschland ist die Anwendung der Telematik noch nicht verbreitet. Sie beschränkt sich auf die Einführung der Krankenversicherungskarte als Ersatz für den Krankenschein, die elektronische Übermittlung von Abrechnungsdaten sowie die Einführung des internationalen Diagnoseschlüssels ICD in den Krankenhäusern.
Um die Anwendung der Telematik in Deutschland voranzutreiben, ist ein „Aktionsforum für Telematik im Gesundheitswesen“ von den Spitzenorganisationen des Gesundheitswesens gegründet worden. Als erstes wird von diesem Forum die Einführung von Standards für Telematiktechnik und einheitlicher Kommunikationsformen gefordert. Als Telematikanwendungen, die in naher Zukunft in Deutschland eingesetzt werden sollen, nennt das Forum das elektronische Rezept für Arzneimittel, eine unter Beachtung des Datenschutzes erstellte elektronische Patientenakte und Patientinformationssysteme.48
V. Folgen der Gesundheitsreform 2000: Gläsener Arzt - Gläsener Patient?
1. Gesetzesentwurf Gesundheitsreform 2000
Mit der Gesundheitsreform 2000 sollen auch die Möglichkeiten der Verwendung von Daten der Krankenversicherung neu gefasst werden. Ziel ist es, den Krankenkassen eine breitere Datengrundlage zur Verfügung zu stellen. Diese Maßnahmen sollen bessere Lenkungsmöglichkeiten sowie eine verbesserte Gesundheitsberichterstattung ermöglichen. Trotz der vermehrten Nutzung der Daten soll deren Schutz nicht beeinträchtigt werden.49
Im Gesetzentwurf sind für den Bereich der Sozialdaten und des Datenschutzes zwei bedeu- tende Änderungen vorgesehen. Sie befassen sich mit der Übermittlung und Sammlung der Abrechnungsdaten der vertragsärztlichen Versorgung sowie mit der Diagnoseverschlüsselung.
2. Sozialdatenschutz: Änderungen durch die Gesundheitsreform 2000
2.1. Zentrale Erfassung und Auswertung von Patientendaten
Der bisherige Umgang mit den Abrechnungsdaten der Vertragsärzte folgte dem Grundsatz der Trennung zwischen Versicherungs- und Leistungsdaten. Der Arzt übermittelt die Daten über die von ihm durchgeführten Leistungen der vertragsärztlichen Versorgung an die KV, mit der er auch abrechnet. Die KV wiederum gibt diese Abrechnungsdaten fallbezogen, aber nicht versichertenbezogen an die zuständige Krankenkasse weiter. Nur in Ausnahmefällen konnte die Krankenkasse den Versichertenbezug verlangen.50
Die Neuregelung sieht eine kassenübergreifende Sammlung der Patientendaten vor. Die Krankenkassen richten dazu zentrale Datenannahmestellen ein. Diese sammeln die Daten, die ihnen von den einzelnen Leistungserbringern übermittelt werden und prüfen sie auf Korrektheit sowie Leistungsverpflichtung der Krankenkassen. Nach Erledigung dieser Aufgaben leiten sie die Daten an die Krankenkassen sowie an ebenfalls neu zu gründende Arbeitsgemeinschaften zur Datenaufbereitung weiter. Vor der Übermittlung sind die Daten zu verschlüsseln. Der Versichertenbezug muss auch nach der Verschlüsselung möglich sein.51
Die Arbeitsgemeinschaften führen das patientenbezogene Datenmaterial zusammen und wer- ten es aus. Die Ergebnisse werden den Krankenkassen und den KVn zur Erfüllung ihrer Auf- gaben zur Verfügung gestellt. Die daraus resultierende Datenbasis soll für folgenden Zweck verwendet werden:
- Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Ärzten
- Basis für Budgetverhandlungen
- Unterstützung der Lenkungsaufgaben der Krankenkassen
- Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung.52
Die Spitzenverbände der Krankenkassen müssen die Datenannahmestellen sowie die Arbeitsgemeinschaften bis zum 30.06.2000 gründen.53
2.2. Diagnoseverschlüsselung nach ICD 10
Die Leistungserbringer sind verpflichtet, auf ihren Abrechnungsunterlagen die Diagnosen anzugeben. Diese sind nach dem Schlüssel der Internationalen Klassifizierung der Krankheiten zu verschlüsseln.54 Krankenhäuser nutzen die Neunte Fassung dieses Schlüssels. Vertragsärzte teilen ihre Diagnosen noch handschriftlich mit.55 Durch die Gesundheitsreform 2000 wird sowohl für Vertragsärzte als auch für Krankenhäuser zum 01.01.2000 der ICD 10 gültig. Die Einführung war schon 1993 vorgesehen, wurde aber vom damaligen Bundesgesundheitsminister Seehofer aufgehoben.56
Der ICD dient der einheitlichen Verschlüsselung von Krankheitsdiagnosen. Basis ist ein welt- weit identischer Katalog von Todesursachen, Krankheiten und Verletzungen. Er wird von der WHO herausgegeben und alle 10 Jahre aktualisiert. Bei dem ICD 10 handelt es sich um die 10. Fassung des Schlüssels. In dem Katalog sind 14.000 Positionen enthalten. Um die Arbeit mit dem ICD zu vereinfachen, wird eine EDV - Fassung herausgegeben. Es werden auch spezielle Kataloge für Fachärzte erarbeitet, die nur Diagnosen aus dem Gebiet des Arztes ent- halten.57
Durch die Verschlüsselungspflicht werden die Angaben der Diagnosen eindeutig. Es gibt nur noch geringe Auslegungsmöglichkeiten. Das ermöglicht einen leichteren Vergleich der Di- agnosen im Gegensatz zum Klartext.58 Der ICD 10 soll außerdem die Krankheitsentwicklung in Deutschland verdeutlichen, Vergleiche der Leistungen und Wirtschaftlichkeit der Leis- tungserbringer gestatten sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche des Gesundheits- wesens verbessern.59
3. Standpunkte zu den vorgesehnen Änderungen
3.1. Datenschutz
Nach Ansicht der Datenschützer sind die bisher im Gesetz enthaltenen Regelungen, die zur Qualitätsprüfung und Wirtschaftlichkeitsprüfung die Zusammenführung von Versichertendaten mit Abrechnungsdaten ausnahmsweise und an diesen Zweck gebunden, erlauben, ausreichend. Die nun vorgesehenen Änderungen führen ihrer Meinung nach zum Entstehen des „gläsernen Patienten“ bei den Krankenkassen.
Durch die versichertenbezogene Speicherung der Diagnosen verfügen die Krankenkassen über sensible Datenbestände. Die Verwendung des ICD 10 stellt genaue Informationen über die jeweilige Erkrankung zur Verfügung. Die Krankenkassen können nun von jedem Versicherten individuelle Gesundheitsprofile erstellen. Dies führt nach Ansicht der Datenschützer zu einer Aushöhlung des Patientengeheimnisses. Die große Menge an Daten ermöglicht den Krankenkassen die Kontrolle von Patienten, Ärzten und erbrachten Leistungen. Hier sehen die Datenschützer das Vertrauensverhältnis von Patienten und Arzt verletzt.
Von Seiten des Datenschutzes wird gefordert, die Änderungen auf Verhältnissmässigkeit und Erforderlichkeit zu überprüfen.60
3.2. Ärzteverbände
Das Argument „gläserner Patient“ wird auch von den Ärzteverbänden angeführt, wobei die Ärzte insbesondere auf die Gefährdung des Patientengeheimnisses und einen Bruch der ärztlichen Schweigepflicht hinweisen.61
Nach Ansicht der Ärzte wird die Sammelung der Daten hauptsächlich zu ihrer Kontrolle durchgeführt. Dadurch entsteht bei den Krankenkassen neben dem „gläsernen Patienten“ auch noch der „gläserne Arzt.“62 Zudem würde das Gesetz eine versichertenbezogene Speicherung der vertragsärztlichen Versorgung nicht zulassen. Hingegen dürfen arztbezogene Daten erhoben und gespeichert werden.63
Neben den bereits erwähnten Einwänden der Datenschützer gegen den ICD 10 befürchten die Ärzte für sich einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Außerdem sind viele Praxen noch nicht mit modernen EDV - Systemen ausgestattet, so dass die bindende Einführung des Diagnoseschlüssels für diese Ärzte eine Investition bedeutet.64
4. Neuregelung
Als Reaktion auf die Proteste der Datenschützer sind die vorgesehnen Änderungen für den Datenschutz überarbeitet worden. Im Mittelpunkt stehet, die Anonymität des Patienten zu gewährleisten.
Die Datenannahmestellen sollen nicht von den Krankenkassen gebildet werden. Sie sollen unabhängige Körperschaften des öffentlichen Rechts sein. Damit unterliegen sie der Kontrolle der Datenschutzbeauftragten. Ihre Aufgaben sind weiterhin das Sammeln der Leistungsdaten, die auf ein bestehendes Versichertenverhältnis bei einer gesetzlichen Krankenversicherung sowie auf die Zahlungspflicht der Krankenkasse überprüft werden. Die Daten werden dann nicht direkt an die Krankenkassen weitergeleitet. Der Name des Patienten wird zuerst von einem Trust - Center pseudonymisiert. Das bedeutet, der Name des Patienten wird durch Schlüssel ersetzt. Danach erhalten die Krankenkassen erst die Daten. Der Schlüssel wird den Kassen nicht mitgeteilt. Nur in Ausnahmefällen darf diese Verschlüsselung wieder rückgän- gig gemacht werden.65
Der ICD 10 ist von diesen neuen Absprachen nicht betroffen. Seine Anwendung wird somit zum 01.01.2000 verbindlich.
VI. Weitere Entwicklung und Fazit
Die Gesundheitsreform 2000 ist am 04.11.1999 im Bundestag beschlossen worden. Über das Inkrafttreten entscheidet nun der Bundesrat. Unabhängig von diesem Ergebnis wird über den Datenschutz nicht mehr diskutiert. Die im Punkt V. 4. beschriebenen Neureglungen genügen der Regierung, um Daten für die Steuerung des Gesundheitswesens zu erhalten. Die Daten- schutzbeauftragen sehen nun keine Gefährdung des Sozialdatenschutzes mehr.66 Die Persön- lichkeitsrechte des Einzelnen werden durch die Pseudonymisierung seiner Daten wirkungs- voll geschützt.67
Handlungsbedarf gibt es allerdings noch beim ICD 10. Die Hausärzte haben angekündigt, den ICD nicht zu verwenden. Grundsätzlich sind sie bereit, für Untersuchungen der vertragsärztlichen Versorgung Diagnosen zu verschlüsseln. Der ICD 10 ist ihnen aber zu umfangreich, da er weit mehr als die 200 bedeutensten Diagnosen der Hausärzte enthält. Außerdem werden die Persönlichkeitsrechte der Patienten verletzt.68
Bei der Erfassung der Daten führen meiner Meinung nach die nun vorgesehenen Gesetze zu keinen Neuerungen. Weitere Daten muss der Versicherte seiner Krankenkasse nicht zur Verfügung stellen. Ebenso hat sich bei den Daten, die von den Leistungsträgern gesammelt und übermittelt werden müssen, nichts geändert.
Vielmehr wird der Umgang mit den Daten dem Hauptziel der Gesundheitsreform, einer effektiven Steuerung des Gesundheitswesens, angepasst. Zu diesem Zweck werden die Auswertungsmöglichkeiten erweitert, um eine informativere Datengrundlage zu schaffen. Dieser wird durch die Verschlüsselung der Namen nicht gefährdet. Leistungen können nun Versicherten zugeordnet werden, die durch die Verschlüsselung ihres Namens geschützt sind. Der „gläserne Patient“ entsteht meiner Auffassung nach somit nicht.
Das Verordnungsverhalten der Leistungserbringer wird dennoch genauer abgebildet. Mehr- fachabrechnungen z. B. fallen nun auf, da sie dann bei dem gleichen Pseudonym auftreten würden. Bei der vorherigen Regelung wäre einfach ein neuer Fall angelegt worden. Die Kran-kenkassen erhalten so also einen besseren Überblick als bei der getrennten Übermittlung der Daten.
Den Befürchtungen der Ärzte, es entstehe der „gläserne Arzt“ bei den Krankenkassen, kann ich nicht zustimmen. Die Krankenkassen erhalten mit der Gesundheitsreform bessere Mög- lichkeiten, das Verordnungsverhalten der Ärzte zu kontrollieren. Dazu verwenden sie Daten, die bereits vorhanden sind. Den Ärzten wird also nicht abverlangt, weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Außerdem ist der Bereich der vertragsärztlichen Versorgung der einzi- ge, in dem lediglich fallbezogenen Daten zur Verfügung stehen. Die Kritik der Ärztevebände ist einerseits nicht nachzuvollziehen, da in den weiteren Bereichen wie z. B. im Krankhaus Daten der Patienten über Diagnosen oder Operationen, die genauso sensibel sind, den Kassen vollständig übermittelt werden. Andererseits ist die bisherige Vorgehensweise besonders bei den Abrechnungen missbraucht worden.
Bei der Einführung des ICD 10 muss den Ärzten mit Sicherheit eine Einführungsphase zuge- standen werden, um den Umgang mit der Verschlüsselung zu erlernen und um den Praxen, die nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, die Anschaffung der notwendigen Systeme zu ermöglichen. Auch muss der ICD an die tägliche Verwendung angepasst werden. Damit ist schon durch die Entwicklung von facharztspezifischen Katalogen begonnen wor- den. Insofern kann ich die Kritik am Umfang des Kataloges nicht nachvollziehen. Auch sehe ich durch die Verschlüsselung die Persönlichkeitsrechte des Patienten nicht gefährdet, da vor- her die Diagnose in Klarschrift angegeben wurde. Der Patient wird so eher noch geschützt.
Es ist zu hoffen, das die Änderungen hinsichtlich der Daten im Gesundheitswesens zügig umgesetzt werden. Die Informationen, die dann zur Verfügung stehen, sind Grundlage für die vorgesehenen Strukturänderungen zur dringend notwendigen Sanierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Rechte des Patienten an seinen Daten dürfen dabei aber nicht verletzt werden. Die nun vorgesehenen Änderungen finden meiner Meinung nach den richtigen Ausgleich zwischen Allgemeinwohl und Interessen des Einzelnen.
Literaturverzeichnis
Altmann, Udo, 1999, Datenbanken im Dienste von Arzt und Patient, in: Gesundheit und Gesellschaft, 2. Jahrgang, 10/99, S 20,21
AOK - Bundesverband (Hg.),1996, Jetzt wird nicht mehr Klartext geredet, in SKV - Inform, 28. Jahrgang, 2-3 1996, S. 53 - 56 BDSG vom 17.12.1997
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.), 1995, Übersicht über das Sozialrecht, 3. Auflage, Bonn
Bundesministerium für Gesundheit (Hg.), 1999, Gesundheitsreform 2000: Informationen
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz (Hg.), 1998, Bundesdatenschutzgesetz -Texte und Erläuterungen- ,Bonn
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.), 1999, Der Bürger und seine Daten, Bonn Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.), 1994, Schutz der Sozialdaten, Bonn DEÜV vom 10.12.1998
Dietzel, Gottfried T. W., 1999, Von Mäusen in der Medizin, in: Gesundheit und Gesellschaft, 2. Jahrgang 9/99, S. 22 - 29
Egger, Bernhard, 1997, Sinn und Nutzen einer Diagnoseverschlüsselung nach ICD 10 in: WIDO (Hg.), Erfahrungen der Krankenkassen im Rahmen der Erprobung des ICD - 10, Bonn, S. 11 - 16
Fischer, Andrea, 1999a, Rede anlässlich der ersten Sitzung des Aktionsforums Telematik im Gesundheitswesen am 19. August in 1999 in Bonn, entnommen www.bmgesundheit.de
Fischer, Andrea, 1999b, Rede zur 2./3. Lesung des Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 in Berlin, , entnommen www.bmgesundheit
Eul, Lotte 1994, Grundlagen des Datenschutzregelungen im Zehnten Kapitel des SGB V, in Schulin, Bertram (Hg.): Handbuch des Sozialversicherungsrechts Band 1 Krankenversicherungsrecht, München 1994, S. 1134 - 1139
Grundgesetz vom 26.03.1998
Heinemann, Klaus „Datenschützer lehnen Gesundheitsreform ab“, Rheinische Post vom 31.08.1999
o. V.: „Das Sozialgesetz zielt eher auf den gläsenern Arzt als auf Patienten“, Ärzte Zeitung vom 29.09.1999, S.16
o. V: .„Gesundheitsministerin lenkt bei Patientenkartei ein“, Handelsblatt vom 27.09.1999
o. V.: “Kassenärzte: „Patienten werden nicht ausspioniert“, Neue Osnabrücker Zeitung vom 16.07.1999, S. 4
Podlech, Adam, 1995, Der Informationshaushalt der Krankenkassen: Datenschutzrechtliche Aspekte, Baden- Baden
SGB I vom 16.12.1997
SGB V vom 19.12.1998
SGB X vom 06.08.1998
Rebscher, Herbert, 1999, Zum Gerede über den „gläserne Patienten“, in: VdaK (Hg.): Die Ersatzkasse 9/99, S. 911
VdAK (Hg.), 1999, Stichwort ICD 10 in: Die Ersatzkasse 9/99, S. 913
Internetseiten
www.bfd.bund.de/aktuelles/ent19990825.html, Entschließung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder vom 25.08.1999, „Gesundheitsreform 2000“, Stand: 04.10.1999
www.bmgesundheit.de/vorhaben/reform/sgb//sgb-g.htm, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem Jahr 2000 (GKV-Gesundheitsreform 2000), Stand: 04.10.1999
www.hausarzt-bda.de, „Beschluss der BDA-Delegiertenversammlung am 23./24. September 1999: Epidemiologie Ja - ICD 10 Nein!“ Stand: 08.11.1999
www.lfd.niedersachesen.de/dokumente/beschl/patienten/htm, „Entschließung: Patienten-schutz durch Pseudonymisierung“, Stand: 08.11.1999
Erklärung zur Haus-/Diplomarbeit gemäß § 26 Abs. 6 DiplPrüfO
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.
Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus fremdem Quellen übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde Vorge- legen.
Ort, Datum Unterschrift
[...]
1 Bundesministerium für Gesundheit (Hg.) 1999, S. 7
2 vgl. Eul, 1994, S. 1134
3 vgl. Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz vom 26.03.1998
4 vgl. §3 BDSG vom 17.12.1997
5 vgl. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz (Hg.) 1998, S. 6
6 ebenda, S. 12 - 14
7 ebenda, S. 15
8 vgl. Eul 1994, S. 1134 - 1135
9 vgl. § 67 SGB X vom 06.08.1998
10 vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.) 1994, S. 16
11 vgl.§ 35 SGB I vom 16.12.1997
12 vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.) 1994, S. 51
13 ebenda, S. 64 - 65
14 vgl. §67a SGB X vom 06.08.1998
15 vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.) 1994, S. 11 - 12
16 vgl. §§60 - 62 SGB I vom 16.12.1997
17 vgl. § 65 SGB I vom 16.12.1997
18 vgl. §§ 66, 67 SGB I vom 16.12.1997
19 vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.) 1999, S. 36
20 vgl. § 16 DEÜV vom 10.02.1998
21 vgl. § 32 Abs. 1,2 DEÜV vom 10.02.1998
22 vgl. §§ 67d - 75 SGB X vom 06.08.1998
23 vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.) 1999, S 56
24 vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hg.) 1995, S. 428
25 ebenda, S. 432
26 vgl. Eul 1994, S. 1136
27 vgl. § 284 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB V vom 19.12.1998
28 vgl. § 285 Abs. 2 SGB V vom 19.12.1998
29 vgl. § 287 SGB V vom 19.12.1998
30 vgl. § 286 SGB V vom 19.12.1998
31 vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.) 1999, S. 39
32 vgl. § 288 SGB V vom 19.12.1998
33 vgl. § 289 SGB V vom 19.12.1998
34 vgl. § 304 Abs. 1 SGB V vom 19.12.1998
35 vgl. § 294 SGB V vom 19.12.1998
36 vgl. Podlech, Adam 1995, S. 50
37 ebenda, S. 67
38 vgl. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (Hg.) 1999, S. 40-41
39 vgl. § 298 SGB V vom 19.12.1998
40 vgl. §§ 296,297 SGB V vom 19.12.1998
41 vgl. § 267 Abs. 1 - 2SGB V vom 19.12.1998
42 vgl. § 267 Abs. i. V. m. § 266 Abs. 7 SGB V 19.12.1998
43 vgl. §275 SGB V 19.12.1998
44 vgl. §276 SGB V 19.12.1998
45 vgl. Altmann 1999, S 20,21
46 vgl. Dietzel 1999, S. 22 - 23
47 vgl. Fischer, Andrea 1999a
48 Dietzel 1999, S. 28 - 29
49 vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hg.) 1999, S. 60 - 61
50 vgl. §§294, 295 SGB V vom 19.12.1998
51 vgl. dazu www.bmgesundheit.de, Gesetzentwurf § 294 SGB V
52 vgl. dazu www.bmgesundheit.de, Gesetzentwurf § 303a SGB V
53 vgl. dazu www.bmgesundheit.de, Gesetzentwurf §§ 294 Abs. 3, 303a Abs. 1 SGB V
54 vgl. §§ 295 Abs. 1 S. 2, § 301 Abs. 1 S. 1 SBG V vom 19.12.1998
55 vgl. Rebscher 1999, S. 911
56 vgl. VdAK (Hg.) 1999, S. 913
57 vgl. AOK - Bundesverband (Hg) 1996, S. 53
58 vgl. Egger 1997, S. 10 - 11
59 vgl. Rebscher 1999, S. 911
60 vgl. dazu www.bfd.bund.de
61 vgl. Heinemann, Klaus „Datenschützer lehnen Gesundheitsreform ab“, Rheinische Post vom 31.08.1999
62 vgl. o. V.: “Kassenärzte: Patienten werden nicht ausspioniert“, Neue Osnabrücker Zeitung vom 16.07.1999, S. 4
63 vgl. o. V.: „Das Sozialgesetz zielt eher auf den gläsenern Arzt als auf Patienten“, Ärzte Zeitung vom 29.09.1999, S.16
64 vgl. Egger 1997, S. 11
65 vgl. o. V.„ Gesundheitsministerin lenkt bei Patientenkartei ein“, Handelsblatt vom 27.09.1999
66 vgl. Fischer, Andrea 1999b
67 vgl. www.lfd.niedersachesen.de
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Datenschutzes im Gesundheitswesen laut diesem Text?
Das Ziel ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt wird. Dies basiert auf dem Persönlichkeitsrecht, einem Grundrecht, das vom Grundgesetz besonders geschützt wird, und soll insbesondere das Recht auf informelle Selbstbestimmung wahren.
Was sind Sozialdaten und was ist das Sozialgeheimnis?
Sozialdaten sind personenbezogene Daten sowie betriebs- oder geschäftsbezogene Daten mit Geheimnischarakter, die von Sozialversicherungsträgern erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Das Sozialgeheimnis ist das Recht des Bürgers, dessen Sozialdaten bei einem Sozialversicherungsträger gespeichert sind, dass diese Daten nur Befugten zur Verfügung stehen und auch nur an diese weitergegeben werden.
Wie erfolgt die Datenerhebung im Sozialversicherungssystem?
Die Sozialversicherungsträger dürfen Sozialdaten nur erheben, wie es im Rahmen ihrer Aufgaben notwendig ist. Grundsätzlich erfolgt die Datenerhebung beim Betroffenen, wobei der Grund für die Erhebung der Daten angegeben werden muss. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen Daten von Dritten erhoben werden können, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind.
Welche Daten werden im Bereich des Gesundheitswesens verwendet, insbesondere bei Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen (KV)?
Krankenkassen und KVen dürfen personenbezogene Daten nur erheben und speichern, wenn es ihren Aufgaben dient, wie z.B. die Prüfung der Leistungspflicht, die Abrechnung mit Leistungserbringern und die Überwachung des Wirtschaftlichkeitsgebots. Es gibt auch spezifische Leistungsdaten, die von Leistungserbringern übermittelt werden und für die Abrechnung benötigt werden.
Was sind Risikostrukturausgleich (RSA) und Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK)?
Der RSA ist ein finanzieller Ausgleich zwischen den gesetzlichen Krankenkassen, um die unterschiedlichen Versichertenstrukturen auszugleichen. Der MDK unterstützt die Krankenkassen bei medizinischen Fachfragen, indem er Gutachten erstellt, z.B. bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit oder bei der Genehmigung von Kuren.
Was sind Krebsregister und Gesundheitstelematik?
Krebsregister dienen zur Erfassung von Krebsfällen und zur Verbesserung der Behandlungsqualität. Gesundheitstelematik bezeichnet die Verwendung moderner Kommunikations- und Informationssysteme im Gesundheitswesen, um Daten und Wissen schneller und effizienter bereitzustellen.
Welche Änderungen im Bereich des Sozialdatenschutzes waren durch die Gesundheitsreform 2000 vorgesehen?
Die Gesundheitsreform 2000 sah eine zentrale Erfassung und Auswertung von Patientendaten durch zentrale Datenannahmestellen und Arbeitsgemeinschaften vor, sowie die Diagnoseverschlüsselung nach ICD 10. Diese Maßnahmen sollten eine bessere Datengrundlage für die Krankenkassen schaffen, um Lenkungsmöglichkeiten und Gesundheitsberichterstattung zu verbessern.
Welche Bedenken gab es bezüglich der Gesundheitsreform 2000?
Datenschützer und Ärzteverbände befürchteten eine Gefährdung des Patientengeheimnisses, die Entstehung des "gläsernen Patienten" und einen Bruch der ärztlichen Schweigepflicht durch die versichertenbezogene Speicherung von Diagnosen und die Einführung des ICD 10.
Wie wurde auf die Bedenken reagiert?
Als Reaktion auf die Proteste wurden die Änderungen für den Datenschutz überarbeitet, um die Anonymität des Patienten zu gewährleisten. Die Datenannahmestellen sollten unabhängige Körperschaften des öffentlichen Rechts sein und die Daten sollten pseudonymisiert werden, bevor sie an die Krankenkassen weitergeleitet werden.
Was ist ICD 10 und wozu dient es?
ICD 10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) ist ein Schlüssel zur einheitlichen Verschlüsselung von Krankheitsdiagnosen. Er dient dazu, die Angaben der Diagnosen eindeutig zu machen und einen leichteren Vergleich der Diagnosen zu ermöglichen. Die Leistungserbringer sind verpflichtet, auf ihren Abrechnungsunterlagen die Diagnosen anzugeben. Diese sind nach dem Schlüssel der Internationalen Klassifizierung der Krankheiten zu verschlüsseln.
- Citar trabajo
- Martin Bardenhorst (Autor), 1999, Daten im Gesundheitswesen: Erfassung, Erhebung, Verwendung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96491