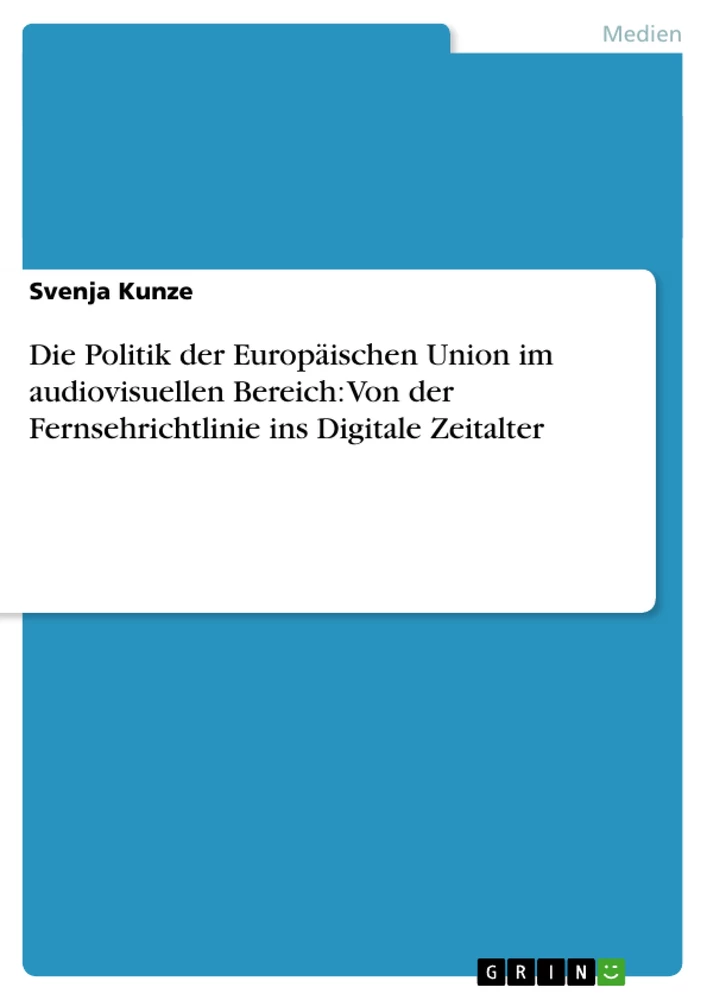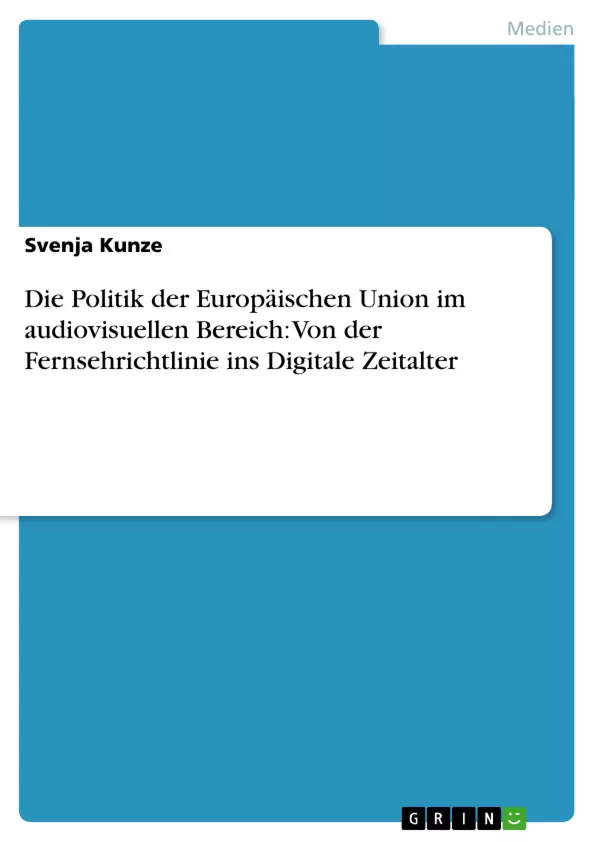Die Politik der Europäischen Union im audiovisuellen Bereich: Von der Fernsehrichtlinie ins Digitale Zeitalter
1. Gründe und Grundlagen für eine Medienpolitik im Rahmen der EG
1 Anfang der 80er Jahre beginnen technische und strukturelle Entwicklungen, das Medium Fernsehen zu verändern, was einen enormen medienpolitischen (Neu-)Regelungsbedarf mit sich bringt. Grenzüberschreitende Medienangebote sind mit nationalen Medienordnungen und -politiken kaum noch zu fassen. Die Internationalisierung der Technik und der Marktstrukturen erfordert auch eine Internationalisierung der entsprechende Regelungsinstrumente.
Die Initiative für ein medienpolitisches Engagement der EG geht 1980 vom Kulturausschuss des Eu- ropäischen Parlamentes aus. Die Diskussion verlagert sich aber schnell in das Aufgabengebiet der Europäischen Kommission und erfährt dabei eine inhaltliche Schwerpunktverschiebung von der Be- tonung kultureller, politischer und integrativer Funktionen der Medien, speziell des Fernsehens, hin zu einer verstärkt juristischen und ökonomischen Betrachtung des Themenbereichs.
Medienpolitik wird überhaupt erst dadurch zum Kompetenzbereich der EG, dass Medientätigkeiten und -Angebote ihrer Natur nach nicht als Kulturgüter, sondern als Dienstleistungen interpretiert werden und dadurch unter die Vereinbarungen der EWG (Art. 59ff.: gemeinsamer Binnenmarkt) und in den Regelungsbereich der EG fallen. Diese Auffassung von Medien und ihrem Charakter wird die Politik der EG nachhaltig bestimmen.
2. Die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ von 1989
Im Oktober 1989 wird vom Ministerrat der EG die „Richtlinie zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Ausübung von Fernsehtätigkeit“2, kurz „Fernsehrichtlinie“ verabschiedet, die für alle Mitgliedstaaten rechtlich bindend ist.
Die Richtlinie erhält sowohl eine Reihe allgemeiner medienpolitischer Absichtserklärungen als auch einige sehr konkrete und detaillierte Vorschriften. Erstere richten sich vor allem auf das Ziel, den freien grenzüberschreitenden Verkehr der Mediendienstleistungen im Binnenmarkt der EG zu ge- währleisten und zu fördern bzw. Beschränkungen, die ggf. durch nationale Regelungen für die Verbreitung von Fernsehsendungen bestehen, abzubauen. Letztere regeln v.a. eine Quote für den Anteil europäischer Produktionen an den Fernsehprogrammen der Mitgliedstaaten, Werbung und Sponsoring und ihre Beschränkungen und Bereiche den Jugend- und Verbraucherschutz.
An der Richtlinie wurde von vielen Seiten Kritik geübt, sowohl grundsätzliche, etwa die Regelungs- kompetenz der EG bzw. den Regelungsbedarf überhaupt und die ‚Stoßrichtung’ der Richtlinie betreffend, als auch auf einzelne Bestimmungen, v.a. die Quotenregelung und ihre Umsetzung, be- zogene.
Im Zentrum der Kritik steht der ‚Dienstleistungscharakter’, der den Medien zugeschrieben wird. Entsprechend bezieht sich die Richtlinie fast ausschließlich auf Fernsehen als ‚Marktgut’ und bedeutet - konform mit den Zielen des gemeinsamen Binnenmarktes - weniger eine Neuregulierung, als vielmehr eine Deregulierung. „Harmonisierung durch Liberalisierung“ kommt dabei vor allem den Interessen der kommerziellen Anbieter entgegen, während die öffentlich-rechtlichen Anstalten allein aufgrund ihrer Struktur und Zielsetzung wenig profitieren.
3. „Fernsehen ohne Grenzen“ 1997
Die Fernsehrichtlinie wurde 1997 erneuert und erweitert3, ohne aber grundsätzlich neue Ansätze erkennen zu lassen. Es werden vor allem Bestimmungen der alten Richtlinie näher ausgeführt, Begriffe präzisiert und Urteile des EuGH einbezogen, um die Umsetzung, die in der Vergangenheit Probleme bereitete, zu erleichtern.
4. Die Medienpolitik der EU - Im digitalen Zeitalter angekommen?
Seit etwa 1997 beginnt die EU, sich mit den Auswirkungen digitaler Technologien auf ihre medienpolitischen Regelungsbereiche zu beschäftigen, u.a. richtet sie eine hochrangig besetzte Arbeitsgruppe ein, die im Oktober 1998 ihren Abschlussbericht4 vorlegt.
Im Dezember 1999 teilt die Kommission ihre „Grundsätze und Leitlinien für die audiovisuelle Politik der Gemeinschaft im digitalen Zeitalter“5 mit. Grundsätze und Ziele der Politik bleiben demnach unverändert, angesichts der durch die Einführung von Digitaltechnologien zu erwartenden Veränderungen der europäischen Medienlandschaft sollen lediglich die politischen Mittel und Umsetzungsverfahren überprüft und ggf. angepasst werden. Rechtliche Basis der audiovisuellen Politik der EU bleibt die ‚Fernsehrichtlinie’ von 1997; sie soll Ende 2002 bearbeitet werden.
In dem Papier weist die Kommission zwar immer wieder auf die Bedeutung der neuen Entwicklungen und einer ihnen angepassten Medienpolitik hin, nimmt aber selbst eine eher abwartende Haltung ein. Angesichts der Tatsache, dass sie gleichzeitig eine Stärkung der Selbstkontrolle als Instrument der Regulierung propagiert und betont, eigene ordnungspolitische Maßnahmen auf ein notwendiges Mindestmass beschränken zu wollen, liegt aber die Vermutung nahe, dass in der Medienpolitik der EU auch in Zukunft der Trend zur Deregulierung anhalten wird.
[...]
1 ) Die EG konzentriert ihre Medienpolitik von Anfang an stark auf audiovisuelle Medien, d.h. Fernsehen und Film; insofern ist im Rahmen der EG Medienpolitik eigentlich gleichzusetzen mit ‚Fernsehpolitik’. In den Be- reichen Printmedien oder Hörfunk zeigen die Organe der Gemeinschaft dagegen kein sichtbares Engagement.
2 ) Richtlinie 89/552/EWG vom 3. Oktober 1989
3 ) Richtlinie 97/36/EG vom 30. Juni 1997
4 ) The Digital Age: European Audiovisual Policy. Report from the High Level Group on Audiovisual Policy. DG X, Oktober 1998.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Gründe und Grundlagen für eine Medienpolitik im Rahmen der EG?
Anfang der 80er Jahre führten technische und strukturelle Entwicklungen zu Veränderungen im Fernsehen, was einen enormen medienpolitischen Regelungsbedarf auslöste. Grenzüberschreitende Medienangebote konnten mit nationalen Medienordnungen und -politiken kaum noch erfasst werden. Die Internationalisierung der Technik und der Marktstrukturen erforderte auch eine Internationalisierung der Regelungsinstrumente. Die Initiative für ein medienpolitisches Engagement der EG ging 1980 vom Kulturausschuss des Europäischen Parlaments aus. Die Diskussion verlagerte sich jedoch schnell in das Aufgabengebiet der Europäischen Kommission, wobei eine inhaltliche Schwerpunktverschiebung von der Betonung kultureller, politischer und integrativer Funktionen der Medien (speziell des Fernsehens) hin zu einer verstärkt juristischen und ökonomischen Betrachtung des Themas stattfand. Medienpolitik wurde erst durch die Interpretation von Medientätigkeiten und -angeboten als Dienstleistungen zum Kompetenzbereich der EG, wodurch sie unter die Vereinbarungen der EWG fielen.
Was ist die "Fernsehrichtlinie" von 1989?
Die "Richtlinie zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Ausübung von Fernsehtätigkeit" wurde im Oktober 1989 vom Ministerrat der EG verabschiedet und war für alle Mitgliedstaaten rechtlich bindend. Sie enthielt sowohl allgemeine medienpolitische Absichtserklärungen als auch konkrete Vorschriften, insbesondere zur Gewährleistung des freien grenzüberschreitenden Verkehrs von Mediendienstleistungen im Binnenmarkt, zur Quote europäischer Produktionen, zu Werbung und Sponsoring sowie zum Jugend- und Verbraucherschutz. Die Richtlinie wurde jedoch kritisiert, insbesondere hinsichtlich der Regelungskompetenz der EG und des Dienstleistungscharakters der Medien.
Was änderte sich mit der Erneuerung der Fernsehrichtlinie im Jahr 1997?
Die Fernsehrichtlinie wurde 1997 erneuert und erweitert, ohne jedoch grundlegend neue Ansätze zu verfolgen. Es wurden vor allem Bestimmungen der alten Richtlinie näher ausgeführt, Begriffe präzisiert und Urteile des EuGH einbezogen, um die Umsetzung zu erleichtern.
Wie reagierte die EU-Medienpolitik auf das digitale Zeitalter?
Seit etwa 1997 beschäftigte sich die EU mit den Auswirkungen digitaler Technologien auf ihre medienpolitischen Regelungsbereiche. Im Dezember 1999 teilte die Kommission ihre "Grundsätze und Leitlinien für die audiovisuelle Politik der Gemeinschaft im digitalen Zeitalter" mit. Grundsätze und Ziele der Politik blieben demnach unverändert, angesichts der erwarteten Veränderungen der europäischen Medienlandschaft durch die Digitalisierung. Die Kommission nahm eine eher abwartende Haltung ein und propagierte eine Stärkung der Selbstkontrolle, was die Vermutung nahelegt, dass der Trend zur Deregulierung in der Medienpolitik der EU anhalten wird.
- Citar trabajo
- Svenja Kunze (Autor), 2000, Die Politik der Europäischen Union im audiovisuellen Bereich: Von der Fernsehrichtlinie ins Digitale Zeitalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96601