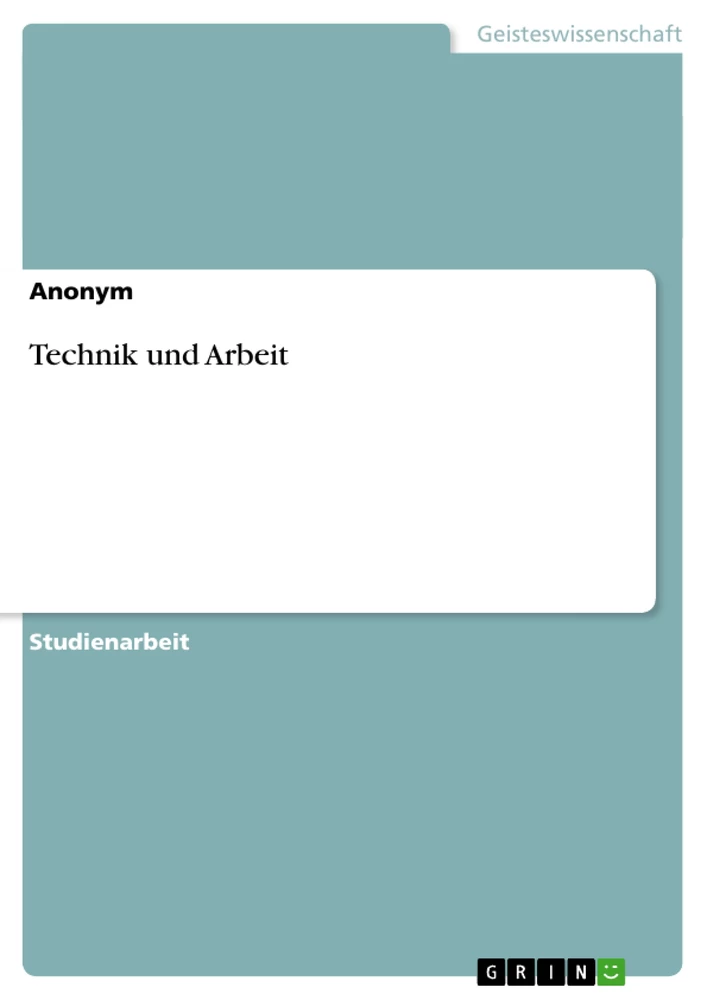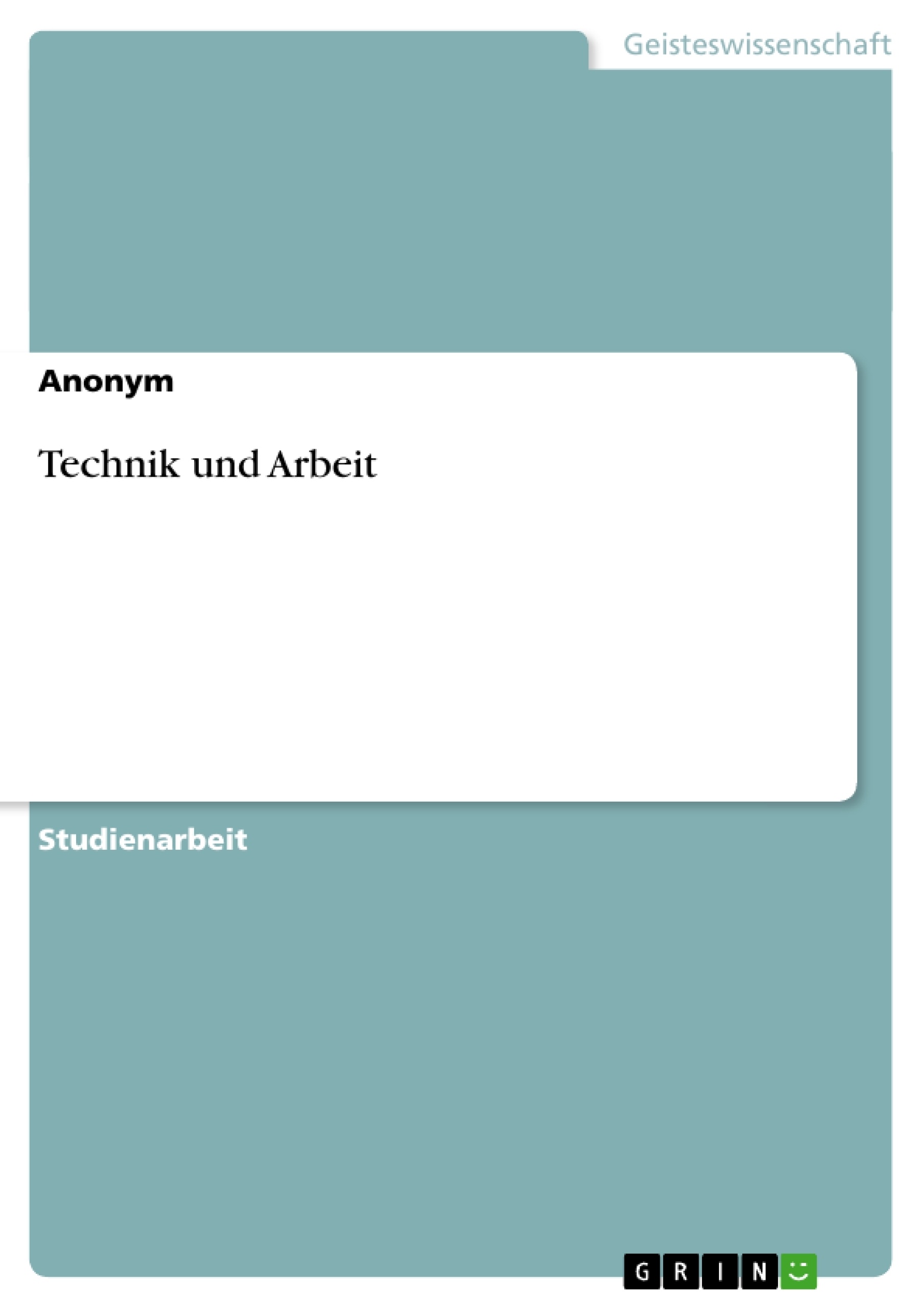INHALTSANGABE
1. Einleitende Bemerkungen
2. Zum Begriff `Technischer Fortschritt´
2.1 Technischer Fortschritt als gesellschaftlich-historisches Projekt
2.2 Zum Systemzusammenhang von Technik
3. Zur Dynamik technischer Entwicklung
3.1 Der betriebsstragische Ansatz
3.1.1 Zur Handlungsrationalität
3.1.2 Zur Systemrationalität
4. Folgen technischer Entwicklung
4.1 Phasen- und Stufenmodelle
4.2 Arbeitsfolgen der Technisierung
5. Abschließende Bemerkungen
LITERATURLISTE
1. EINLEITENDE BEMERKUNGEN
Am Beginn meiner Analyse des Verhältnisses von Technik und Arbeit versuche ich kurz den Begriff des „technischen Fortschritts“ zu beschreiben (2.). Dabei versuche ich die strukturellen Elemente des Komplexes Technik zu definieren, wobei ich in Bezug auf HABERMAS` Auseinandersetzung mit dem Thema Technik und unter dem Aspekt der Organisierung kurz versuche, technischen Fortschritt als historisch-gesellschaftliches Projekt zu definieren (2.1). In diesem Zusammenhang gilt es zu untersuchen, an welchem Ort der technische Fortschritt organisiert wird, wobei ich untersuche, in welchem Systemzusammenhang Technik steht (2.2). In Auseinandersetzung mit WEBERs Begriff der Handlungsrationalität versuche ich zu beantworten, wie solche Systeme zweckstrukturiert sind. Indem ich zu dem Resultat komme, daß technischer Fortschritt im Industriebetrieb organisiert wird, stellt sich in Zusammenhang mit der Dynamik technischer Entwicklung (3.) die Frage, wie die Systemumwelt die Organisation der Technikentwicklung in Industriebetrieben beeinflußt und wie die einzelnen Industriebetriebe darauf reagieren. Zur Beantwortung dieser Frage analysiere ich den betriebsstrategischen Ansatz (3.1), wobei ich dabei vor allem untersuche, wie LUHMANNs Konzept der Systemrationalität in diesem Ansatz verarbeitet ist . Mit Hilfe verschiedener Arbeiten, insbesondere von Phasen- und Stufenmodellen (4.1), versuche ich abschließend, mich auf die Folgen der Technisierung auf den Arbeitsplatz bzw. auf die „Arbeiter“ zu konzentrieren (4.2).
2. ZUM BEGRIFF `TECHNISCHER FORTSCHRITT´
Parallel mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise in industriellen Gesellschaftsformationen hat sich eine charakteristische Rationalität herausgebildet, die inzwischen unter dem Begriff des technischen Fortschritts diskutiert wird.1 Diese wissenschaftliche Rationalität ist in struktureller Affinität mit dem historisch- gesellschaftlichen Projekt des Kapitalismus insofern entstanden, als die gegenwärtige Gesellschaft als dialektisch-strukturierte Gesellschaft bezeichnet werden kann, die „Industriegesellschaft nach dem Stand ihrer Produktivkräfte (...) Kapitalismus in ihren Produktionsverhältnissen“2 ist. Technischen Fortschritt als „Wesensmerkmal von Industriegesellschaften“3 differenziert WEBER in eine formale- und eine materiale Rationalität4, welche sich in dieser Unterscheidung auf die beiden Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung - Produktionsprozeß und Produktionsverhältnis - bezieht.
Indem HABERMAS das System Technik analysiert, definiert er die strukturellen Elemente dieses Prozesses technischer Entwicklung. Er schlägt vor, zwischen technischen Mitteln (vergegenständlichten Prozessen) und technischen Regeln (ein System von Regeln, die zweckrationales Handeln zur wissenschaftlich rationalisierten Verfügung über vergegenständlichte Prozesse festlegen) zu unterscheiden.5 „Die Aggregate technischer Mittel und die Systeme zweckrationalen Handelns entfalten sich keineswegs autonom, sondern jeweils in dem institutionellen Rahmen bestimmter Gesellschaften. Das konkrete Muster des technischen Fortschritts ist durch gesellschaftliche Institutionen und Interessenlagen vorgezeichnet“ (ebd.: S. 234). HABERMAS unterscheidet weiters zwischen zweckrationalem Handeln und kommunikativem Handeln. Unter zweckrationalem Handeln versteht er „entweder instrumentales Handeln, oder rationale Wahl, oder eine Kombination von beiden.“6 Er nennt die Regeln rationaler Wahl Strategien, die Regeln instrumentalen Handelns Technologien.7 Während Strategien, als Regeln rationaler Wahl, „Informationen über die Wahl des besten Weges“ liefern, geben Technologien „Informationen über das geeignetste Mittel“ (ebd.: S. 337). „Technologien sind also Sätze, die Verfahrensweisen festlegen, sie sind nicht selber technische Mittel“ (ebd.: S. 337). Technische Mittel aber, die eine „effektive Verwirklichung von Zwecken erlauben“, sind erst dann Bestandteile der Technik, wenn sie „in bestimmter Funktion für wiederholte Verwendung bereitgestellt sind ...“ (ebd.: S. 337). Unter kommunikativem Handeln versteht er „eine symbolisch vermittelte Interaktion“, die sich nach „obligatorisch geltenden Normen richtet.“8 Er unterscheidet zwischen dem institutionellen Rahmen einer Gesellschaft, der „aus Normen, die sprachlich vermittelte Interaktionen leiten“ besteht und somit auf Regeln kommunikativen Handelns beruht und den Sub-Systemen zweckrationalen Handelns (Wirtschaft, Militär ...) die darin „eingebettet“ sind (ebd.: S. 65).
HABERMAS versteht die Entwicklung von Technik als „schrittweise Objektivation zweckrationalen Handelns“ bzw. „wissenschaftlich rationalisierte Verfügung über vergegenständlichte Prozesse“ (ebd.: S. 13). Damit reduziert er aber das Verständnis von technischer Entwicklung auf logische Strukturen des Rationalisierungsprozesses (Ersetzung menschlicher Arbeitsfunktionen durch technische Mittel auf der Achse der Produktivkräfte), welcher selbst durch technische Regeln festgelegt ist. Indem er verschiedene Handlungstypen unterscheidet9, bzw. Wirtschaft als Sub-System zweckrationalen Handelns, das Mustern instumentalen- oder strategischen Handelns folgt, definiert, spart er die „gesellschaftliche Weise (auf welche Weise, d. Verf.) der technischen Entwicklung ..., die gerade die spezifische Vermittlung von technischen Möglichkeiten und gesellschaftlichen Interessen in historischgesellschaftlichen Projekten ausmacht (aus)“ (ebd.: S. 50), womit „die spezifische Zweckstruktur des kapitalistischen Projekts technisch-wissenschaftlicher Entwicklung ... nicht reflektiert werden (kann)“ (ebd.: S. 55). Aus diesem Grund möchte ich nun den Begriff des technischen Fortschritts als gesellschaftlich-historisches Projekt einführen.
2.1 Technischer Fortschritt als gesellschaftlich- historisches Projekt
Bei der Analyse der Ursachen des technischen Fortschritts gilt es, die „Institutionalisierung der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung als historisch-gesellschaftliches Projekt“ zu rekonstruieren, da weder „Produktivkräfte noch die Produktionsverhältnisse ... den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung allein (bestimmen)“ (ebd.: S. 51), d.h. es muß die Beziehung (auf welche Weise) zwischen formaler- und materialer Rationalität analysiert werden. Technik als „geschichtlich-gesellschaftliches Projekt“10 zu definieren impliziert, technischen Fortschritt als ein der Gesellschaft immanenten Prozeß zu verstehen. Darin werden die Produkionsprozesse nicht nur nach technisch-funktionalen Aspekten zur Effizienzsteigerung konditioniert (formale Rationalität), sondern gleichsam als Instrument der Interessendurchsetzung mißbraucht (materiale Rationalität). Die Definition, wonach „nicht erst ihre Verwendung, sondern schon die Technik ... Herrschaft (ist)“ (ebd.: S. 127) modifizierend, kann man die Effizienzsteigerung als „Voraussetzung und Legitimationsbasis prinzipiell aufrecht erhaltener Herrschaftsstrukturen und ihrer sich wandelnden Formen“11 definieren, wobei der institutionelle Rahmen einer Gesellschaft, d.h. die „Chancen der Interessendurchsetzung sozialer Gruppen ... Verlauf und Richtung der technisch- organisatorischen Veränderungen (bestimmen)“ (ebd.: S. 17). Diese Entwicklung aber kann „weder aus einer der Technik eigenen Logik, noch aus einer Logik des Kapitals allein hinreichend hergeleitet werden“12, sondern die Dynamik der technischen Entwicklung wird „in ihrer Ausrichtung, in ihrem Tempo und in ihrem zyklischen Rhythmus durch die Strukturen kapitalistischer Entwicklung selektiv stimuliert, geprägt und auch begrenzt“13 (s.u.). Das Sub-System Wirtschaft gilt dabei als jener gesellschaftliche Ort, an dem sich das kapitalistische Projekt technischer Entwicklung am deutlichsten herausgebildet hat. Der gesellschaftliche Rationalisierungsprozeß erhält dabei in dem Wirtschaftsunternehmen, „wo die Rationalität in Form der Arbeitsorganisation, der Produktionstechnik und des wissenschaftlichen Informations- und Steuerungssystems konkrete Gestalt annimmt“14, seine konkrete Ausprägung. Es gilt als „diejenige historische Form“, in der Rationalität „als kapitalistische Rationalisierung von den Unternehmen im Rahmen des Kampfes mit konkurrierenden Einzelkapitalen gegen den Widerstand der lohnabhängig Beschäftigten verwirklicht wird“ (ebd.: S. 44). Das Wirtschaftsunternehmen wird dadurch das „strategisch wichtigste Aktionszentrum, in dem der soziale Prozeß der Entstehung und Gestaltung neuer Techniken organisiert und entschieden wird.“15
2.2 Zum Systemzusammenhang von Technik
Technik kann also als Komplex betrachtet werden, in dem technische Systeme zweckrationalen Handelns in den institutionellen Rahmen industrieller Gesellschaftsformationen „eingebettet“ bzw. durch gesellschaftliche Institutionen und Interessenlagen vorgezeichnet sind. Die wissenschaftlich rationalisierte Verfügung über vergegenständlichte Prozesse folgt technischen Regeln, wobei Technologien Sätze sind, die Verfahrensweisen festlegen. Sie sind also Regeln zweckrationalen Handelns, die insofern ein Aussagesystem für die „Ausbildung der konkreten Form eines spezifisch zweckbestimmten technischen Mittels“ (ebd.: S. 86) sind. Strategien liefern Informationen über die Wahl des besten Weges, nicht über das geeignetste Verfahren. Als Regeln rationaler Wahl sind auch sie Regeln zweckrationalen Handelns.
Zwischen Technologien und Strategien besteht nun ein systematischer Zusammenhang; Beide sind an der Realisierung des technischen Fortschritts beteiligt: Im Entscheidungsprozeß (s.u.) leitet der Akteur aus den historisch-gesellschaftlichen Interessen Ziele (Strategien) ab, die dann in Technologien (als Aussagesystem für die Entwicklung konkreter technischer Mittel) umgesetzt werden. Technische Mittel sind also „Vergegenständlichungen des Systems zweckrationalen Handelns einer konkreten Gesellschaftsformation“ (ebd.: S. 88). Unter diesem Aspekt kann Technisierung als „Form sozialen Handelns“, welche die „Fortsetzung formaler Organisierung sozialen Handelns mit anderen Mitteln“16 ist, bezeichnet werden. Damit impliziert man HABERMAS` Differenzierung von zweckrationalem Handeln in instrumentales Handeln (Technologien) bzw. rationale Wahl (Strategien), oder eine Kombination von beidem, wobei „instrumentelles- und strategisches Handeln ... gemeinsam an der Wirksamkeit sachlicher Mittel und menschlicher Operationen für einen vorgegebenen Zweck (...) orientiert (sind)“ (ebd.: S. 53).
Bezogen auf die Zweckstruktur des Wirtschaftsunternehmens (Industriebetrieb) bedeutet das, daß HABERMAS der Logik „der Steigerung der Effektivität der Mittel auf vorgegebene Ziele hin, ... also der traditionellen Zweck-Mittel-Rationalität (folgt)“ (ebd.: S. 57), die in dieser Definition eben zum Strukturgesetz sozialer Systeme wird. Damit trifft er eine analoge Unterscheidung zu WEBERs Differenzierung der Rationalität sozialen Handelns in eine Wert- und eine Zweckrationalität, die zusammen die Rationalstruktur des Handelns (Handlungsrationalität) ausmachen.
Exkurs: Zweck-Herrschaft bei MAX WEBER17
Mit der Sinnbeziehung des Begriffs des sozialen Handelns, das als ein Handeln bezeichnet wird, das seinem gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird, bestimmt Weber das begriffliche Fundament, auf welches er seine Typen des Handelns bzw. seine Typen der sozialen Beziehungen aufbaut: Handlungstypen und Beziehungstypen unterscheiden sich als Auslegung dieser Sinnbeziehung, als Typen der Handlungsorientierung. Er konstruiert seine Typen unter Verwendung eines Gegensatzes von traditionaler, emotionaler und rationaler Orientierung, wodurch gewisse Annahmen über die Rationalität des Handelns einfließen, die sein Urteil über die Bürokratie als Instrument rationaler Herrschaft begründen helfen. Weber unterscheidet zwischen Zweckrationalität und Wertrationalität. Zweckrationalität gilt als Handeln, das als Mittel für erstrebte und abgewogene eigene Zwecke motiviert ist; Wertrationalität gilt als Verhalten, das unabhängig von Erfolgen geschätzt wird. Die Orientierungsstruktur rationalen Handelns besteht darin, daß der Handelnde sein Handeln kausal auslegt, es als Bewirken einer spezifischen Wirkung versteht, und entweder Ursache oder Wirkung nach Wertgesichtspunkten auswählt, wobei sich beides gegenseitig bedingt und zusammen die Rationalstruktur des Handelns ausmacht. Allerdings bemerkt Luhmann, daß Rationalität auf der Ebene des Einzelhandelns nicht dasselbe ist wie Rationalität auf Ebene des sozialen Systems: Die Rationalität eines sozialen Systems kann nicht allein dadurch gesichert werden, daß alle Beteiligten rational handeln. Weber versteht dieses Problem nur in bedingter Form, nämlich darin, daß er bei der Analyse sozialer Systeme von Zweck/Mittel-Kategorien zu Kategorien der Herrschaft überwechselt, womit er zwar das Zweck/Mittel-Schema als Grundform der Handlungsrationalität nicht aufgibt, aber feststellt, daß die meisten sozialen Systeme nicht auf spezifische Zwecke und spezifische Mittel festgelegt sind, sondern beides durch die Rationalität der Herrschaft ändern können bzw. dieses Mittel der Rationalität (Herrschaft) verschiedenen Zwecken dienen kann. Die Eignung der Rationalität der Herrschaft, die eben Mittel für beliebig änderbare Zwecke ist, beruht auf einer Willensübertragung durch Befehl, welche von verschiedenen Typen (rationale, traditionale, charismatische) legitimiert wird. Die Akzeptierung von Herrschaft legitimiert erst Herrschaft bzw. bestimmt die erreichbare Rationalität einer sozialen Ordnung. Weber definiert also ein Zweck/Mittel-Schema und eine Befehlsautorität, die insofern verbunden sind, als die Herrschaft zum generalisierten Mittel für verschiedene Zwecke wird.18
WEBER versteht die Zweckstruktur des Wirtschaftsunternehmens als System, d.h. als Ordnung von Beziehungen, durch die Sub-Systeme zu einem Ganzen verbunden werden. Die Rationalstruktur solcher sozialer Systeme allerdings wird durch das Zweck-Mittel-Schema als Modell der Handlungsrationalität beschrieben. Die Prämisse, wonach ausschließlich die Befehlsautorität die Rationalisierbarkeit sozialer Systeme (und damit des technischen Fortschritts insgesamt) bestimmt, impliziert, daß die „optimale Form“ von Systemrationalität durch die Zweck-Mittel-Orientierung nur innerhalb sozialer Systeme erreicht werden kann, indem die Mittel durch die Befehlsautorität an den Zweck gebunden sind. Damit wird zwar die Zweck-Mittel-Struktur mit dem hierarchischen Aufbau einer Organisation parallelgeschaltet, der Industriebetrieb aber als geschlossenes System beschrieben, weshalb die „Rückwirkungen übersehen (werden), die sich aus den Umweltbeziehungen für die interne Organisation und für das rationale Verhalten im System ergeben.“19 Aufgabe des folgenden Abschnitts ist es u.a. also zu analysieren, inwiefern die Systemumwelt die betrieblichen Strukturen beeinflußt bzw. zu beschreiben, welche konkreten Faktoren technischen Fortschritt bestimmen.
3. ZUR DYNAMIK TECHNISCHER ENTWICKLUNG
Zur Analyse der Dynamik technischer Entwicklung ist es notwendig Mechanismen zu bestimmen, die die Genese technischer Entwicklung konstituieren. Aus diesem Grund müssen analytische Dimensionen formuliert werden, „die es möglich machen, bei der Untersuchung betrieblicher Strukturen (...) gleichzeitig ihren gesellschaftlich-historischen Charakter durchsichtig zu machen“20, wobei zu berücksichtigen ist, daß „erst in dem konkreten Entscheidungsprozeß ... aus den Präferenzen Ziele abgeleitet und über alternative Möglichkeiten, sie in technische Aufgaben zu übersetzen, entschieden (werden). Die hinreichende Bedingung für die Erklärung der Entwicklung technischer Mittel ist so also erst mit dem konkreten Entscheidungs- und Umsetzungsprozeß gegeben, in dem das geschichtliche Interesse mit den Technologien zu historisch-konkreten Zielen in Form technischer Anlagen vermittelt wird.“21
Im folgenden versuche ich nun diesen Entscheidungsprozeß anhand des betriebsstrategischen Ansatzes zu analysieren.
3.1 Der betriebsstrategische Ansatz
1965 begann das sich damals im Aufbau befindliche Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in München mit einem Forschungsprojekt, worin das Konzept betrieblicher Autonomie-Strategie (betriebsstrategischer Ansatz) erläutert wurde. Die Aufgabe dieses Ansatzes bestand u.a. darin, die „Vermittlung zwischen der Struktur des gesellschaftlichen Produktionsprozesses (gesellschaftliche Kapitalverwertung, d. Verf.) und den konkreten Formen einzelner Produktions- und Arbeitsprozesse mit ihren technologischen, organisatorisch und herrschaftsmäßig bedingten Formen menschlicher Arbeit“22 zu analysieren, wobei sich die im Industriebetrieb realisierte kapitalistische Produktionsweise zum einen dadurch charakterisiert, daß sich eine industrielle Gesellschaft ständig darum bemüht, „das ihr verfügbare Potential an Produktivkräften (...) zu mobilisieren“ um gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, zum anderen dadurch, „daß die Steigerung der Produktivität gesellschaftlicher Arbeit der Befriedigung privater Interessen des kapitalistischen Unternehmens dient (private Aneignung, d. Verf.).“23
In der Konzeptualisierung des betriebsstrategischen Ansatzes24 wird davon ausgegangen, daß man technischen Fortschritt als gesellschaftlichen Produktionsprozeß im Industriebetrieb organisiert. Konkretes Objekt des technischen Fortschritts ist dabei die `objektive Arbeit´ in Gestalt des Produktionsprozesses. Objektive Arbeit impliziert notwendig folgende Elemente: 1. das Objekt, 2. die Operation, 3. die Zeit, die im Objekt-Operationsbezug in ihrer prozessualen Beziehung kombiniert werden. Technischer Fortschritt als endogener bzw. Industrialisierungsprozeß bezieht sich - in analoger Unterscheidung zu HABERMAS` Differenzierung zwischen instrumentellem- und strategischem Handeln - auf die Dimensionen (des Produktionsprozesses) Technisierung (Tendenz zu wachsender Autonomie) und Standardisierung/ Organisierung (Tendenz zu wachsender Determiniertheit) und verläuft insofern prozeß spezifisch, als die Produktionsprozesse aufgrund unterschiedlicher Objekt- Operationsbezüge einen unterschiedlichen Verlauf des technischen Fortschritts aufweisen. Der Objekt-Operationsbezug definiert also die Funktion des Produktionsprozesses, wobei unterschiedliche Objekte unterschiedliche Verläufe technischen Fortschritts bedingen, was zur Bildung von Funktionsgruppen führt, die eben durch die unterschiedlichen Objekt- Operationsbezüge differenziert werden. Unternehmerische Autonomiestrategien (als Streben nach Unabhängigkeit) zielen darauf ab, „das Produktionsziel so zu organisieren, daß das betriebliche Herrschaftssystem nicht von betriebsfremden Leistungen und Auflagen abhängig gemacht wird. Objekt dieser Strategien sind dabei die technologisch-organisatorischen Bedingungen der betrieblichen Produktionsprozesse selbst.“25
RAMMERT26, der sich in seinem strategieorientierten Konzept der Unternehmensorganisierung am betriebsstrategischen Ansatz anlehnt, unterscheidet auf der Achse der Produktionsverhältnisse folgende, unter den „Zwecksetzungen der Profitmaximierung, der reellen Subsumtion lebendiger Arbeit unter den kapitalistischen Prozeß und der Sicherung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“27 entwickelten, Autonomiestrategien kapitalistischer Form: Die Strategieform der ökonomischen-, organisatorischen- und politischen Rationalisierung. Für das kapitalistische Unternehmen (als konkrete Vermittlungsinstanz zwischen einzelkapitalistischem- und gesellschaftlichem Produktionsprozeß) ist es nun eine Existenzfrage, „inner- und überbetriebliche Strategien zu entwickeln, um unter veränderten sozio- und politisch-ökonomischen Konstellationen die historisch spezifische Zweckrationalität der Organisation kapitalistischer Industriebetriebe zu stabilisieren.“28 In diesem Sinne kann das Unternehmen als historische Ausprägung von Strategien29 bzw. als „geronnene Strategie“30 bezeichnet werden. EWERS u.a. bemerken dazu, daß „Entscheidungen über die Übernahme neuer Techniken und die Art ihrer Nutzung ... immer auch strategische Elemente (enthalten), d.h. sie werden nicht notwendig und ausschließlich im Hinblick auf die vorhandene, sondern auch im Hinblick auf eine zukünftig angestrebte interne Struktur getroffen“31, wobei nachstehende Strategien im Hinblick auf die Aufrechterhaltung von Autonomie jeweils unterschiedlich miteinander kombiniert werden:
- „Strategien der direkten Auseinandersetzung mit den Arbeitnehmern (in der Tarifpolitik, in der Sozialpolitik etc.),
- Strategien der Einflußnahme auf den politischen Entscheidungsprozeß der Gesellschaft (auf Wirtschafts-, Finanz-, Außenhandels-, Arbeitskräftepolitik etc.),
- Strategien der Unabhängigkeit des Betriebs von Märkten und Marktschwankungen (von Arbeits-, Kapital-, Rohstoff-, Absatzmarkt),
- Strategien in der Abstimmung von prinzipiell kongruenten Fremdinteressen (in der Verbandspolitik, in Fragen der Lobby etc.)“32
Der Produktionsprozeß gilt insgesamt als Objekt innerbetrieblicher Strategien. Während aber der betriebsstrategische Ansatz den Produktionsprozeß nach dem Prinzip der Handlungsrationalität dimensioniert, verfolgt RAMMERT bei der Dimensionierung das Prinzip der Systemrationalität.
3.1.1 Zur Handlungsrationalität
Eine „Regulierung des Zusammenhanges (...) des gesellschaftlichen Produktionsprozesses erfolgt in der Wechselwirkung zwischen Konkurrenzmechanismus und Autonomieprinzip ...“33, wobei sich autonome Kapitalverwertung dabei nur als Autonomie von Einzelkapitalen durchsetzen kann, die wiederum von der inneren Kontingenz des gesellschaftlichen Produktionszusammenhanges (Wert- und Preisrelationen zwischen Produktion, Zirkulation, Distribution und Konsumtion) bestimmt werden und deshalb auf die Nutzung des betrieblichen Produktionsprozesses verwiesen werden. Die Gestaltung der Produktionsprozesse erfolgt aber nicht nur unter diesem Aspekt, sondern auch unter dem Aspekt der Aufrechterhaltung des asymetrischen, im Kapitalverhältnis angelegten, gesellschaftlichen Machtverhältnisses. Der betriebliche Produktionsprozeß kann also als „konkrete Ausprägung des Zusammenhanges (der Vermittlungsdimensionen, d. Verf.) von Konkurrenz, Autonomie, Kontingenz und Machtasymetrie“ (ebd.: S. 158) betrachtet werden.
Im Produktionsprozeß selbst stellen Technik, Organisation und Arbeitskraft jene „elastischen Potentiale“ (Umstellungsmöglichkeiten) bzw. Eingriffsbereiche dar, auf die der Betrieb reagieren kann, wobei sich in der Technisierung und Determinierung von Produktionsprozessen die Rationalisierung realisiert.34 Diese Realisierung des technischen Fortschritts, d.h. die Gestaltung des Produktionsprozesses, ist als Ausdruck betrieblichen Handelns zu verstehen, wobei sich betriebliche Strategien im Verhalten eines Unternehmens insofern manifestieren, als sie „objektives Steuerungsprinzip eines interessorientierten unternehmerischen Handelns“ sind, bzw. als operationelle Form betrieblichen Handelns bezeichnet werden können und in dieser Definition der Zweckstruktur betrieblicher Organisation folgen bzw. die Organisationsform selbst festlegen.35
3.1.2 Zur Systemrationalität
Für RAMMERT36 erfolgt „die stärkste Einschränkung seiner (des Unternehmens, als „zentrale Instanz ... für den Prozeß der Technikentwicklung“, ebd.: S. 23; d. Verf.) Autonomie ... über die Konkurrenz“ (ebd.: S. 20). Unternehmen konkurrieren auf dem Markt unter dem Aspekt der Rentabilität bzw. unter Kostengesichtspunkten - der Erfolg eines Unternehmens resultiert dabei aus dem Preis- und Qualitätswettbewerb: „Schnelligkeit und innovatives Potential (entscheiden) über den Erfolg eines Unternehmens“ (ebd.: S. 25). Je mehr sich die Produktinnovation als relevante Autonomiestrategie, d.h. als „strategische Antwort (...) auf die Herausforderung eines `verschärften Qualitätswettbewerbs´ bei `beschleunigtem technischen Wandel´“ (ebd.: S. 25) durchsetzt, „desto stärker weist die Unternehmensorganisation Merkmale der `kontrollierten Autonomie´ auf“ (ebd.: S. 28). „Kontrollierte Autonomie“ versteht sich als selbständige Organisierung bzw. Ausdifferenzierung des Forschungs- und Entwicklungsprozesses aus den Produktionsprozessen, wodurch sich die Unternehmensorganisation „gegenüber den stofflichen, prozessualen und personalen Eigenheiten des Innovationsprozesses als strategisches Machzentrum erhalten kann“ (ebd.: S. 28), wobei „Integrationstechniken der Planung, Kontrolle und Formalisierung der Rahmenbedingungen des Innovationsprozesses zur `Organisierung der Autonomie´ angewendet werden“ (ebd.: S. 28).
RAMMERT37 unterscheidet Autonomiestrategien danach, „ob sie jeweils die Arbeitskräfte, die Arbeitsmittel und -gegenstände oder das Arbeits- und Steuerungswissen zum Bezugspunkt nehmen.“ Damit bestimmt er für die Analyse des Produktionsprozesses folgende - dazu analogen - Dimensionen der Rationalisierung:
- Organisierung (zur Festlegung der Arbeitsanforderungen)
- Technisierung (Ersetzung menschlicher Arbeitsfunktionen)
- Verwissenschaftlichung (Erhöhung des Potentials an Wissen)
Er erweitert also die Logik der Dimensionierung des betriebsstrategischen Ansatzes um eine weitere Dimension der Verwissenschaftlichung. Diese „Verdoppelung des Produktionsprozesses in einen materiellen und ideellen Prozeß“38 bzw. konkret: Die „Erzeugung positiven Wissens über die natürlichen, technischen und sozialen Zusammenhänge ermöglicht eine je nach Funktionserfordernis und Zielvorgabe optimale Steuerung des Produktionssystems (...) Nicht nur durch eine Erhöhung der Determiniertheit der internen Abläufe und eine Erhöhung der technischen Autonomie gegenüber externen Einflüssen auf das Produktionssystem, sondern durch einen erhöhten Grad an Reflexivität, die das Verhältnis zwischen gesellschaftlicher und privater Produktion ... in ein Verhältnis von `Programmierbarkeit´ und `Flexibilität´ umwandelt und dadurch die Produktivität steigert“ (ebd.: S. 57). Der reflexive Charakter dieser Verwissenschaftlichung ermöglicht, die Ziele kontingent zu setzen bzw. durch die vergrößerte Anzahl von Zweck-Mittel-Relationen kann auf die Umweltbedingungen besser eingegangen werden (vgl. ebd.): Indem man feste oder `determinierte´ Beziehungen auflöst, „kann die Verarbeitung gegensätzlicher Anforderungen und Erhöhung der Steuerungsautonomie des Produktionsprozesses in Richtung auf ein selbstregulatives, umweltoffenes System gesteigert werden“ (ebd.: S. 57).
In Bezug auf die Gestaltungsprinzipien bzw. auf den technisch-funktionalen Aspekt der Koordination des Produktionsprozesses bedeutet das, „daß Unternehmen den ausdifferenzierten Forschungs- und Innovationsprozessen zwar die erforderliche Freiheit gewähren (...), ihre eigene Autonomie und interne Kontrollposition jedoch durch zunehmende Organisierung der informellen Kooperation und der infrastrukturellen Bedingungen des Innovationsprozesses sichern, indem sie „das Konzept einer am ökonomischen Primat orientierten `kontrollierten Autonomie´ wissenschaftlicher und technologischer Innovationsprozesse (entwickeln).“39 Die ökonomische Rationalität versteht sich also als jener Zweck, „auf den hin die anderen Rationalitäten (technische-, organisatorische-, wissenschaftliche Rationalität, d. Verf.) institutionell ausgerichtet werden“ (ebd.: S. 97), d.h. die „Logik des Innovationsprozesses“ versteht sich also als „`Verheiratung´ der wissenschaftlich-technologischen mit der ökonomischen Rationalität“ (ebd.: S. 33).
Damit beschreibt RAMMERT ein System, in dem „technische Rationalität ... immer weniger an der Effektivität eines Mittels für einen vorgegebenen Zweck bemessen (wird), sondern am Vergleich der Systemrationalität verschiedener Mittel-Ziel-Relationen“ (ebd.: S. 34). Unter diesem Aspekt und in Bezug auf die Technisierung als Form sozialen Handelns schlägt er vor, technische Entwicklung als soziale Evolution zu untersuchen.40 Durch die funktionale Dreiteilung des Entwicklungsprozesses (Variationsmodell, Selektionsmodell, Stabilisierungskonzept) definiert er ein System, in dem institutionalisierte Techniken als „Erbmaterial“ bei der Genese neuer Techniken mitwirken und die betriebliche Forschung immer mehr an der „Züchtung“ von neuen Techniken beteiligt ist. Indem Strategien auf der Handlungsebene unter Bezug auf gesellschaftlich strukturierte Umweltbereiche entwickelt werden, werden sie mit dem evolutionstheoretischen Ansatz auf Gesellschaftsebene verbunden. „Die Dynamik soziotechnischer Evolution (kann damit) als historisch- gesellschaftliches Projekt über die Konfigurationen gegensätzlicher Strukturen und ihre empirischen Ausdrucksformen in unterschiedlichen Strategien rekonstruiert werden“ (ebd.: S. 43).
4. FOLGEN TECHNISCHER ENTWICKLUNG
Nachdem die bisherigen Abschnitte hauptsächlich unter dem Teilaspekt (des technischen Fortschritts) der Organisierung bearbeitet wurden, versuche ich nun abschließend, die Folgen der technischen Entwicklung in Bezug auf die Technisierung zu analysieren. Dazu möchte ich wiederholen, daß Technik im Rahmen gesellschaftlich organisierter Arbeit entwickelt wird, also nicht als endogener-, sondern als gesellschaftlich-historischer Prozeß der Technisierung zu verstehen ist, in dem insbesondere die Interessen der einzelkapitalistischen Unternehmen sowohl „das Ausmaß (Mechanisierungsgrad) und die Art und Weise der Technisierung (technisch-organisatorisches Design)“41 bestimmen.
Bei der Bestimmung zukünftiger Folgen technischer Entwicklung besteht das Problem darin, daß „sich für die Technik weder eine eigendynamische, geradlinige Verlaufsform noch eine eindeutige Ursache-Folgen-Beziehung zur Arbeit nachweisen lassen.“42 Rückblickend können jedoch die Arbeitsfolgen zuerst der Mechanisierung und später der Automatisierung „in globalen Phasen- und differenzierten Stufenmodellen“43 untersucht werden, wenngleich die Mitarbeiter des ISF in München dem entgegnen und bemerken, daß sich technischer Fortschritt „aus einer Mehrzahl von Tendenzen zusammensetzt, die eine Anzahl möglicher Entwicklungen mit mehreren möglichen Konsequenzen bewirken (...) Es gibt keine globalen Stufen des technischen Fortschritts ...“44 Sie bemerken, daß Vergleichsanalysen (Vor- /Nachvergleiche, Simultanvergleiche) dabei die Fragwürdigkeit aufzeigen, von einem unmittelbaren Ursache-Wirkungsverhältnis zwischen technischen Veränderungen menschlicher Arbeit - am einzelnen Arbeitsplatz - auszugehen (ebd.: S. 46). Sie gehen davon aus, daß das Objekt des technischen Fortschritts nicht die konkrete menschliche Arbeit (der einzelne Arbeitsplatz), sondern die „objektive Arbeit“ in Gestalt des Produktionsprozesses ist, weshalb sich technischer Fortschritt „prozeß- oder, als Ziel formuliert, funktionsspezifisch vollzieht“ (ebd.: S. 56). „Erst vermittelt durch die Veränderungen dieser Prozesse kann man die qualitative Veränderung der menschlichen Arbeit (...) und den sich ändernden quantitativen Anteil an verschiedenen Produktionsprozessen (...) erfassen und prognostizieren“ (ebd.: S. 47). Subjektives Arbeitshandeln kann nur „im Rahmen der objektiven Bedingungen spezifischer Produktionsprozesse und die Veränderung der Art menschlicher Arbeit nur als vermittelt durch die Prozesse betrachtet werden“ (ebd. S. 116), wobei sich diesem Rahmen „Aufgaben, also Zielsetzungen menschlicher Arbeitsvollzüge, sowie spezifische Formen der Prozeßbezogenheit dieser Arbeitsvollzüge“ (ebd.: S. 117) zuordnen lassen.
4.1 Phasen- und Stufenmodelle
„In einem entwickelten Produktionssystem verwirklicht sich das kapitalistische Interesse an Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit vor allem durch die ständige Revolutionierung der Produktionstechnik“45, wobei die technische Entwicklung in einzelnen Industriebetrieben „Ungleichzeitigkeiten“ (ebd.: S. 24) aufweist. In seiner Auseinandersetzung mit den Arbeitsfolgen des technischen Wandelns bemerkt TOURAINE in Bezug auf diese „Ungleichzeitigkeiten“, daß „genau zu unterscheiden (ist) zwischen den entgegengesetzten Erfordernissen des einen Systems der Arbeit, das man beruflich nennen kann (weil es auf der Arbeitsautonomie des qualifizierten Industriearbeiters beruht), und des anderen Systems, das man technisch nennen kann (weil es durch den Vorrang eines technischen Systems von Organisation von der individuellen Arbeitsausführung definiert ist).“46 Dabei bettet er das historische Verhältnis zwischen industrieller Technik und menschlicher Arbeit in ein Drei- Phasen-Schema ein, indem er zwischen 1. handwerklich geprägter Industrie, 2. Mechanisierung der Industriearbeit und 3. Automatisation unterscheidet, wobei er davon ausgeht, daß die Übergänge in den einzelnen Industriebetrieben kontinuierlich verlaufen. Dem widersprechen POPITZ u.a., indem sie bemerken, daß die „`technische Bedingtheit´ eines Arbeitsvollzuges nicht als einheitliches Phänomen vorausgesetzt werden (kann), sondern jeweils neu und unterschiedlich analysiert werden (muß).“47 In diesem Zusammenhang bemerken KERN/SCHUMANN, daß Veränderungen der menschlichen Arbeit durch eine Technikübernahme sich nur in Bezug auf die Kategorien Produktionsbereich und (insbesondere) Mechanisierungsgrad bestimmen lassen.48 Dabei unterscheiden sie folgende Stufen der Mechanisierung (vgl. ebd.: S. 144): 1. reiner Handbetrieb, 2. Fließbandfertigung, 3. Einfunktionales Einzelaggregat (permanent manuelle Arbeiten), 4. Einzelaggregat (permanent Eingriffe über Bedienungsinstrumente), 5. Multifunktionale Einzelaggregate (sporadische Eingriffe), 6. Aggregatsysteme, 7. Teilautomatisierte Einzelaggregate, 8. Teilautomatisierte Aggregatsysteme.
4.2 Arbeitsfolgen der Technisierung
TOURAINE bemerkt in Bezug auf die Mechanisierung, daß „die klassische Form der mechanisierten Serienfertigung ... die Fließbandarbeit (ist).“49 An die Stelle der handwerklichen Arbeit „tritt (...) der Produktionstakt“ (ebd.: S. 295), wobei „die Spezialisierung der Einzelaufgaben (Taylorismus, d. Verf.) ... nichts anderes als die direkte Folge dieses Primats der kollektiven Organisation (ist)“ (ebd.: S. 296). Weiters bemerkt TOURAINE, daß „Mechanisierung und Spezialisierung der Tätigkeiten (...) zu immer stärkeren Verdrängung der Arbeiter aus dem Produktionsprozeß oder aus Teilbereichen des Prozesses (führt). Die direkte Produktionstätigkeit wird ersetzt durch indirekte Steuerungs- und Kontrollarbeit (...) In der Tat schreitet einerseits die Auflösung des beruflichen Systems der Arbeit fort und verringert die Qualifikation des Arbeiters weiter ... ; auf der anderen Seite entsteht das technische System, das denjenigen, die die Maschinen oder Apparate bedienen, komplizierte Steuerungs- oder Kontrollaufgaben zuweist“ (ebd.: S. 297). „Die relative Qualifikation dieser Arbeiter muß definiert werden als zunehmende Verantwortung, d.h. Beobachtung, Aufmerksamkeit, Beachtung relativ komplexer Anweisungen. Sie erfordert in stärkerem Maße psychische Fähigkeiten und weniger Geschicklichkeit oder Produktionserfahrung“ (ebd.: S. 298). KERN/SCHUMANN stellen in Bezug auf die Apparateführung fest, daß dafür „lediglich Funktionswissen erforderlich (ist) (...) Manuelle Geschicklichkeit braucht nicht ausgebildet zu werden (...) die Anforderungen an die technische Intelligenz ... werden durch eine stärker habituelle Verhaltensorientierung relativiert (...) die physisch-nervliche Beanspruchung ... ist gering. Gewisse Belastungen sind durch Umgebungseinflüsse festzustellen, ferner durch manuelle Arbeiten in Stillstandssituationen.“50 In Bezug auf die Berufsqualifikation bemerkt LEPSIUS: „Wenn ein Betrieb von einem mittleren zu einem fortgeschritteneren Grad der Mechanisierung übergeht, so wird durch die einfache Tatsache, daß Teilarbeiten zusammengefaßt werden, im allgemeinen der Anteil der unqualifizierten Arbeiter im Betrieb verringert werden“51 „Schließlich verschwindet nach und nach die Kategorie der Hilfsarbeiter“ (ebd.: S. 299).
Daß mit zunehmender Automatisierung die Arbeitssituation erleichtert werden würde, bestreitet RAMMERT.52 KERN/SCHUMANN stellen in diesem Zusammenhang für den Automatenkontrolleur eines teilautomatisierten Einzelaggregates fest, daß „die Gesamtbeanspruchung ... durch intensive negative Umgebungseinflüsse eine Erhöhung (erfährt).“53 Der Arbeiter ist den Arbeitsgeräuschen zahlreicher Maschinen ohne Schutz ausgesetzt. (...) Darüber hinaus macht sich auch eine physische Belastung geltend: Der Automatenkontrolleur ist ständig auf den Beinen ...“ Weiters „sind anstrengende Körperhaltungen zu nennen“ (ebd.). TOURAINE nennt die Automatisierung eine „Entwicklung ... aufgrund deren die `produktiven´ Arbeiter in Kontrolleure verwandelt werden und die Instandhaltungsarbeiter direkter als früher in die Produktion eingreifen“ (...) Die Arbeiter ... haben mehr und mehr die Aufgabe ... den Prozeß der Fabrikation zu steuern (...) Der Leistungsbegriff spielt also eine immer größere und nicht eine immer zweitrangigere Rolle bei der Festsetzung des Qualifikationsniveaus. Der Automatenkontrolleur hat nicht nur Signale aufzunehmen, er muß sie verstehen, d.h., er muß sich den Produktionsprozeß, in den er nicht mehr direkt eingreift, vorstellen können. Er muß einen generellen Einblick haben, um die verschiedenen Informationen, die er als Kontrolle oder Darstellung des Produktionsprozesses von den Instrumenten empfängt, in einen kohärenten Zusammenhang bringen zu können.“54 Allerdings entgegnen KERN/-SCHUMANN dieser Feststellung der erhöhten Qualifikationsanforderung, indem sie bemerken, daß „die Arbeit alles in allem unqualifiziert (bleibt).“55 Während TOURAINE bemerkt, daß die Kontrolleure mehr und mehr den Instandhaltungsarbeitern zugewiesen werden (ebd.: S. 302), stellen KERN/- SCHUMANN fest, daß der Kontrolleur „Reparaturarbeiten ... anderen Hilfskräften überlassen muß“ (ebd.: S. 120). Weiters bemerken sie, daß „bei der Anlagenkontrolle ... die Kontrolltätigkeit im Vordergrund (steht)“ (ebd.: S. 124), während die Automatenführung in Stufe 7 noch „zahlreiche Übereinstimmungen mit der Apparateführung (zeigt)“ (ebd.: S. 115). In Bezug auf die Qualifikationsanforderungen bemerken sie, daß „die Anlagenkontrolle ... eine qualifizierte Angelerntentätigkeit (ist), mehr aber nicht“ (ebd.: S. 127). Allerdings ergänzen sie, daß „mit der Vergrößerung des Anlagenbereichs ... sich auch die Anforderungen an die Anlagekenntnisse (erhöhen)“ (ebd.: S. 128). Bezüglich der Arbeitsbelastungen stellen sie fest, daß sich, weil sich „der Arbeiter ... immer direkt an der Maschine auf(hält)“, „der Maschinenlärm ... unmittelbar auf ihn ein(wirkt)“ (ebd.: S. 128). Für die Automatenkontrolle läßt sich insgesamt feststellen, daß „sich auch unter den Bedingungen automatischer Produktion Tätigkeiten finden, die den Arbeiter in Unselbständigkeit drängen, an der Ausbildung von Qualifikationen hindern, hohen Arbeitsbelastungen aussetzen und in sozialer Hinsicht isolieren“ (ebd.: S. 135), auch wenn die Steuer- und Führungsarbeiten der Automatenführung und der Anlagenkontrolle „verhältnismäßig hohe Qualifikationen (zeigen)“ (ebd.: S. 136).
Schließlich versuchten POPITZ u.a. in ihren Untersuchungen von Arbeitsvollzügen in Hüttenwerken, die technischen und sozialen Bedingtheiten der Arbeit bzw. die Leistungsansprüche an den Arbeiter zu analysieren. Dabei stellen sie fest, daß sich industrielle Arbeit nicht isoliert vollzieht, „sondern im Rahmen größerer Arbeitszusammenhänge und daher Zusammenarbeit (ist)“ (ebd.: S. 38). Die Entdeckungen der zwanziger Jahre in den Hawthorne Werken der Western Electrics in Chicago, d.h. die Entdeckung des Einflusses, „den die sozialen Beziehungen der Arbeiter untereinander auf ihre Arbeitsleistung ausüben“56, weiterführend, bemerken sie, daß das Arbeitsgefüge (nicht die Gruppe) die typische Kooperationseinheit bildet, „dessen Einheit durch die Einheit der einzelnen technischen Anlage konstituiert wird“57 und deren „Elemente - Arbeitskräfte oder Arbeitsgruppen - gefügeartig kooperieren“ (ebd.: S. 74). In Bezug auf das Arbeitsgefüge unterscheiden sie insbesondere die teamartige- und die gefügeartige Kooperation 58, wobei „Kooperation nicht nur systematische Arbeitsteilung zur Voraussetzung hat, sondern auch die Technisierung der Produktion, d.h. die Verwendung von Maschinen, Apparaten und technischen Anlagen“ (ebd.: S. 70). Die Technik ist „Bedingung der Möglichkeit, daß diese und nicht andere Kooperationsformen entstehen“ (ebd.: S. 92). In Bezug auf die Mechanisierung bemerkt LEPSIUS dazu, daß „als neue Kooperationseinheit ein in der Ausübung seiner Arbeitsvollzüge spezialisiertes und technisch kompetentes Arbeitsgefüge (tritt).“59 In diesem Zusammenhang, bzw. in Bezug auf die Frage „wie der technische Gegenstand dem Arbeitenden gegeben ist und wie dieser sich zu ihm im Arbeitsvollzug verhält“60, unterscheiden POPITZ u.a. in ihrer Analyse des Arbeitsgefüges zwischen: 1. Arbeiten mit einer Maschine (Habitualisierung) und 2. Arbeiten an einer Maschine (Thema des Arbeitsvollzuges sind die Maschinen selbst). Die Kooperation selbst „stellt an jeden einzelnen Arbeiter eine bestimmte Anforderung“ (ebd.: S. 173), wobei „der Grad der Mechanisierung für die Art der Zusammenarbeit und der Arbeitsleistung eine entscheidende Rolle (spielt).“61 Das bedeutet, daß „mit zunehmender Technisierung der Industriearbeit ... die sozialen Kontakte, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben, einen auf präzise Leistungserfüllung abgestellten und versachlichten Charakter (gewinnen)“ (ebd.: S. 19). Durch die Rationalisierung (Mechanisierung) verändert sich nicht nur der Leistungsanspruch an den einzelnen Arbeiter, dessen „Selbstbewußtsein (...) auf diesem zu erfüllenden Leistungsanspruch aufbaut“ (ebd.: S. 21), sondern es ändern sich auch „die Sozialformen der Industriearbeit qualitativ, wobei mit der kontinuierlichen (...) Organisation des Arbeitsprozesses tendenziell die gleichrangige, horizontale Zusammenarbeit gegenüber der hierarchischen Unterordnung an Bedeutung gewinnt“ (ebd. S. 21-22). In diesem Zusammenhang, bzw. in Bezug auf die Automatisierung bemerkt BAHRDT62 beispielsweise, daß „diese Planung (die Durchplanung einer aufzubauenden, gesamten Anlage, d. Verf.) nur in einer engen Teamarbeit gleichrangiger verantwortlicher Spezialisten durchgeführt werden (kann), (...) das Ein-Mann-Prinzip ist gebrochen“ (ebd.: S. 134). Dieser These von der „Krise der Hierarchie“ widerspricht RAMMERT, indem er darauf hinweist, daß „die neuen Regelungs-, Organisations-und Informationstechnologien ... die individuelle Leistungskontrolle und die unternehmerische Verfügung über die Personalinformationen erheblich verstärkt (haben).“63
5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Bei der Auswertung verschiedener industriesoziologischer Arbeiten über `technischen Fortschritt´ ergibt es sich meiner Ansicht nach, die technische Entwicklung als historisch- gesellschaftliches Projekt zu definieren, wobei technischer Fortschritt überwiegend im Industriebetrieb (in dem wiederum Technik selbst entwickelt wird) aus Gründen des persönlichen Profits organisiert wird. Die Analyse der Struktur solcher Organisationen führt zu dem Ergebnis, daß sich die Systemrationalität als Strukturgesetz etabliert hat. Insbesondere die (in dieser Arbeit wenig erwähnten) Informations- und Kommunikationstechnologien bedingen, den Produktionsprozeß (als jenem konkreten Ort, an dem technischer Fortschritt organisiert wird) als kybernetisches System zu betrachten, in welchem sich die aus dem evolutorischen Entscheidungsfeld entwickelten unternehmerischen Strategien konkretisieren. Die Verwissenschaftlichung des Produktionsprozesses (IuK-Technologien als Ergebnis dieser Ausgliederung der Forschung und Entwicklung aus dem Produktionsprozeß) ermöglicht es, betriebliche Ziele kontingent zu setzen, d.h. Anforderungen der Systemumwelt (insbesondere der Konkurrenz) kann besser begegnet werden. Die unternehmerische Entscheidung über die Übernahme einer Technik ist zwar nicht durch die interne Struktur determiniert, wird jedoch auch im Hinblick auf die zukünftige interne Struktur (Machtverhältnisse) und unter Kostengesichtspunkten getroffen. Aufgrund der kontingenten Ursache-Folgen-Beziehung ist es beinahe unmöglich zukünftige Folgen einer betrieblichen Technikübernahme auf die Arbeit (insbesondere den einzelnen Arbeitsplatz) zu bestimmen bzw. Alternativen dazu vorzuschlagen (weshalb ich in dieser Arbeit solche Vorschläge auch nicht berücksichtigt habe). Phasen- und Stufenmodelle erlauben es jedoch, rückblickend, d.h. in Bezug auf die Mechanisierung und Automatisierung, Veränderungen im Industriebetrieb bzw. am Arbeitsplatz festzustellen, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Übergänge der verschiedenen Technisierungsniveaus in den einzelnen Industriebetrieben nicht kontinuierlich verlaufen.
LITERATURLISTE
Adorno Th. W.
Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft. Einleitungsvortrag zum 16. Deutschen Soziologentag
In: ders., Gesammelte Schriften 8, Frankfurt 1990
Altmann N. und Bechtle G.
Betriebliche Herrschaftsstrukturen und industrielle Gesellschaft
München 1971
Altmann N., Bechtle G. und Lutz B.
Betrieb-Technik-Arbeit - Elemente einer soziologischen Analytik technischorganisatorischer Veränderungen
München 1978
Bahrdt H.P.
Die Krise der Hierarchie im Wandel der Kooperationsformen
In: Mayntz Renate 1971, S. 127-134
Bechmann Gotthard u.a.
Technik und Gesellschaft
Frankfurt/New York 1982
Ewers H.-J., Becker C. und Fritsch M.
Wirkungen des Einsatzes computergestützter Techniken in Industriebetrieben
Berlin/New York 1990
Habermas Jürgen
Praktische Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
In: ders., Theorie und Praxis
Frankfurt 1971
Hausen K. und Rürup R.
Moderne Technikgeschichte
Köln 1975
Jokisch R.
Techniksoziologie
Frankfurt 1982
Kern H. und Schumann M.
Industriearbeit und Arbeiterbewuß tsein
Frankfurt 1973
König R. (Hg.)
Handbuch der empirischen Sozialforschung
Bd. 8, 2. Überarbeitete Auflage Stuttgart 1977
Lepsius Rainer M.
Strukturen und Wandlungen im Industriebetrieb - Industriesoziologische Forschung in Deutschland
München 1960
Littek W., Rammert W. und Wachtler G. (Hg.)
Einführung in die Arbeits- und Industriesoziologie
Frankfurt 1982
Luhmann Niklas
Zweck-Herrschaft-System - Grundbegriffe und Prämissen Max Webers
In: Mayntz Renate 1971, S. 36-55
Lutz B. und Schmidt G.
Industriesoziologie
In: König R. (Hg.) 1977
Mayntz Renate
Bürokratische Organisation
Köln 1971
Marcuse Herbert
Industrialisierung und Kapitalismus im Werk Max Webers
In: ders., Kultur und Gesellschaft 2
Frankfurt 1965
Popitz H., Bahrdt H.P. u.a.
Technik und Industriearbeit
Tübingen 1957
Rammert Werner (1982a)
Technik und Arbeit
In: Bechmann G. u.a. 1982
Rammert Werner (1982b)
Soziotechnische Evolution: Sozialstruktureller Wandel und Strategien der Technisierung
In: Jokisch R. 1982
Rammert Werner (1982c)
In: Littek W., Rammert W. und Wachtler G. (Hg.) 1982
Rammert Werner
Das Innovationsdilemma
Opladen 1988
Seltz Rüdiger u.a. (Hg.)
Organisation als soziales System
Berlin 1986
Touraine A.
Industriearbeit und Industrieunternehmen - Vom beruflichen zum technischen System der Arbeit
In: Hausen K. und Rürup R. 1975
Zündorf Lutz
Macht, Einfluß , Vertrauen und Verständigung - Zum Problem der Handlungskoordinierung in Arbeitsorganisationen
In: Seltz Rüdiger u.a. (Hg.) 1986
[...]
1 vgl. dazu die Beiträge von W. Rammert (1982c) in: W. Littek, W. Rammert, G. Wachtler (Hg.), Einführung in die Arbeits- und Industriesoziologie, Frankfurt 1982
2 Th. W. Adorno, Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft, Einleitungsvortrag zum 16. Deutschen Soziologentag, in: ders., Gesammelte Schriften 8, Frankfurt 1990, S. 361
3 B. Lutz/G. Schmidt, Industriesoziologie, in: R. König (Hg.), Handbuch der empirischen Sozialforschung, Bd. 8, 2. Überarbeitete Auflage, Stuttgart 1977, S. 184
4 vgl. dazu: H. Marcuse, , Industrialisierung und Kapitalismus im Werk Max Webers, in: ders., Kultur und Gesellschaft 2, Frankfurt 1965, ab S. 116
5 J. Habermas, Praktische Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, in: Ders., Theorie und Praxis, Frankfurt 1971, S. 337
6 J. Habermas 1968, S. 62
7 J. Habermas 1971, S. 337
8 J. Habermas 1968, S. 62
9 „Diese analytische Abgrenzung zwischen zweckrationalem und kommunikativem Handeln erfüllt zweifellos eine kritische Funktion, indem sie sich gegen technizistische Interpretationen der von Marx dargestellten Dialektik von Produktivkräften und Produk-tionsverhältnissen wendet und gegenüber einer überzogenen eindimensionalen Interpre-tation der von Weber beschriebenen Durchsetzung des Typus zweckrationalen Handelns einen Kontrapunkt setzt.“ (Rammert 1982b, Soziotechnische Evolution: Sozialstruktureller Wandel und Strategien der Technisierung, in: R. Jokisch, Techniksoziologie, Frankfurt 1982, S. 50)
10 „Technik ist jeweils ein geschichtlich-gesellschaftliches Projekt; in ihr ist projektiert, was eine Gesellschaft und die sie beherrschenden Interessen mit dem Menschen und mit den Dingen zu machen gedenken.“ (H. Marcuse 1965, S. 127)
11 N. Altmann/G. Bechtle, Betriebliche Herrschaftsstruktur und industrielle Gesellschaft, München 1971, S. 17
12 W. Rammert, Das Innovationsdilemma, Opladen 1988, S. 19
13 W. Rammert 1982b, S. 52
14 W. Rammert 1982c, S. 44
15 W. Rammert 1988, S. 20
16 W. Rammert 1982b, S. 36
17 vgl. N. Luhmann, Zweck-Herrschaft-System - Grundbegriffe und Prämissen Max We-bers, in: R. Mayntz, Bürokratische Organisation, Köln 1971, S. 36-55
18 Zur Kritik an der Handlungskoordinierung durch Befehl vgl. u.a. Lutz Zündorf, Macht, Einfluß , Vertrauen und Verständigung - Zum Problem der Handlungskoordinierung in Arbeitsorganisationen, in: Seltz Rüdiger u.a. (Hg.), Organisation als soziales System, Berlin 1986)
19 N. Luhmann 1971, S. 38
20 N. Altmann/G. Bechtle 1971, S. 8
21 W. Rammert 1988, S. 88
22 N. Altmann/G. Bechtle/B. Lutz, Betrieb-Technik-Arbeit - Elemente einer soziologi-schen Analytik technischorganisatorischer Veränderungen, München 1978, S. 153
23 N. Altmann/G. Bechtle 1971, S. 13
24 vgl. N. Altmann/G. Bechtle/B. Lutz 1978
25 N. Altmann/G. Bechtle 1971, S. 30
26 vgl. W. Rammert 1982b
27 W. Rammert 1988, S. 64
28 N. Altmann/G. Bechtle 1971, S. 14
29 Das Unternehmen eignet sich besonders zur Typisierung einer Gesellschaft, „da mit der funktional differenzierten Analytik nach den Strategien in allen drei Dimensionen gefragt, ihre historisch und situativ wirksame Bedeutung erfaßt und auch eine mögliche Verände-rung innerhalb der Strategieform zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden kann.“ (Rammert 1982b, S. 70)
30 „Strategie meint nicht einfach eine unternehmerische Entscheidung, z.B. auf welchem Markt mit welcher Art von Produkten welches Ziel erreicht werden soll, woraus dann eine optimale Organisationsform abgeleitet werden kann, sondern ein in der Unternehmens-struktur geronnenes Organisationsprinzip, das sich logisch aus dem Verhältnis von Kapital-verwertung und stofflich internen und externen Rahmenbedingungen herleiten und histo-risch aus der Unternehmenspolitik als strategische Verkettung von Einzelentscheidungen angesichts drohender Autonomiebeschränkungen rekonstruieren läßt.“ (W. Rammert 1988, S. 28)
31 H.-J. Ewers, C. Becker, M. Fritsch, Wirkungen des Einsatzes computergestützter Tech-niken in Industriebetrieben, Berlin/N.Y. 1990, S. 31
32 N. Altmann/G. Bechtle 1971, S. 51
33 N. Altmann/G. Bechtle/B. Lutz 1978, S. 154
34 vgl. N. Altmann/G. Bechtle/B. Lutz 1978
35 vgl. W. Rammert 1982b, S. 61
36 vgl. W. Rammert 1988, ab S. 20
37 vgl. W. Rammert 1982 c/1, ab S. 45
38 W. Rammert 1982b, S. 56
39 vgl. W. Rammert 1988, S. 32
40 vgl. W. Rammert 1982b
41 W. Rammert, 1982c, S. 67
42 W. Rammert, Technik und Arbeit, in: Bechmann Gotthard u.a., Technik und Gesell-schaft, Frankfurt/N.Y., 1982a
43 W. Rammert 1982a, S. 27
44 vgl. N. Altmann/G. Bechtle/B. Lutz 1978, S. 51
45 H. Kern/M. Schumann, Industriearbeit und Arbeiterbewuß tsein, Frankfurt 1973, S. 23
46 A. Touraine, Industriearbeit und Industrieunternehmen - Vom beruflichen zum techni-schen System der Arbeit, in: K. Hausen/R. Rürup, Moderne Technikgeschichte, Köln 1975
47 H. Popitz/H.P. Bahrdt u.a., Technik und Industriearbeit, Tübingen 1957, S. 27
48 vgl. H. Kern/M. Schumann 1973, S. 54
49 A. Touraine 1975, S. 296
50 H. Kern/M. Schumann 1973, S. 108
51 A. Touraine 1975, S. 298
52 vgl. W. Rammert 1982c, S. 28
53 H. Kern/M. Schumann 1973, S. 122
54 vgl. A. Touraine 1975, S. 301-302
55 H. Kern/M. Schumann 1973, S. 121
56 M. Rainer Lepsius , Strukturen und Wandlungen im Industriebetrieb - Industriesoziologische Forschung in Deutschland, München 1960, S. 14
57 H. Popitz/H.P. Bahrdt u.a. 1957, S. 46
58 zur Unterscheidung siehe ebd., S. 47-72
59 M. Rainer Lepsius 1960, S. 19
60 H. Popitz/H.P. Bahrdt u.a. 1957, S. 112
61 M. Rainer Lepsius 1960, S. 15
62 H.P. Bahrdt, Die Krise der Hierarchie im Wandel der Kooperationsformen, in: R. Mayntz, Bürokratische Organisation, Köln 1971, S. 127-134
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Fokus der Analyse im Text?
Die Analyse konzentriert sich auf das Verhältnis von Technik und Arbeit, beginnend mit einer Beschreibung des Begriffs "technischer Fortschritt".
Wie wird technischer Fortschritt definiert?
Technischer Fortschritt wird als ein gesellschaftlich-historisches Projekt betrachtet, das strukturelle Elemente des Komplexes Technik definiert und im Kontext der Organisierung analysiert wird.
Wo wird technischer Fortschritt hauptsächlich organisiert?
Der technische Fortschritt wird primär im Industriebetrieb organisiert, was zur Untersuchung der Dynamik technischer Entwicklung in diesem Umfeld führt.
Welche methodischen Ansätze werden zur Analyse der Dynamik technischer Entwicklung verwendet?
Der betriebsstrategische Ansatz wird zur Analyse der Dynamik technischer Entwicklung herangezogen, wobei insbesondere die Handlungs- und Systemrationalität betrachtet werden.
Welche Rolle spielt die Systemumwelt bei der Organisation der Technikentwicklung in Industriebetrieben?
Die Systemumwelt beeinflusst die Organisation der Technikentwicklung in Industriebetrieben, und die Betriebe reagieren darauf mit betriebsstrategischen Ansätzen.
Wie werden die Folgen der Technisierung auf den Arbeitsplatz untersucht?
Mithilfe verschiedener Arbeiten, insbesondere Phasen- und Stufenmodellen, werden die Folgen der Technisierung auf den Arbeitsplatz bzw. auf die "Arbeiter" analysiert.
Was sind die strukturellen Elemente des technischen Fortschritts nach Habermas?
Habermas unterscheidet zwischen technischen Mitteln (vergegenständlichten Prozessen) und technischen Regeln (System von Regeln, die zweckrationales Handeln zur wissenschaftlich rationalisierten Verfügung über vergegenständlichte Prozesse festlegen).
Wie unterscheidet Habermas zwischen Handlungsarten?
Habermas unterscheidet zwischen zweckrationalem Handeln (instrumentales Handeln, rationale Wahl oder eine Kombination von beiden) und kommunikativem Handeln.
Was impliziert die Definition von Technik als "geschichtlich-gesellschaftliches Projekt"?
Diese Definition impliziert, dass technischer Fortschritt als ein der Gesellschaft immanenter Prozess verstanden wird, bei dem Produktionsprozesse nicht nur nach technisch-funktionalen Aspekten zur Effizienzsteigerung konditioniert, sondern auch als Instrument der Interessendurchsetzung missbraucht werden.
Was versteht man unter "Autonomiestrategien" im betrieblichen Kontext?
Autonomiestrategien zielen darauf ab, das Produktionsziel so zu organisieren, dass das betriebliche Herrschaftssystem nicht von betriebsfremden Leistungen und Auflagen abhängig gemacht wird.
Welche Dimensionen der Rationalisierung werden im Text unterschieden?
Es werden die Dimensionen Technisierung (Tendenz zu wachsender Autonomie), Standardisierung/Organisierung (Tendenz zu wachsender Determiniertheit) und Verwissenschaftlichung unterschieden.
Wie beeinflusst die Konkurrenz die Autonomie des Unternehmens?
Die Konkurrenz schränkt die Autonomie des Unternehmens ein, indem Unternehmen unter dem Aspekt der Rentabilität und Kostengesichtspunkten konkurrieren.
Wie verändert sich die Arbeitswelt durch die Mechanisierung und Automatisierung?
Mechanisierung und Automatisierung führen zu einer Verdrängung der Arbeiter aus dem direkten Produktionsprozess, wobei die direkte Produktionstätigkeit durch indirekte Steuerungs- und Kontrollarbeit ersetzt wird.
Welche Kooperationsformen werden im Zusammenhang mit der Industriearbeit unterschieden?
Es werden teamartige und gefügeartige Kooperation unterschieden, wobei die Technik die Bedingung dafür ist, dass bestimmte Kooperationsformen entstehen.
Welche Kritik wird an Phasen- und Stufenmodellen geübt?
Es wird kritisiert, dass sich technischer Fortschritt aus einer Mehrzahl von Tendenzen zusammensetzt, die eine Anzahl möglicher Entwicklungen mit mehreren möglichen Konsequenzen bewirken, und dass es keine globalen Stufen des technischen Fortschritts gibt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 1998, Technik und Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96653