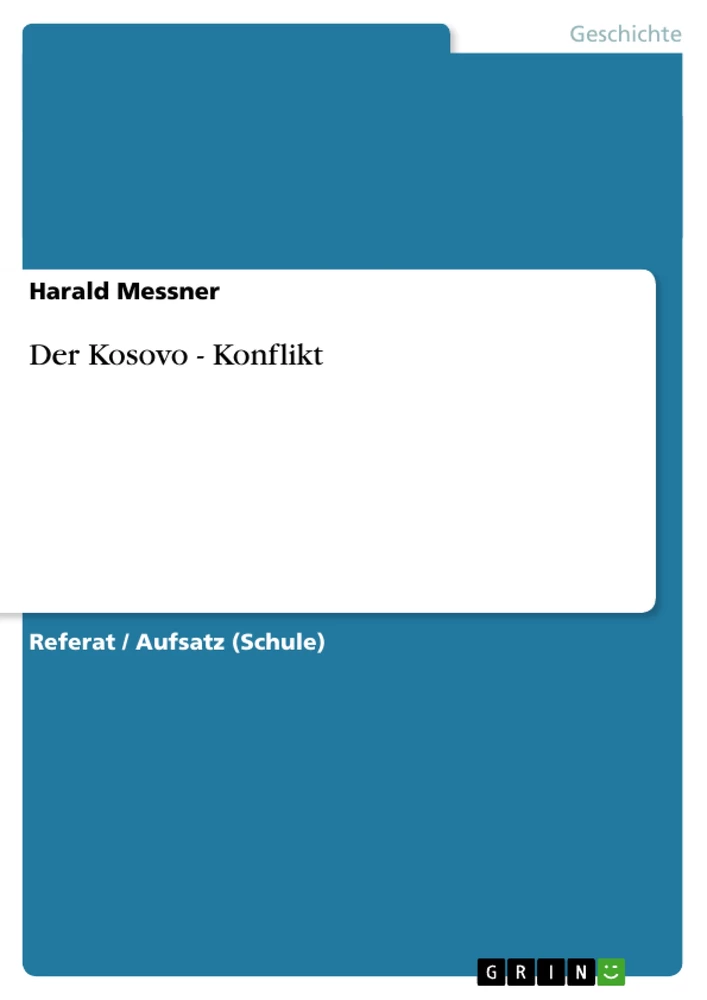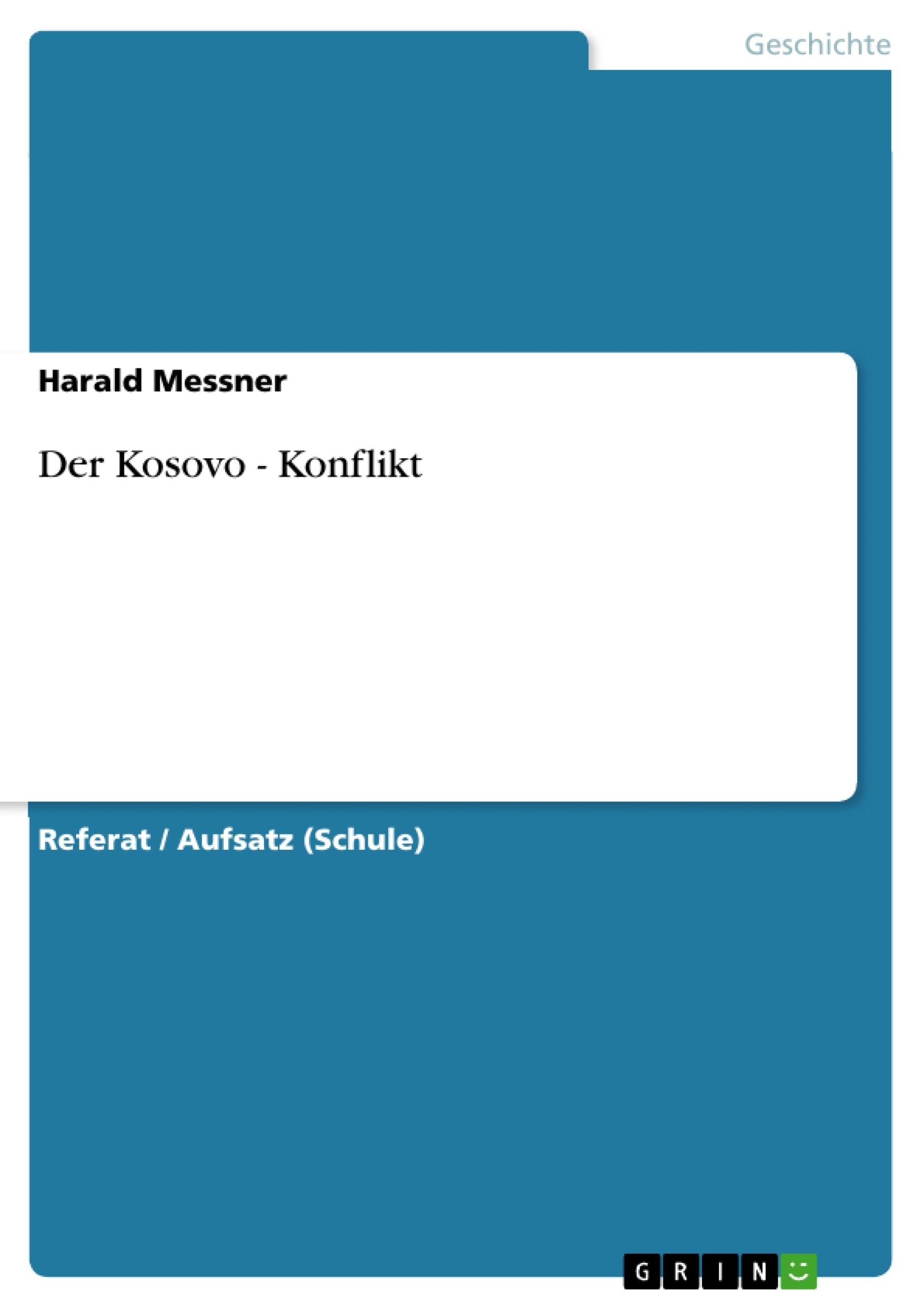Entwicklung des Kosovo
Vorgeschichte des Kosovo:
Bereits im 7. Jahrhundert siedelte sich der Stammesverband der Serben in den zentralen und westlichen Balkangebieten an. Schließlich bildeten sich aber nördlich und östlich von Kosovo zwei politische serbische Kerngebiete; Raszien und Dioklija. Im Jahr 1260 begann von Raszien aus die Formierung des mittelalterlichen serbischen Reiches. Dieses Reich bestand unter der Führung der Nemanjiden über zwei Jahrhunderte und beinhaltete in seiner größten Ausdehnung auch sämtliche albanische Siedlungsgebiete. Zu dieser spielte es noch keine Rolle, zu welcher ethnischen Gruppe ein Herrscher gezählt hat und so konnten auch einzelne albanische Familien zu den Führenden des serbischen Reiches aufsteigen.
Der Kosovo erstmals unter serbischer Herrschaft (1285 - 1455):
Nach 1180 weitete Stefan Nemanja und seine Nachfolger die serbische Herrschaft über Dioklija und Nordalbanien aus. Das serbische Reich umfasste in seiner größten Ausdehnung (ca. um die Mitte des 14. Jahrhunderts) auch einen Großteil des heutigen griechischen Festlandes. Über die damalige Bevölkerung ist sehr viel bekannt; an der Spitze der sozialen Pyramide standen die Könige aus dem Haus der Nemanjiden sowie der hohe und niedere Adel. Ihre Macht und Herrschaft beruhten auf ihrem Besitz und auf der Verfügungsgewalt über das Land und den darauf lebenden Menschen. Dieses Monopol hatte nur das Herrscherhaus und der Adel inne. Die nächste soziale Schicht wurden von den abhängigen Bauern, den Angehörigen verschiedenster Berufsgruppen und einer großen Anzahl von Untertanen gebildet. Zu dieser Zeit gab es keine ethnische Grenze zwischen der Schicht der Feudalherren und den Untertanen, denn in beiden Gruppen waren sowohl Serben als auch Albaner vertreten. Von der ethnischen Zugehörigkeit her kann man für diese Zeit vier Bevölkerungsgruppen unterscheiden; die Serben, die Albaner, die Vlachen und die sächsischen Bergleute, die zwar eine kleine aber ökonomisch sehr wichtige Gruppe waren. Noch heute spielen die Minen eine wichtige Rolle und man kann sich leicht vorstellen, dass zu sie damals von größter Bedeutung für das serbische Reich waren. Diese Bergleute hatten einige Privilegien gegenüber der “normalen“ Bevölkerung und sie hatten außerdem eine eigene Gerichtsbarkeit. Die Vlachen stellten eine Gruppe von Viehhaltern dar, die nomadische Ziegenhaltung betrieben. Die Vlachen waren orthodox, sprachen slawisch und gesellten sich zu den Serben. Aber auch die Kultur im Kosovo kam nicht zu kurz, denn es wurden hunderte von Kirchen und Klöstern gegründet, die im Rahmen der serbischen Kunst- und Kulturgeschichte eine herausragende Bedeutung besaßen und als außerordentlich wertvoll einzuschätzen sind. Zu diesen Gründungen gehörte auch die Patriarchenkirche in Peº/Peja, die 1346 zum Sitz der unabhängigen serbischen Kirche wurde. Unter der Herrschaft Stefan Duëans aus dem Haus der Nemajiden erreichte das mittelalterliche serbische Reich seine größte Ausdehnung und stand im Höhepunkt seiner Macht. Seinen Nachfolger, denen er ein stabiles Reich hinterließ, gelang es nicht, das Reich zusammenzuhalten und es zerfiel in einzelne Feudaleinheiten, die nicht mehr in der Lage waren der Gefahr, die von den Osmanen ausging, militärisch zu widerstehen. Die Osmanen, überschritten Mitte des Jahrhunderts die Dardanellen (Meerenge im Nordwesten der Türkei; zwischen der asiatischen Türkei und der europäischen Türkei gehört. Die Dardanellen verbinden das Ägäische Meer mit dem Marmarameer und sind Teil der Verbindung zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer. Sie bilden eine natürliche Grenze zwischen Europa und Asien.) und drangen in den folgenden zwei Jahrhunderten bis nach Zentraleuropa vor.
Die Schlacht am Amselfeld (1389):
Im Frühjahr des Jahres 1389 bereitete Sultan Murad I. (1360 - 1389) einen weiteren Feldzug gegen die zentralen Balkangebiete vor; die südlichen Gebiete hatte er bereits unterworfen. Sein Gegner war der serbische Feudalherrscher Fürst Lazar (1371 - 1389), der seinen Amtssitz nördlich des Amselfeldes in Kurëevac hatte. Schließlich wurde die weite Ebene des Amselfeldes der Schauplatz einer Schlacht, an der auf der osmanischen Seite rund 30.000 und auf seiten des serbischen Koalitionsheeres, das von Kroaten und Bosniern unterstützt wurde, 20.000 Soldaten teilnahmen. Die Schlacht am 28. Juni 1389 dauerte nur einen Tag doch es ist kurios, dass beide Heeresführer in der Schlacht ihr Leben lassen mussten. So endete die Schlacht mit den Tod beider Anführer und mit einer Niederlage der Serben. Die serbischen Gebiete waren nun abhängig vom Osmanischen Reich, doch die endgültige Unterwerfung erfolgte erst im Jahr 1459. Nach dem Tod des Fürsten Lazar, entstand ein Mythos, zu dem die serbische Kirch viel beitrug; diese bezeichnete seinen Tod als Märtyrertum für Glaube und Volk, denn er opferte sich für das Wohl des serbischen Volkes und deshalb musste er der eigentliche Sieger dieser Schlacht sein. Er galt als der von Gott auserwählte gute Hirte und wurde sofort heiliggesprochen. Erst im 19. Jahrhundert wurde sie aufgezeichnet. Nennenswert ist auch, dass der 600. Jahrestag der Schlacht im Jahr 1989 von der Politik sehr gut inszeniert wurde. Zu dieser Zeit begann auch der politische Aufstieg von Slobodan Miloëeviº, der mit seiner Rede am 28. Juni 1989 viele Serben für sich gewinnen konnte.
Die Osmanische Herrschaft (1455 - 1912):
Das Kosovo mit seiner orthodoxen Bevölkerung und seinen verschiedenen ethnischen Gruppen wurde nun endgültig in das Osmanische Reich integriert. Zu dieser Zeit bildete die serbisch-orthodoxe Bevölkerung die Mehrheit. Die Osmanen teilten die serbische und albanische Bevölkerung auf mehrere Verwaltungseinheiten auf, doch das Kosovo bildete nie eine administrative Einheit. Gegen Ende der osmanischen Herrschaft über das Kosovo, Albanien und Mazedonien waren die Territorien in sogenannte Vilayets gegliedert, wobei der Vilayet Kosovo wesentlich umfangreicher war als die gegenwärtigen Verwaltungsgrenzen. Diese Zonen zählten zu den Peripheriezonen (Randgebieten) des Osmanischen Reiches und die Verwaltungstätigkeit beschränkte sich vielfach auf formale Akte oder Unterordnungen. Das Osmanische Reich beruhte auf der religiösen Grundlage des sunnitischen Islam, was zu bedeuten hatte, dass nur Muslime volle soziale und ökonomische Aufstiegschancen eingeräumt wurden. So war zum Beispiel Bodenbesitz beziehungsweise die Verfügungsgewalt über den Boden nur ihnen, nicht jedoch den Christen, erlaubt. Die christliche Bevölkerung wurde aber nicht verfolgt oder zum Übertritt in den Islam gezwungen. Sie wurden als eine eigene Volksgruppe toleriert, jedoch hatten sie im Vergleich zur muslimischen Bevölkerung in einigen Bereichen Nachteile zu ertragen. Außerdem waren sie gezwungen eine Sondersteuer, die sogenannte Kopfsteuer, zu bezahlen, sie durften keine Waffen besitzen, nicht in der osmanischen Armee einen Militärdienst ausüben und sie wurden, wenn sie in Dörfern oder Städten mit muslimischer Bevölkerung zusammenlebten, an der Ausübung ihrer religiösen Riten insofern behindert, als dass sie keine Kirchen errichten durften, denn das hätte “die Gefühle der Muslime verletzt“. Im Osmanischen Reich wurde aber keine bestimmte Religion durch das Herrscherhaus bevorzugt; währenddessen zum Beispiel im Habsburger Reich der Katholizismus ein Religionsmonopol hatte. Die orthodoxe Gemeinschaft des Reiches wurde von ihrem religiösen Führer, vom Patriarchen von Konstantinopel, verwaltet. Die kirchlichen Institutionen, die Bischöfe und die Popen (Priester in der orthodoxen Kirche) dienten als administrative Struktur. Die Osmanen hatten bei ihrer Eroberung das Patriarchat von Peº/Peja ausgeschaltet, doch im Jahre 1557 wurde es wieder installiert. Das Patriarchat war für die orthodoxe Bevölkerung (Serben und Albaner) zuständig. Es kam natürlich auch zu Glaubensübertritten gekommen, wobei festzustellen ist, dass mehrheitlich die albanische Bevölkerung den Schritt zum Islam wagte. Hingegen traten nur wenige Serben den Islam bei. Im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts änderte sich die Zusammensetzung der Bevölkerung jedoch entscheidend. Viele Serben wanderten ab und Albaner wanderten ein. Im 19. Jahrhundert und beginnenden 20. Jahrhundert stellten die muslimischen Albaner im Kosovo bereits die Bevölkerungsmehrheit dar. Wichtig ist es auch noch zu sagen, dass die Glaubensübertritte auch eine soziale und ökonomische Veränderungen hervorgerufen haben. Albanischen Muslimen wurde es ermöglicht Boden- oder Gutsbesitzer zu werden; auf den Gutsbesitzungen gab es sowohl muslimisch-albanische als auch orthodox-serbische Pächter. Für das Verhältnis zwischen Albanern und Serben bedeutete dies aber, dass die Albaner die Herren und die Serben die „Untertanen“ waren. Zwischen der christlichen und muslimischen Zivilisation bestanden erheblich Unterschiede, nicht nur in religiöser Hinsicht, sondern auch was das alltägliche Leben anlangte. Durch die unterschiedliche Religionszugehörigkeit entstand eine kulturelle Auseinanderentwicklung der beiden Bevölkerungsgruppen.
Die Große Serbische Wanderung 1690:
Im Jahr 1683 hatten die Osmanen Wien zum zweiten Mal belagert, doch der Ausgang dieser Belagerung endete für das Osmanische Heer fatal, denn sie konnten erstens Wien nicht einnehmen und zweitens wurde die Osmanische Armee durch die habsburgischen Truppen weit zurückgeschlagen. Der Friedensvertrag von 1699 legte fest, dass die Osmanen Ungarn, Siebenbürgen, Slawonien, Syrmien und das Gebiet der heutigen Vojvodina abtreten mussten. Nun verlief die osmanisch-habsburgische Grenze vor den Toren Belgrads. Während der Kampfhandlungen waren die Habsburger weit in den Balkan vorgedrungen; bis nach Bosnien, in das Kosovo und nach Mazedonien. Bei dieser Eroberung wurde rücksichtslos gegenüber der muslimischen Bevölkerung vorgegangen; es wurden Dörfer niedergebrannt und Moscheen zerstört. Die habsburgischen Truppen wurden dabei von der christlichen Bevölkerung unterstützt. Doch im Jahr 1690 kam es zu einer Wende: einerseits organisierten die Osmanen erfolgreiche Angriffe und andererseits musste sich die Habsburger-Armee zurückziehen, weil sie die Westgrenzen gegen Frankreich verteidigen mussten. Diese Entwicklung hatte eine massive „Völkerwanderung“ von Christen und Serben, die aus den zentralen Balkangebieten in Richtung Norden, nach Belgrad und darüber hinaus wanderten, zur Folge. Unter der Führung des serbischen Patriarchen Arsenije verließen im Herbst des Jahres 1690 rund 40.000 Menschen das Kosovo und die umliegenden Gebiete. Diese Wanderungsbewegung ging als „Große Serbische Wanderung“ in die Geschichte ein. Seit dem Ende des 17. Und besonders stark im 18. Jahrhundert begannen hunderte von albanischen (beinahe ausschließlich muslimische) Familien abzuwandern, um sich in den Ebenen des Kosovo und an dessen Randgebieten niederzulassen.
1830: Erfolgreiche Unabhängigkeitsbewegungen und Staatenbildungen: Serbien
Nach dreieinhalb Jahrhunderten der osmanischen Herrschaft waren es die Serben, die den ersten wirksamen Aufstand gegen die Osmanen durchführten. Es gibt zwei Gründe, warum der erste serbische Aufstand typisch für die folgenden Aufstände und Widerstandsbewegungen ist; erstens wurden keine klaren politischen Ziele verfolgt und zweitens, weil Russland eine wichtige Rolle spielte, denn für Russland war und ist auch heute noch den Balkan Teil seiner europäischen Sicherheitszone. Die orthodoxen Balkanvölker wurden in ihren Bestrebungen von Russland unterstützt. Russland musste aber im Falle Serbiens den Aufständischen zweimal die Unterstützung verwehren, da es auf widerstrebende Großmachtkonstellationen Rücksicht nehmen musste. Der erste serbische Aufstand, geführt von Kara Djordje, dem Begründer der serbischen Königsdynastie der Karadjordjeviºi, war nicht erfolgreich und wurde 1813 niedergeschlagen. Miloë Obrenoviº, der Begründer einer weiteren serbischen Königsdynastie, schaffte es, ab dem Jahre 1830 einen autonomen Status für ein Fürstentum Serbien im Rahmen des Osmanischen Reichs zu erlangen. Die Serben hatten insgeheim den Plan, die mittelalterlichen Herrschaftsterritorien wieder zu erobern und sich einen Zugang zur Adria zu verschaffen. Dieses Ziel war natürlich schwer zu realisieren, zumal für ein kleines halbsouveränes Fürstentum, das von Großmächten umgeben war. Doch die Serben besaßen eine sehr gute Außenpolitik und sie verstanden es die Möglichkeiten die sie ihnen bot zu nutzen. Sie eroberten die ehemaligen mittelalterlichen Kerngebiete von den Osmanen zurück. 1833 folgte der Zugewinn eines kleinen Gebietstreifens, ein knappes halbes Jahrhundert später der Zugewinn von Nië und Südostserbien und etwa 40 Jahre später wurden das Kosovo und Südserbien (Mazedonien) angegliedert.
Die albanische Wiedergeburt und die Integration des Kosovo in Serbien (1912 - 1913):
Während also das Fürstentum und spätere Königreich Serbien sich Schritt für Schritt im Sinne einer Rückeroberung der vor rund einem halben Jahrtausend verlorenen Gebiete in Richtung des Kosovo vorarbeitete, setzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so etwas wie eine albanische nationale Integration ein. Diese nationale Selbstfindung war allerdings ein schwieriger Weg, denn ein Großteil der Bevölkerung war muslimisch und zu diesem Zeitpunkt noch dem osmanischen Sultan treu; der Rest war katholisch und orthodox.
Die Liga von Prizren (1878):
Das Jahr 1878 wurde zum Entscheidungsjahr für die albanische nationale Identität, weil der „Friede von San Stefano“ zwischen dem Russischen und dem Osmanischen Reich vorsah, dass die südalbanischen Gebiete einem wiedererrichteten Großbulgarischen Reich zufallen sollten. Dagegen protestierten Intellektuelle und Politiker der südalbanischen Gebiete. Einer von ihnen war Abdyll FrashÁri; er schaffte es die einflussreichsten albanischen Führer in der südkosovarischen Stadt Prizren zu versammeln; die meisten trafen dort am 10. Juni 1878 ein. Das politische Programm dieser Liga von Prizren sah vor, dass die albanisch besiedelten Gebiete eine Autonomie innerhalb des Osmanischen Reiches und Steuerhoheit erreichen wollten. Es wurde außerdem auch eine Armee von ihnen aufgestellt, die die Erreichung dieser Zeile unterstützen und gewährleisten sollte. Dieser Initiative fehlt es allerdings an internationaler Anerkennung. Der Berliner Kongreß, der im Juli und August des Jahres 1878 tagte, wollt sich mit den albanischen Problemen nicht auseinandersetzen. Allerdings wurde dort die Souveränität Rumäniens, Serbiens und Montenegros bestätigt. Trotzdem kam es in den Jahren 1912 und 1913 zu den beiden Balkankriegen, die zur Folge hatten, dass das Kosovo in das Königreich Serbien eingegliedert wurde. Obwohl die Serben die Macht wieder übernommen hatten, übten sie blutigen Revancheakte gegen die albanische Bevölkerung aus, die gegen die serbische Eroberung Widerstand geleistet hatten.
Der Erste Weltkrieg:
Unmittelbarer Auslöser des 1. Weltkrieges war die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gemahlin am 28. Juni 1914 in Sarajevo durch den Studenten Gavrilo Princip. Ein Monat später erfolgte auch die Kriegserklärung Österreich- Ungarns an Serbien. Als unmittelbare Reaktion darauf drangen serbische Einheiten in das albanische Staatsgebiet vor. Im Juni 1915 wurden sogar Tirana und Elbasan eingenommen. Erst die deutsch-österreichische Offensive sowie der Kriegseintritt Bulgariens im September 1915 auf Seiten der Mittelmächte zwangen die serbischen Einheiten zum Rückzug. Die vorrückenden deutschen, habsburgischen und bulgarischen Truppen ließen den Serben nur noch die Wahl zwischen Kapitulation und Flucht über das unwegsame und feindliche nordalbanische Hochland. Stark dezimiert zogen die geschlagenen Divisionen durch das winterliche Kosovo in Richtung Südwesten bis an die adriatische Küste, wo sie von Flottenverbänden der Alliierten nach Korfu evakuiert wurden. Im Jänner 1916 wurde auch Montenegro von den Truppen der Habsburger besetzt. Damit hatten die Mittelmächte die Kontrolle über den Balkan weitgehend gefestigt. Bulgarien und das Osmanische Reich waren verbündet und Serbien war unterworfen worden. Im August 1916 trat Rumänien auf Seiten der Alliierten in den Krieg ein, erlitt jedoch zusammen mit den russischen Einheiten schwere Niederlagen in Siebenbürgen und in dessen Umgebung. Im Dezember 1916 wurde auch Bukarest von den Mittelmächten eingenommen. Die albanische Bevölkerung empfing die Besatzer enthusiastisch und zahlreiche Freiwillige schlossen sich den deutschen und habsburgischen Truppen an. Im November 1915 wurde das Kosovo zwischen Österreich- Ungarn und Bulgarien aufgeteilt. Im Norden des Kosovo (Besatzungszone Österreichs) wurde eine albanische Verwaltung eingerichtet und albanische Schulen eröffnet. Die Russische Revolution 1917 gab den Mittelmächten noch einmal die Chance zu einer gewaltigen Machtsteigerung im Osten. Der Kriegseintritt der USA im selben Jahr und die physische und moralische Erschöpfung insbesondere Österreich-Ungarns sowie des Osmanischen Reiches leiteten jedoch die Niederlage der Mittelmächte ein. Im Juni 1917 trat auch Griechenland auf Seiten der Alliierten in den Krieg ein. Die Mittelmächte vermochten diesem Vormarsch nicht mehr standzuhalten. Bulgarien kapitulierte am 29. September 1918. Die verbleibenden deutschen und habsburgischen Truppen waren gezwungen, den Rückzug anzutreten. Damit endete auch die Zeit der Besatzung im Kosovo und die Herrschaft ging wieder an Serbien über.
Kosovo im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen:
Am 1. Dezember 1918 wurde der neue jugoslawische Staat, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat), gegründet. Von Anfang an waren sich die maßgeblichen politischen Fraktionen des neu gegründeten Staates über die zukünftige Staatsform und den Staatsaufbau uneinig. Nationale standen gesamtstaatlichen Interessen genauso gegenüber, wie das Konzept eines zentralistischen Staatsaufbaus dem eines föderalen. Die Serben hatten mehr Macht als die Slowenen und Kroaten, da sie zu den Siegermächten des Ersten Weltkrieges gehörten, weil sie die größte Volksgruppe stellten und weil sie über eine eigene Armee verfügten. Dies wirkte sich auf die Stellung der Albaner und auf die weitere Entwicklung des Staates problematisch aus. Schließlich wurde am 28. Juni 1921, dem Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld, ein zentralistischer Verfassungsentwurf mit einfacher Mehrheit durchgesetzt. Außerdem beschloss man auch eine Verwaltungsreform, die das Land in 33 Provinzen aufteilte, die jeweils von einem Präfekten verwaltet wurden, den der König direkt einsetzte. Serbien hatte damit seine Machtposition gefestigt und dadurch war eine denkbar schlechte Basis für die Zusammenarbeit mit den übrigen Fraktionen und Volksgruppen geschaffen worden. Auf die Probleme der Albaner wurde nicht weiter eingegangen, da sie die Serben als „befreit“ erklärten, obwohl sie dadurch eher ihrer Rechte beraubt wurden. Die Regierung in Belgrad hatte den Albanern große Versprechungen gemacht, wie zum Beispiel die Eröffnung von albanischen Schulen, die Einbindung in die lokale Verwaltung, die Respektierung grundlegender politischer Rechte, die Verwendung der albanischen Sprache in Ämtern und vieles mehr. Deshalb unterstützten die kosovo-albanischen Abgeordneten auch den zentralistischen Verfassungsentwurf der Regierungsparteien. Doch die Albaner mussten in der Folge feststellen, dass die Regierung kein Interesse daran hatte, ihre missliche Lage zu verändern. Ebensowenig wurden die 1919 in den Konvention zum Schutz von Minderheiten international zugesicherten Grundrechte umgesetzt. Der Völkerbund, der deren Einhaltung überwachte, nahm dies ohnmächtig zur Kenntnis.
Die Ka¸ak - Bewegung:
Mit der serbischen Machtübernahme begann auch die Phase der bewaffneten Rebellionen in weiten Teilen des Kosovo. Die sogenannten Ka¸aks (dt. Banditen, Räuber) wurden von der Regierung in Belgrad nicht als politisch motivierte Aktivisten angesehen, sondern einfach als Räuber und Banditen. Damit wurde den Behörden der Vorwand für ihre Politik der bedingungslosen Unterdrückung und Verfolgung geliefert, die sehr vielen Zivilisten das Leben kostete. Die Ka¸ak griffen immer wieder serbische Posten oder Einheiten an und raubten das Vieh der serbischen Bauern. Die Serben reagierten mit Vergeltungsmaßnahmen; Zerstörung von albanischen Häusern und Ermordung von tausenden Albanern. Im Mai 1919 riefen sie zu einem allgemeinen Aufstand gegen die serbische Herrschaft auf. Da aber die serbische Armee besser ausgerüstet war, wurde der Aufstand niedergeworfen. Im November des Jahres 1921 wurde von den Botschaftern der vier Großmächte Großbritannien, Italien, Frankreich und Japan der Bestand eines unabhängigen albanischen Staates bestätigt und die Grenzen endgültig festgelegt. Damit entging Albanien zwar der Aufteilung aber große Gebiete des albanischen Siedlungsgebietes gehörten nicht zum Staat Albanien, wie zum Beispiel das Kosovo oder der Nordwesten Mazedoniens, die nun endgültig Bestandteile Jugoslawiens wurden.
Die Kolonisierung des Kosovo:
Bereits 1914 hatte die serbische Regierung ein Gesetz erlassen, das slawische Kolonisten großzügige Bedingungen für die Niederlassung im Kosovo gewährte. Außerdem wurde konfisziertes Land zu günstigen Preisen zum Kauf angeboten. Trotzdem hatte die erste Kolonisierungswelle (1914) nur geringe Erfolge zu verbuchen. Die Motive für diese Vorgehensweise waren vielfältig, denn man wollte zum Beispiel ethnische Struktur zugunsten der slawischen Bevölkerung haben, oder um eine bessere Kontrolle über das Gebiet zu haben oder um der Abwanderung der Serben nach Amerika entgegenzuwirken. Die zweite Kolonisierungswelle (1918) setzte unmittelbar nach der Rückeroberung den Kosovo ein. Die Ländereien der vertriebenen Ka¸aks wurden konfisziert. Schließlich hatten alle Personen, die während der Balkankriege auf Seiten der Serben gekämpft oder Mitglieder vonetnik- Organisationen waren das Recht sich 5 ha von diesem Gebiet zu sichern. Von offizieller serbischer Seite wurden diese Maßnahmen verschleiert und als Agrarreform bezeichnet. Die slawischen Kolonisten wurden gegenüber der ansässigen albanischen sowie slawischen Bevölkerung bevorzugt. Sie erhielten durchschnittlich 7,2 na Land im Unterschied zur ansässigen Bevölkerung, die durchschnittlich nur 4,1 ha Land erhielt. Außerdem wurden die Kolonisten Eigentümer des Landes, hatten nach zehn Jahren das Verkaufsrecht, ersparten sich sämtliche Kosten für den Transport von Vieh oder Baumaterial und erhielten günstige Kredite bei neu gegründeten Landwirtschaftsgenossenschaften. Der Anteil der slawischen Bevölkerung steig zwischen 1919 und 1928 von 24 auf 38 Prozent an, doch mit dem Anfang der Dreißiger zogen viele Kolonisten wieder in ihre alte Heimat; Grund dafür waren die schlechte Infrastruktur, der Mangel an landwirtschaftlichen Geräten, die Inkompetenz und Korruption serbischer Behörden, gewalttätige Übergriffe auf die Kolonisten sowie die katastrophale medizinische Versorgung.
Enteignung, Umsiedlung und Vertreibung:
Von 1935 an verfolgte die Regierung in Belgrad ein umfangreiches Konfiskationsprogramm (Enteignung), dass die albanische Landbevölkerung zum Verlassen des Landes bewegen sollte, denn pro Person sollten den albanischen Bauern nur 0,4 ha Land gelassen werden; zum Überleben zu wenig. Zahlreiche Intellektuelle machten sich Gedanken, wie man die albanische Bevölkerung vertreiben konnte. So nahm 1938 die Aussiedlung der muslimischen Bevölkerung aus Jugoslawien Gestalt an, denn es wurde mit der türkischen Regierung ein Abkommen geschlossen, wonach 200.000 Albaner, Türken und Moslems aus dem Kosovo und aus Mazedonien in die Türkei umgesiedelt werden sollten. Für jede der circa 40.000 Familien war die Bezahlung von 500 Türkischen Pfund an die türkische Regierung festgelegt, doch die maroden Staatsfinanzen Jugoslawiens und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhinderten dies. Trotzdem hatten in dieser Zeit zwischen 90.000 und 150.000 Albaner das Kosovo verlassen.
Der Zweite Weltkrieg:
1939 musste Ahmet Zugo, der sich 1928 mit italienischer Hilfe selbst zum König der Albaner gekrönt hatte, die Annexion seines Landes durch das faschistische Italien tatenlos hinnehmen. Die Annäherung Zogus an Italien in den Zwanzigerjahren, wurde von einer immer stärker werdenden ökonomischen, militärischen und politischen Abhängigkeit von Italien begleitet. Diese Hinwendung zu Italien zog automatisch die Verschlechterung des Verhältnisses zu Jugoslawien nach sich. Das Ansuchen Albaniens um Aufnahme in die Kleine Entente, der neben Jugoslawien, Rumänien und die Tschechoslowakei angehörten, wurde aus diesem Grund abgewiesen. Durch die Weltwirtschaftskrise kamen viele südosteuropäische Staaten in die Abhängigkeit von Deutschland. Die Politik der Kleinen Entente wurde schließlich durch die Abtrennung der Tschechoslowakei zunichte gemacht. Ein fehlgeschlagener Angriff der Italiener auf Griechenland im Jahre 1940 führt zum Übergreifen des Krieges auf de Balkan. Die Versuch, eine diplomatische Lösung zu finden, scheiterten. Im März 1941 beschloss Hitler, Jugoslawien sowohl militärisch als auch als Staat zu zerschlagen. Am 6. April 1941 befahl er ohne Kriegserklärung den Angriff; innerhalb von zwei Wochen kapitulierte die Jugoslawische Armee. Der Vielvölkerstaat wurde in Teile zerlegt, wobei das Kalkül der Aufteilung der Absicht entsprach, die zahlreichen Spannungsherde in und um Jugoslawien auszunutzen. Im Mittelpunkt stand der Versuch, die ungarischen, bulgarischen, albanischen und kroatischen Bedürfnisse zufriedenzustellen und Loyalitäten zu schaffen, die eine Auflehnung gegen die Fremdherrschaft vereiteln sollten. Hitler setzte dabei neben seinen Bündnispartnern insbesondere auf jene Kräfte im Land, die sich von der vorangegangenen zentralistischen serbischen Politik betrogen fühlten. Darunter befanden sich auch die Albaner in Mazedonien und im Kosovo. Das eroberte Gebiet wurde in Besatzungszonen eingeteilt. Der größte Teil Kosovos, Westmazedoniens sowie Montenegros wurde zu einem Großalbanien, das unter italienischer Aufsicht stand, zusammen gefasst. Bulgarien, Ostserbien und Mazedonien übernahmen einen kleinen Streifen im Ostkosovo und der Norden des Kosovo kam unter deutsche Militärverwaltung. In der italienischen Besatzungszone wurden sämtliche Bewohner zu albanischen Staatsbürgern erklärt; es wurden albanischsprachige Schulen eröffnet, in den Ämtern stellte man albanische Beamte ein und es gab eine albanische Gendarmerie. Hitler versucht am Balkan so kräftesparend wie möglich zu agieren, damit er die militärische Aufmerksamkeit auf den Osten richten konnte. Hitler wollte aber auch Leute für sich gewinnen und so setzte er auf das Ustaëa-Regime, das radikal, antijugoslawisch, serbenfeindlich, antisemitisch und antikommunistisch war. So wurden hunderttausende Serben Opfer dieser von Hitler geführten Politik. Bald bildete sich ein serbischer Widerstand unter Draûan Mihailoviº, dem Anführer der etniks, der traditionellen Freischärlerverbände; diese strebten ein Großserbisches Reich, das Kosovo und Mazedonien beinhalten sollte, an.
Zu den Feinden der etniks, gegen die sie mit größter Brutalität vorgingen, gehörten in erster Linie die kroatische und muslimische Bevölkerung Bosnien-Herzegonwinas. Ein gesamtjugoslawisches Programm verfolgten einzig die Kommunisten unter der Führung Titos, die offensiv und konsequent gegen die Besatzungsmächte vorgingen und die Bevölkerung zum Widerstand zu mobilisieren versuchten. Ihre Vorstellung war es ein multinationales Jugoslawien zu erschaffen und sie verstanden es auch, für dieses Vorhaben große Teile der Bevölkerung zu gewinnen, indem sie den Grundsatz der nationalen Gleichberechtigung betonten. Es wurde grausam gegen die Besatzer vorgegangen, aber auch diese standen in den Vergeltungsakten den sog. Partisanen in nichts nach. Ganz andere Auswirkungen hatte die Besatzung auf die albanische Bevölkerung im Kosovo und in Mazedonien. Die Umkehrung der Machtverhältnisse führte umgehend zu Racheakten von Albanern an den serbischen Kolonisten; es gab viele Tote. Im Jänner 1944 wurde eine Resolution verabschiedet, die ein Recht auf die Selbstbestimmung der Völker beinhaltete. Die Deutschen versuchten dagegen mit Hilfe der Roten Armee noch etwas dagegen auszurichten, aber sie wurden schließlich von den vorrückenden bulgarischen und sowjetischen Truppen zum Abzug gezwungen.
Kosovo unter Tito:
Serbien war die einzige Republik, die im Rahmen der Neugestaltung des jugoslawischen Bundesstaates zwei autonome Regionen (Kosovo- Metohija; Vojvodina) enthielt. Die anderen Republiken waren Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Mazedonien. Die Grenzziehung orientierte sich im wesentlichen an den Verhältnissen vor den Balkankriegen. Hinter dieser Neuordnung verbarg sich die Absicht Titos, zwischen den Serben und den anderen Nationen des Landes ein Gleichgewicht herzustellen. Für die Serben jedoch bedeutete dies eine Schwächung im Vergleich zu ihrer Stellung in der Zwischenkriegszeit, da sie nun einerseits große Bevölkerungsgruppen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina stellten und andererseits in der autonomen Region Kosovo eine mehrheitlich albanische Bevölkerung und in der Vojvodina eine starke ungarische und kroatische Minderheit hatten. Die Einverleibung Albaniens in eine von Jugoslawien dominierte Balkanföderation war ein weiteres Motiv für die Lösung; den Albanern wurden zu dieser Zeit große Zusicherungen im Bildungs-, Wirtschafts- und Verwaltungsbereich gemacht. In Moskau stieß man damit aber auf wenig Gegenliebe, denn Stalin sah darin eine Machtkonzentration. Die Auseinandersetzung zwischen Stalin und Tito mündete in den Ausschluss Jugoslawiens aus der KOMINFORM im Jahr 1948. In weiterer Folge führte das zum Bruch zwischen Belgrad und Tirana. Das Ende der Förderungspläne und die Abwendung Albaniens von Jugoslawien seit 1948 hatten drastische Auswirkungen auf die Lage der Albaner im Kosovo, denn plötzlich wurden sie zu einem gefährlicher Fremdkörper innerhalb der südslawischen Föderation. Die Geheimpolizei überwachte dieses Gebiet verstärkt; es kam zu willkürlichen Verhaftungen, Verfolgungen und Mißhandlungen. Grund für das harte Durchgreifen der Geheimpolizei war, dass sie zu 58% aus Serben bestand - jedoch nur 13% Albanern. Beschränkungen der Religionsfreiheit führten zu einer weiteren Entfremdung der muslimischen Bevölkerung; Koranschulen wurden verboten.
Verfassungsreformen:
Die jugoslawische Verfassung von 1963 brachte dem Kosovo formell eine Besserstellung, indem sie die Autonome Region in eine Autonome Provinz umgewandelt wurde; dies führte zu einer stärkeren Abhängigkeit von der Republik Serbien, wodurch sich die Möglichkeit der politischen Teilnahme auf Föderationsebene verringerte. Als Zugeständnis an Serbien wurden den Republiken größere Befugnisse eingeräumt, besonders hinsichtlich ihrer Politik gegenüber den autonomen Provinzen. 1968 wurde in der Verfassung nachträglich eine stärkere Anbindung an die Föderation festgelegt. Die Kosovo-Albaner reagierten darauf mit Aufbruchsstimmung, denn es schien jetzt die Zeit gekommen, die lange vorenthaltenen Grundrechte einzufordern und offensiv für politische, soziale und ökonomische Reformen einzutreten. Erklärtes Ziel war die Erlangung des Republikstatus. 1974 erhielten die beiden autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo durch die neue Verfassung einen fast gleichwertigen Status wie die übrigen sechs jugoslawischen Teilrepubliken. Das Mitbestimmungsrecht innerhalb der Föderation wurde massiv ausgebaut und sie bekamen eine eigene Verfassung. Die Gründe, warum man es vermied, die Provinzen zu Republiken zu erheben, lagen darin, dass man einer weitergehenden Verselbstständigung und im Falle Kosovos einer stärkeren Annäherung an Albanien keinen Vorschub leisten wollte. Andererseits wollte man serbische Interessen nicht zu sehr entgegenwirken. In Serbien war man davon überzeugt, dass Tito bewußt gegen die serbische Volksgruppe Politik betrieb. Die slawische Bevölkerung stand diesem Prozess mit großer Skepsis und Verunsicherung gegenüber. Der Aufschwung der Albaner wurde vielerorts als Demütigung der Serben empfunden. Entscheidend für die Weiterentwicklung der Verhältnisse der Kosovo-Albaner zum jugoslawischen Staat war jedoch die Tatsache, dass der Versuch einer stärkeren Integration des Kosovo in Jugoslawien nicht von einer Intensivierung des Dialoges zwischen Serben und Albanern begleitet war.
Die demographische Entwicklung und Migration:
Das rasante Bevölkerungswachstum der albanischen Volksgruppe sowie die kontinuierliche Abwanderung slawischer Bevölkerung aus dem Kosovo wurden von serbischen Politkern, den Medien und Wissenschaftlern propagandistisch dazu genutzt, antialbansiche Ressentiments zu schüren. Es ist statistisch belegt, dass die Bevölkerung im Kosovo wirklich unverhältnismäßig stark im Vergleich zum restlichen Jugoslawien angestiegen ist.
Die kontinuierliche Abwanderung slawischer Bevölkerung aus dem Kosovo war ein weiterer sensibler Streitpunkt in der serbisch-albanischen Auseinandersetzung. Je nach Autoren wurden verschiedene Gründe für dieses Phänomen angegeben; die Autoren auf Seiten der Albaner betonten die schwierige ökonomische Situation, währenddessen die Autoren auf Seiten der Serben die Politik der Ausgrenzung anprangerten. Die offiziellen Zahlen machen die Abwanderung deutlich sichtbar. Betrachtet man diesen Trend objektiv, kommt man zum Schluss, dass neben den schwierigen ökonomischen Verhältnissen auch kulturelle und politische Motive den Wechsel des Wohnsitzes auslösen konnten. In ganz Jugoslawien lässt sich eine Abwanderung aus ländliche Gebieten in die urbanen Zentren nachweisen. Im Kosovo waren die unvorteilhaften Bedingungen im Bildungswesen, die schlechten Wohnverhältnisse und politische und soziale Diskriminierungen weitere wichtige Triebfedern für einen Ortswechsel. Im Verlauf der achtziger Jahre verwendeten die Serben das Motiv der Vertreibung; im medialen und politischen Propagandafeldzug gegen die Albaner wurde das Thema der Vergewaltigung serbischer Frauen und Mädchen, bestohlener und verprügelter serbischer Bauern und der Schändungen serbischer Heiligtümer breitgetreten. Dahinter würde einzig die Absicht der Albaner stehen, die Serben aus “ihrem heiligen Land“ zu vertreiben. Dieses Vorurteil wurde so lange wiederholt, bis es zu einem Standardvorurteil wurde und schließlich die Anwendung von Gewalt zur Wiederherstellung einer “gerechten Ordnung“ legitimierte.
Der Triumph des Nationalismus:
Am 4. Mai 1980 wurde der Welt mitgeteilt, dass Tito gestorben war. In ganz Jugoslawien breiteten sich Betroffenheit und Verunsicherung aus. die politische Führung wurde einem Kollektiv übertragen, dass sich aus den acht Vertretern der Republiken und Autonomen Provinzen zusammensetzte, die auf der Grundlage eines Rotationssystems abwechselnd die Regierungsgeschäfte führten. Für die Albaner im Kosovo hatte Tito den Status eines Protektors gehabt, dem sie das Ende der serbischen Unterdrückung und die Anerkennung politischer Grundrechte verdankten.
Tristen Aussichten für junge Akademiker die Auslöser für die heftigen Studentenproteste, die im Frühjahr 1981 ausbrachen. Die Demonstrationen breiteten sich schnell aus und wurden zu einer allgemeinen Manifestation der Unzufriedenheit mit der politischen Führung. Die Behörden schlugen die Aufstände gewaltsam nieder; es gab zahlreiche Tote. Belgrad beschuldigte Tirana an diesen Unruhen als Drahtzieher beteiligt gewesen zu sein. Im Februar des Jahres 1986 zog eine kleine Gruppe von etwa hundert Serben aus Kosovo nach Belgrad, um sich bei der politischen Führung Serbiens und Jugoslawiens über die fortdauernde „Diskriminierung“ und die schwierigen Lebensbedingungen zu beklagen; dieser Marsch nach Belgrad war der erste von vielen. In weiterer folge übernahmen die Medien eine wichtige Rolle, denn von ihnen ging eine „Kriminalisierung“ der Albaner aus; Alberner wurden beschuldigt systematisch gegen die Serben vorzugehen und serbische Frauen zu vergewaltigen.
Miloëevis Machtaufstieg:
Im April 1987 begann der Machtaufstieg Miloëeviº, als er in das Kosovo reiste. Als er dort eintraf, rief er die Menge auf, sich ihrer Herkunft zu besinnen. Mit seiner kurzen, aber sehr wirksamen Rede löste er in Serbien eine Welle der Begeisterung und der Zustimmung aus, die seine politische Laufbahn stark beeinflusst hat. Miloëeviº stieg zu einer nationalen Symbolfigur auf und stand im Jahre 1987 an der Spitze des Bundes der Kommunistischen Serben. Auf seinen Kundgebungen in Serbien und Montenegro mobilisierte er die Massen für die Wiederherstellung der Kontrolle über die verlorengegangenen Autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina. Ende 1987 wurde das kosovarische Parteikomitee gesäubert und im Oktober 1987 wurde die Polizei- und Justizgewalt der Provinz aufgehoben und durch Einheiten der Bundespolizei sowie Vertreter der Bundesjustiz ersetzt. Der Sommer 1988 war von Demonstrationen für die Unterwerfung der beiden autonomen Provinzen geprägt. 1988 wurde die kosovarische Parteiführung abgesetzt; als Reaktion darauf, protestierten die Minenarbeiter, Schüler, Studenten und Fabriksarbeiter - es wurde die Beibehaltung der Verfassung von 1974 gefordert. Anfang 1989 erhielt Serbien wieder die direkte Kontrolle über die Sicherheit und das Rechtswesen im Kosovo zugesprochen. Albanisch wurde als Amtssprache verboten - es kam zu Streiks. Im März 1989 wurde unter unkorrekter Auszählung der Stimmen der Abgeordneten die Autonomie aufgehoben, worauf die Albaner gewaltsam reagierten. Auf die Demonstrationen folgte eine Welle von Verhaftungen und Folterungen. Am 28.Juni 1989 wurde mit großem Aufwand und unter reger Beteiligung der Bevölkerung die 600-Jahr-Feier der Schlacht auf dem Amselfeld begangen. Die Veranstaltung wurde zu einer Kundgebung für den jüngst wiedererlangten „Ruhm und Machtanspruch Serbiens“ in der Region. Die Proteste der Albaner gegen die Beschneidung der Autonomie wurden mit Gewalt niedergeschlagen. 1989 gründeten albanische Intellektuelle eine eigene Partei, die Demokratische Liga des Kosovo LDK, deren Bemühungen aber erfolglos bliebe. Nun setzte die sogenannte “Serbisierung“ ein; albanische Ärzte und albanisches Pflegepersonal wurde entlassen; die lokalen Rundfunk- und Fernsehsender von serbischen Anstalten übernommen; albanische Lehrbücher wurden verboten. Ende September 1991 wird in einem inoffiziellen Referendum die Souveränität und Unabhängigkeit des „Staates Kosova“ beschlossen. Albanien war der erste Staat, der die Republik Kosovo anerkannte, doch als der Krieg in Slowenien ausbrach und aufgrund dessen viele wehrpflichtige Kosovo- Albaner nach Albanien flohen, währte die Freude über deren Ankunft nur kurz, denn sehr bald kursierten die schlimmsten Vorurteil über die „Kosovaren“, die für die einsetzende Kriminalität, die Prostitution und Korruption und andere Mißstände verantwortlich gemacht wurden. Im Mai 1992 wurden Parlamentswahlen im Kosovo abgehalten, bei denen die LDK als klarer Sieger hervorging. Ein Ziel der LDK war die Internationalisierung der Kosovofrage; aus diesem Grund bereisten ihre Vertreter viele Hauptstädte der westlichen Welt. Während die Behörden in Belgrad versuchten, slawische Flüchtlinge im Kosovo anzusiedeln, kam es aus dem Kosovo zu einer massive Abwanderung der albanischen Bevölkerung, vor allem in westliche Staaten. 1995 kam es zum Abschluss des Friedensabkommens von Dayton, das die zukünftige Ordnung in Bosnien und Herzegowina wiederherstellen sollte. Die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie der UNO, der OSZE sowie der Weltbank würden erst dann folgen, wenn Belgrad konkrete Schritte zur Wiederherstellung der Autonomie im Kosovo unternimmt. Zu den Friedensverhandlungen wurde kein Vertreter der Kosovo- Albaner eingeladen. Auch die zahlreichen Berichte über Menschenrechtsverletzungen wurden zwar international verurteilt, hatten aber keinen entscheidenden Einfluss auf die Politik des Westens gegenüber Jugoslawien. Seit dem Abzug der OSZE-Beobachtermission 1993 nahmen die Menschenrechtsverletzungen in der Provinz wieder massiv zu. Die vollständige Anerkennung Jugoslawiens durch mehrere EU-Staaten im April 1996 brachte die moderate politische Führung der Kosovo-Albaner noch stärker in Bedrängnis. Am 12.Dezember 1996 reagierte die UNO auf die fortdauernden Menschenrechtsverletzungen mit einer Resolution.
Der Beginn des bewaffneten Widerstandes:
Im Februar 1996 erfolgten gleichzeitig in mehreren Städten der Provinz Bombenanschläge auf serbische Flüchtlingscamps; die Untergrundorganisation, die Nationale Bewegung zur Befreiung des Kosovo, übernahm dafür die Verantwortung. Eine zweite Gruppe machte zur gleichen Zeit durch Bombenanschläge sowie durch die Anwerbung von Rekruten auf sich aufmerksam, die Kosovo-Albanische Befreiungsarmee - die -. Der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung in Albanien im Frühjahr 1997 nach dem Kollaps krimineller Geldanlageinstitute begleiteten Plünderungen von Waffendepots der Armee des ehemals kommunistischen Landes. Der Transfer eines Teiles dieses Waffenarsenals über die schwer kontrollierbare Nordgrenze in das Kosovo trug wesentlich zur militärischen Stärkung der - bei. Seit 1997 unterhielt die - auch militärische Ausbildungslager im gebirgigen und schwer zugänglichen Norden Albaniens. Am 28. November traten erstmals drei - Kämpfer an die Öffentlichkeit und verkündeten, dass die - die einzige Kraft sei, die für Befreiung und nationalen Einigung des Kosovos kämpfe. In dieser Zeit begann sie wichtige Straßenverbindungen und Teile der Provinz zumindest während der Nacht unter ihre Kontrolle zu bringen. Erstmals seit Jahren konnten sich die Kosovo-Albaner wieder erfolgreich gegen die Serben zur Wehr setzten. Diese Befreiungsarmee verzeichnete einen regen Zulauf und wurde zum wichtigsten Hoffnungsträger für viele Kosovo-Albaner. Das Auftreten der - und die damit einhergehende Häufung bewaffneter Zwischenfälle nährten die Angst vor einer Eskalation der Gewalt und riefen schließlich die Internationale Gemeinschaft auf den Plan, die sich zu einem entschlossenen Vorgehen in der Kosovofrage gezwungen sah. Was jahrelanger friedlicher Protest und ziviler Ungehorsam nicht bewirken konnten, wurde mit Gewalt in wenigen Monaten erreicht.
Die wichtigsten Ereignisse der Jahre 1998 - 1999 kurz zusammengefasst:
-
Am 23. April 1998 wurde in Serbien ein Referendum über die „Mitwirkung ausländischer Vertreter an der Lösung der Probleme im Kosovo und Metohija“ abgehalten. 94,7% sprachen sich gegen eine internationale Einmischung aus.
-
6. Juli 1998: Es wurde der Beschluss zum Aufbau der KDOM (Diplomatischen Beobachtermission für das Kosovo) gefasst; die KDOM besteht aus den 3 Komponenten EU, USA und Rußland. Das Ziel der Mission war die durchgehende Beobachtung und Dokumentation der Ereignisse in der Provinz.
-
6. Feber 1999: Eröffnung der Konferenz von Rambouillet; Ziel: die Provinz Kosovo würde vorübergehend zu einem Protektorat werden. Das Resümee: die Konferenz von Rambouillet brachte konkrete Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Autonomie-Abkommen für das Kosovo. Ein Vertragsabschluss konnte aber nicht erreicht werden. Somit endeten die Verhandlungen am 23. Feber 1999 erfolglos.
-
15. März 1999: Weiterführung der Verhandlung in Paris: Die unterbrochenen Verhandlungen mit den Delegationen der Serben/Jugoslawen und den Kosovo-Albanern wurden wieder aufgenommen. Am 19. März 1999 wurde bekannt gegeben, dass die Verhandlungen von Rambouillet und Paris aufgrund der Haltung der serbisch-jugoslawischen Delegation ausgesetzt würden. Noch am selben Tag begann der Abzug der OSZE-Beobachter aus der Provinz.
-
24. März 1999: als letzter der Rambouillet-Verhandler verließ der Österreicher Dr. Wolfgang Petritsch Belgrad. Noch am selben Tag fielen die ersten NATO-Bomben. Nach Ende des Bombardements unterzeichneten die NATO und die Bundesrepublik Jugoslawien bzw. die Republik Serbien am 9. Juni 1999 ein „militärisch-technisches Abkommen“ in welchem neben dem geordneten und verifizierbaren Rückzug der serbischen Truppen aus dem Kosovo insbesondere die Stationierung der NATO-geführten Friedenstruppe KFOR (Kosovo-Force) vereinbart wurde. Am 10. Juni 1999 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1244 in der die Grundsätze der Friedensimplementierungsmission im Kosovo festgelegt wurden. Laut Punkt 10 der Resolution 1244 wird der Generalsekretär vom Sicherheitsrat ermächtigt mir Hilfe von relevanten internationalen Organisationen eine internationale zivile Präsenz im Kosovo einzurichten um eine vorübergehende Verwaltung (United Nations Interim Administration Mission im Kosovo = UNMIK) für den Kosovo zu gewährleisten. Das kosovarische Volk sollte dadurch substanzielle Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien genießen und unter friedlichen und normalen Lebensbedingungen leben können. Darüber hinaus soll die Basis für die Entwicklung von provisorischen, demokratischen und selbstregierenden Institutionen geschaffen werden.