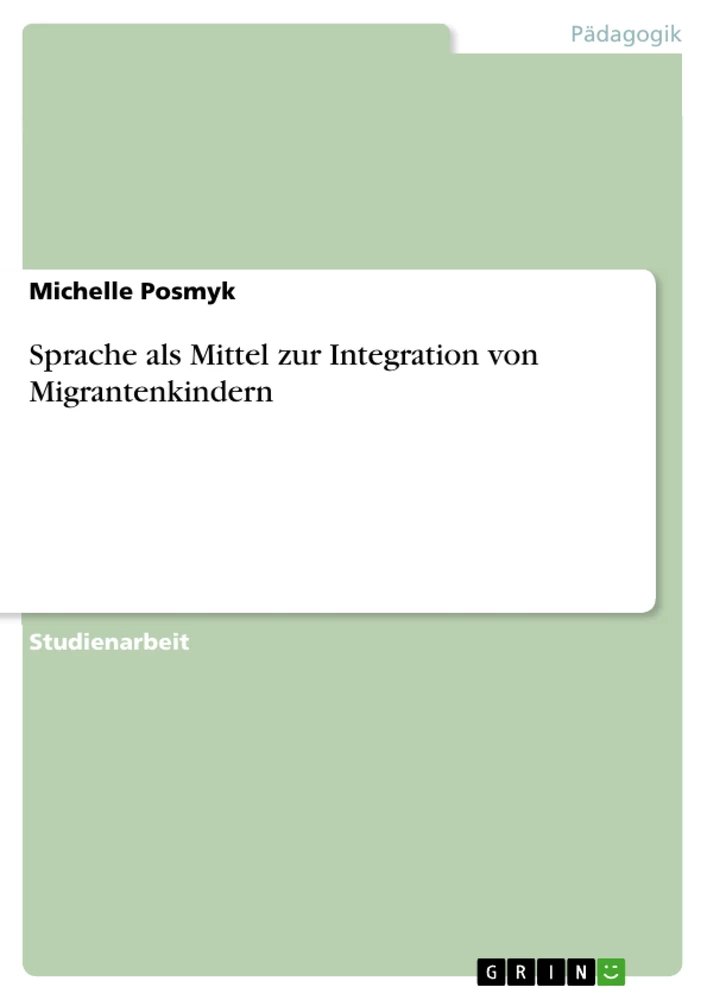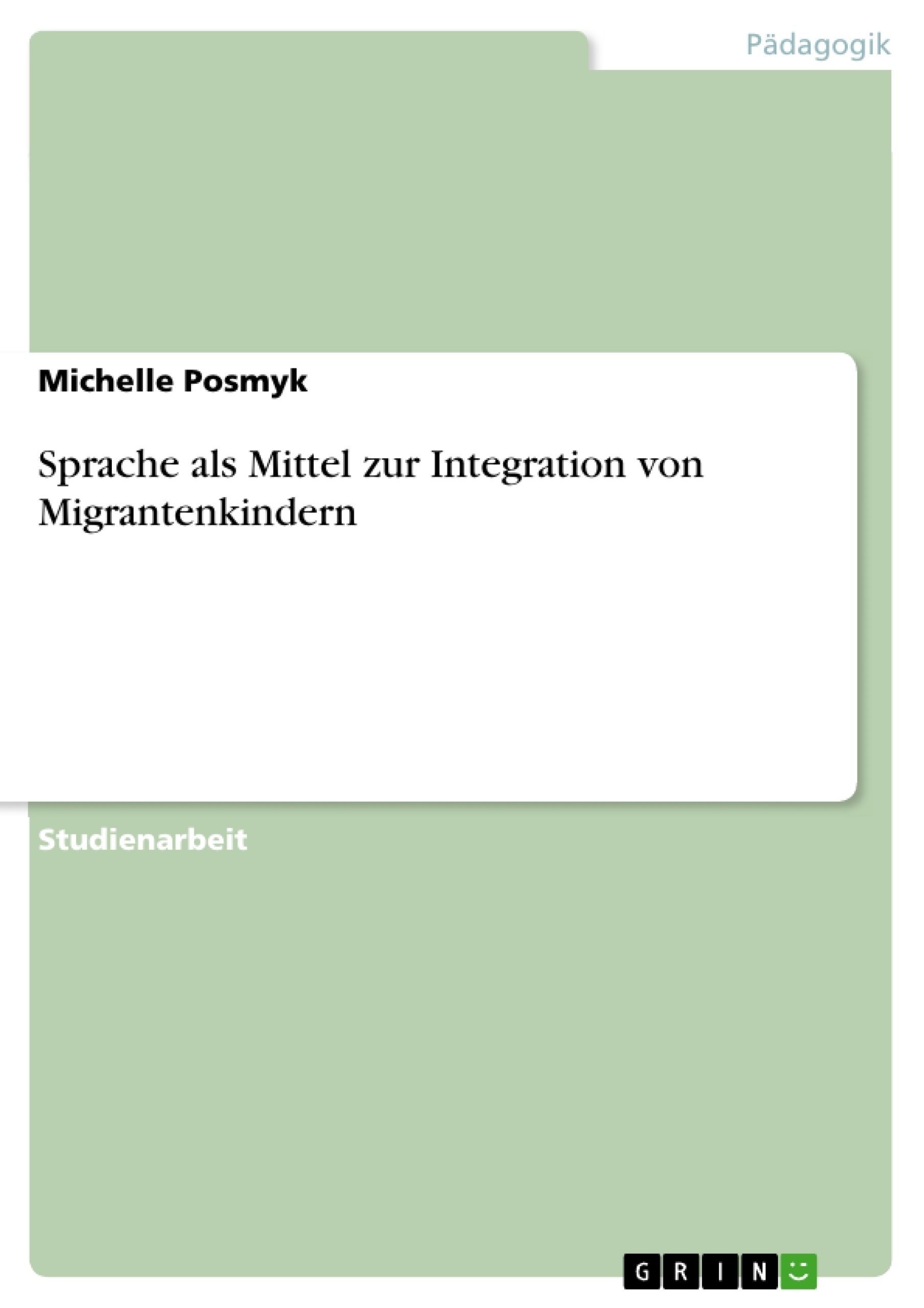Mit dem Anstieg der ausländischen Bevölkerung stellt sich gleichzeitig auch die Frage nach sozialen und bildungsorientierten Maßnahmen zur erfolgreichen Integration der zugewanderten Menschen. In der Arbeit soll dieser Frage nachgegangen werden. Der Fokus wird dabei auf Kinder mit Migrationshintergrund gelegt. Im Jahr 2018 setzte dich die Verteilung der Bevölkerung in Deutschland aus über einem Viertel an Menschen mit Migrationshintergrund zusammen, weshalb die Relevanz des Themas aufgrund der beträchtlichen Anteile sehr hoch gestuft werden kann.
In den folgenden Ausführungen wird überwiegend auf sprachgestützte Integrationsmaßnahmen verwiesen. Der hohe Stellenwert der Sprache für die zwischenmenschliche Kommunikation soll in den Vordergrund gebracht und anhand von theoretischen Ansätzen und beispielhaften Erfahrungsberichten zu bereits bewährten Maßnahmen belegt werden. Diese Deutung erfolgt nicht tiefergehend auf linguistischer Ebene, sondern in Bezug auf soziale Strukturen und Verhältnisse, in denen Migrantenkinder aufwachsen. Dabei soll mit dieser Arbeit die Frage beantwortet werden, welche Rolle die Sprache für die Integration von Migrantenkindern in die Gesellschaft spielt.
Dafür wird zuerst ein Überblick über die Migrationssituation in Deutschland präsentiert und der Migrationsbegriff definiert. Es wird zudem auf die Diskriminierung von Migrantenkindern im deutschen Schulsystem eingegangen und anschließend auf Möglichkeiten sozialer Integration durch Sprache und Bildung verwiesen. Im nächsten Kapitel folgen Ausführungen zum Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern, es wird auf pädagogischer und sozialer Ebene auf den Erwerb der Zweitsprache Deutsch und auf mögliche Probleme des zweisprachigen Aufwachsens eingegangen. Im letzten Kapitel wird die Bedeutung der Sprachförderung als Integrationsmaßnahme in den Vordergrund gebracht, auf damit verbundene Schwierigkeiten kritisch eingegangen und Möglichkeiten schulischer und sozialer Förderung aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Migrationsbegriff in Deutschland
- Diskriminierung von Migrantenkindern im deutschen Schulsystem
- Soziale Integration durch Sprache und Bildung
- Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern
- Erwerb der Zweitsprache Deutsch und damit zusammenhängende Altersunterschiede
- Probleme des zweisprachigen Aufwachsens im Bildungskontext
- Sprachförderung als Integrationsmaßnahme
- Didaktische Schwierigkeiten
- Schulische und soziale Förderungsmaßnahmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Sprache als Mittel zur Integration von Migrantenkindern in das deutsche Schulsystem. Sie analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten des Zweitspracherwerbs im Kontext der Bildungslandschaft und beleuchtet die Rolle der Sprachförderung als Integrationsmaßnahme.
- Diskriminierung von Migrantenkindern im deutschen Schulsystem
- Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern
- Sprachförderung als Integrationsmaßnahme
- Didaktische Schwierigkeiten bei der Sprachförderung
- Schulische und soziale Förderungsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Begriff der Migration in Deutschland und untersucht die Herausforderungen, denen Migrantenkinder im deutschen Schulsystem gegenüberstehen. Hierbei wird insbesondere auf die Diskriminierung und die Bedeutung von Sprache und Bildung für die soziale Integration eingegangen.
Im zweiten Kapitel wird der Zweitspracherwerb bei Migrantenkindern im Detail betrachtet. Es werden sowohl die Besonderheiten des Erwerbs der deutschen Sprache als auch die damit verbundenen Herausforderungen im Bildungskontext behandelt. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen des Alters auf den Spracherwerb und den Schwierigkeiten, die aus dem zweisprachigen Aufwachsen resultieren können.
Das dritte Kapitel behandelt die Sprachförderung als Integrationsmaßnahme. Es werden didaktische Schwierigkeiten der Sprachförderung beleuchtet und verschiedene schulische und soziale Förderungsmaßnahmen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Migration, Migrantenkind, Integration, Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, Sprachförderung, Bildung, Schule, Diskriminierung, Inklusion, Didaktik, Schulische und soziale Förderungsmaßnahmen.
- Quote paper
- Michelle Posmyk (Author), 2020, Sprache als Mittel zur Integration von Migrantenkindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/968100