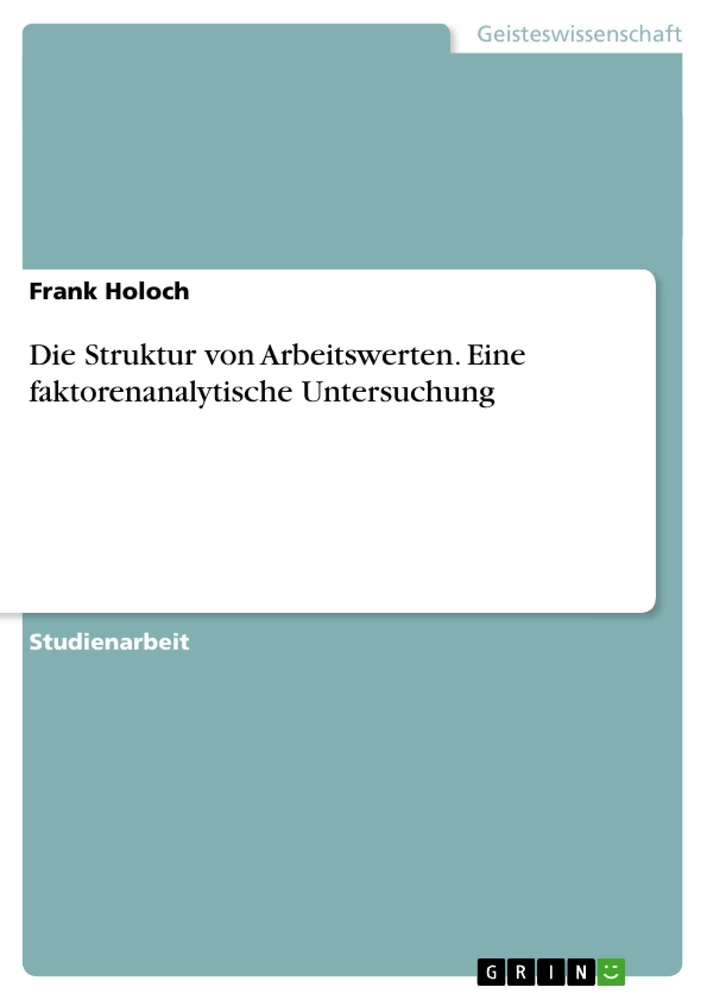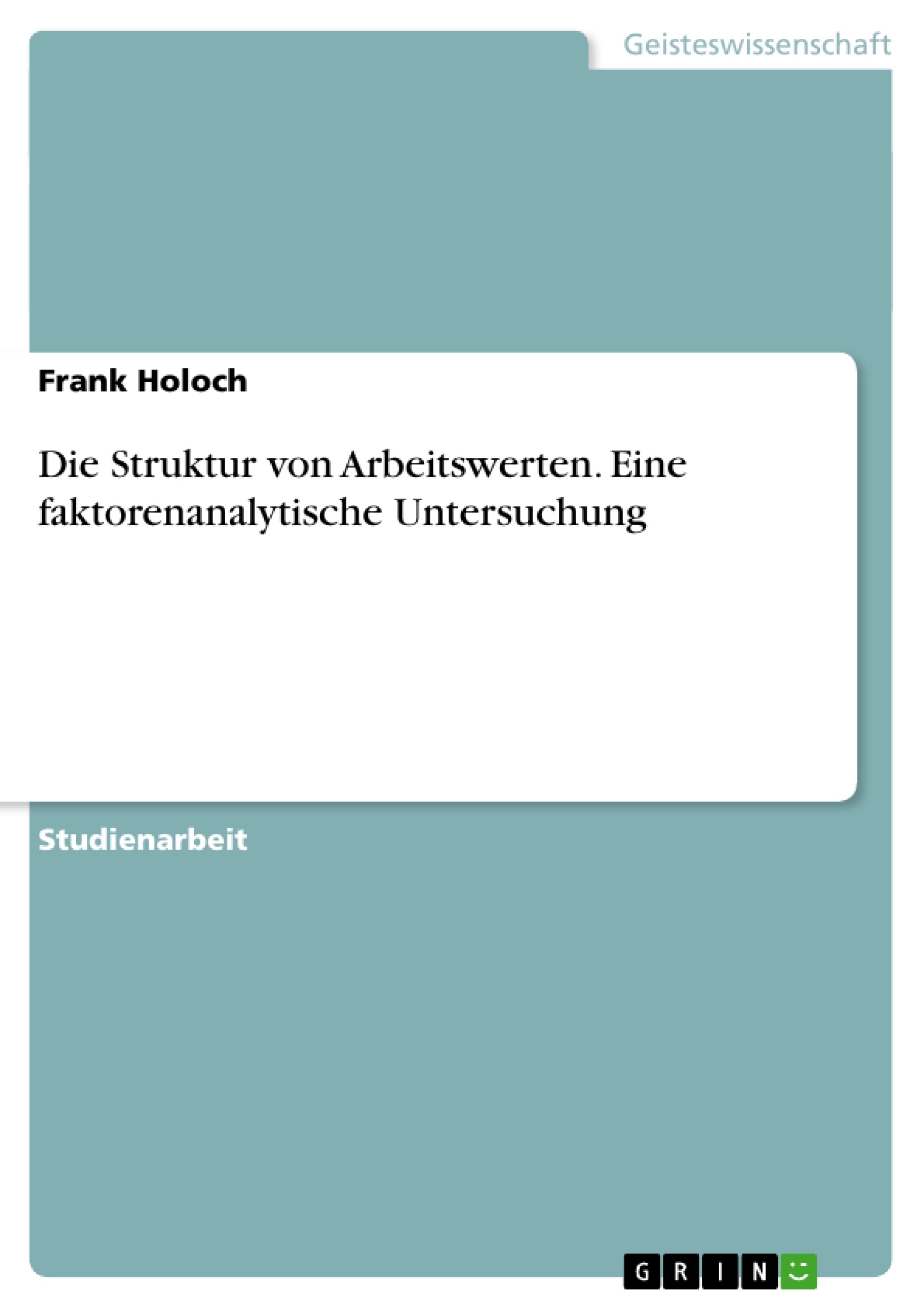INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
1 ARBEITSWERTE
2 ANSÄTZE ZUR STRUKTURIERUNG VON ARBEITSWERTEN
2.1 ELIZUR
2.2 SCHMIDT
2.3 ALDERFER
3 DATENBASIS
4 FAKTORENANALYSE
4.1 ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DEN VARIABLEN
4.2 EXTRAKTION DER FAKTOREN
4.3 KOMMUNALITÄTEN
4.4 FAKTOREXTRAKTIONSVERFAHREN
4.5 ZAHL DER ZU EXTRAHIERENDEN FAKTOREN
4.6 FAKTORINTERPRETATION
5 ERGEBNISSE
6 AUSBLICK
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle10
Tabelle1
Tabelle
Einleitung
Das Thema der Arbeitszufriedenheit und den damit verbundenen Arbeitswerten wird im Bereich der Psychologie häufig bearbeitet. Zum Einen wird diskutiert, was überhaupt als Arbeitswert bezeichnet werden soll, zum anderen wird überlegt, ob Arbeitswerte bestimmten Kategorien zugeordnet werden können. Es gibt zahlreiche Untersuchungen zur Klassifikation von Arbeitswerten.
In dieser Arbeit werden drei der wichtigsten Ansätze skizziert. Sie unterscheiden sich in ihren theoretischen Zugängen und ordnen zum Teil gleiche Arbeitswerte verschiedenen Kategorien zu. Zur empirischen Überprüfung werden verschiedene Analyseverfahren verwendet. Das verwendete Datenmaterial ist alt. Ein Teil der Studien bezieht sich auf bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Studenten oder auf einen bestimmten Kulturkreis wie z.B. die Studie von Elizur mit Israelis.
Die Ansätze werden dahingehend analysiert, ob eine Faktorenanalyse mit dem Statistikprogramm SPSS bei einem repräsentativen Datensatz, bezogen auf die BR Deutschland in den 90er Jahren zu den gleichen Ergebnissen führt, wie in den verschiedenen Ansätzen. Die E.R.G. - Theorie von Alderfer bildet den Schwerpunkt.
1 Arbeitswerte
Der Begriff Wert ist nicht eindeutig definiert. Es gibt zahlreiche Definitionen, de- ren wesentliche Elemente gleich sind.1 Grundsätzlich kann ein Wert als „a disposition of a person just like an attitude, but more basic as an atti- tude, often underlying it ... a type of belief ... about how one ought or ought not to behave, or about some end-state of existence worth or not worth attaining“.2
Entsprechend sind Arbeitswerte „general attitudes regarding the meaning that an individiual attaches to his work role.“3 Arbeitswerte beziehen sich auf die allge- meine, grundsätzliche Einstellung eines Individuums zur Arbeit. Davon abzugren- zen ist die Arbeitszufriedenheit. Sie bezieht sich auf die jeweilige besondere Ar- beit.4
Arbeitswerte wie hohes Einkommen oder die Bedeutung einer sicheren Berufs- stellung sind voneinander nicht unabhängig. Sie scheinen Ausdruck einer überge- ordneten, latenten Variable zu ein. Es gibt eine Vielzahl von theoretischen Über- legungen, die versuchen, diese Faktoren zu bestimmen. Die verschiedenen Auto- ren haben unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema. In den einzelnen Ansätzen wird von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen. Elizur geht von dem Arbeitsergebnis, Schmidt von Arbeitsorientierungen und Alderfer geht von Be- dürfnissen aus (s.u.).
Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, daß trotz der unterschiedlichen Zugänge eine überraschende Übereinstimmung bei den Faktoren und der Zuordnung von Items zu den Faktoren bestehen. Die verwendeten Items und die zugehörigen Faktoren sind nahezu deckungsgleich.
2 Ansätze zur Strukturierung von Arbeitswerten
2.1 Elizur
Elizur erstellt ein grundlegendes Konzept für die Struktur von Arbeitswerten. Seine Untersuchung zielt darauf ab, die essentiellen Bestandteile von Arbeitswerten zu ermitteln. Anhand wissenschaftlicher Literatur erstellt er eine Liste mit Arbeitswerten.5 Seine These ist, daß die einzelnen Arbeitswerte drei Faktoren repräsentieren. Elizurs Ziel war die Untersuchung der Struktur von Arbeitswerten und die Überprüfung der latenten Variablen. Ihm geht es um die empirische Überprüfung der Zuordnung von Item zu Faktor.6
Ein Bestandteil seiner Theorie ist der „Modality of Outcome“. Er umfaßt drei Faktoren, den instrumentellen, den affektiven und den kognitiven.7 Unter den instrumentellen Faktor fallen alle Arbeitswerte, die von konkretem und praktischem Nutzen sind, wie z.B. die Bezahlung. Der affektive Faktor umfaßt al- le Arbeitswerte, die sich auf soziale Beziehungen beziehen, wie z.B. der Kontakt zu Kollegen. Verantwortung oder Unabhängigkeit stehen für Items, die die psy- chologischen und kognitiven Aspekte der Befragten ansprechen.8 Ø Zu den instrumentellen Arbeitswerten zählen: Bezahlung, Arbeitszeit, Sicherheit, Arbeitsbedingungen Ø Zu den affektiven Arbeitswerten zählen:
Mitarbeiter, Anerkennung für gute Arbeit, Achtung als Person Ø Zu den kognitiven Arbeitswerten zählen:
Weiterbildung, Aufstiegsmöglichkeiten, interessante Tätigkeit, Status, Stolz auf Firma, Verantwortung, Unabhängigkeit, Einflußmöglichkeit, Möglichkeit des Einsatzes von Fähigkeiten, sinnvolle Tätigkeit, Beitrag zur Gesellschaft In Elizurs Studie konnten die Items fehlerfrei den entsprechenden Faktoren zuge- ordnet werden. Es wurde das Statistikprogramm SSA verwendet.9 Die Zuordnung ist allerdings graphischer Natur. Eine statistische Überprüfung wurde nicht durch- geführt.10
Aufbauend auf Elizur setzte Borg die israelische Studie von Elizur in Deutschland fort. Als Datenbasis verwendete er den Allbus - Datensatz von 1980 und 1982.11 Für die Datenanalyse wurde das gleiche Statistikprogramm verwendet. Borg erzielt damit die gleichen Ergebnisse wie Elizur.12 Ein Unterschied bei der Zuordnung der Items sind die Arbeitswerte „sozial nützlicher Beruf“ und „anerkannter Beruf“. Borg ordnet diese nicht dem kognitiven, sondern dem affektiven Bereich zu. Dies ist m.E. sinnvoll, da beide Items auf die Gesellschaft bezogen sind. Alderfer (s.u.) trifft eine ähnliche Zuordnung
2.2 Schmidt
Ein anderer Zugang zum Thema Arbeitswerte findet sich bei Schmidt. Seine Un- tersuchung baut auf Rosenberg auf. Er geht davon aus, daß die Zusammenhänge der einzelnen Items durch drei Konstrukte erklärt werden können. Jedes Item kann entweder einem intrinsischen, extrinsischen oder sozialem Faktor zugeordnet werden.13
- Zum extrinsischen Konstrukt gehören Sicherheit. Einkommen, Aufstiegsmög- lichkeiten, anerkannter Beruf und Freizeit.
- Das intrinsische Konstrukt umfaßt eine interessante Tätigkeit, Selbständigkeit und Verantwortung,
- Und das soziale Konstrukte besteht aus den Items menschlicher Kontakt, sinnvoll empfundener Beruf und anderen Helfen.
2.3 Alderfer
Der dritte eigenständige Ansatz ist gleichzeitig der Fruchtbarste. In der E.R.G. Theorie geht Alderfers von drei grundlegenden Arten von Bedürfnissen aus, die in jedem Menschen vorhanden sind.14 Jeder Arbeitswert dient der Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses.
„Alderfer unterscheidet zwischen materiellen (existence, E), sozialen (relatedness, R) und Wachstums - Bedürfnissen (growth, G). Entsprechend kann man Arbeitswerte klassifizieren in solche, die vor allem für die Befriedigung von E- , R- oder G- Bedürfnissen relevant sind.“15
Ähnlich wie bei Elizur haben die materiellen Bedürfnissen einen konkreten und praktischen Nutzen.
„Existence needs reflect a person’s requirement for material and energy exchange and for the need to reach and maintain a homeostatic equilibrium with regard to the provision of certain material substances.16
Soziale Bedürfnisse umfassen alle Beziehungen zu anderen Menschen, die für das Individuum wichtig sind.
„Relatedness needs acknowledge that a person is not a self-contained unit but must engage in transactions with his human environment.“17
Wachstumsbedürfnisse zielen darauf ab, daß ein Mensch versucht in kreativer und produktiver Weise auf seine Umwelt einzuwirken.
„Growth needs emerge from the tendency of opensystems to increase in internal order and differentiation over time as a consequence of going beyond steady states and interacting with the environment.“18
Die Zuordnung lautet wie Folgt:19
- materielle Bedürfnisse
sichere Berufsstellung, hohe Bezahlung, ein Beruf, der einem viel Freizeit läßt, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen
- soziale Bedürfnisse
Status, Verantwortung, Kontakt, helfen, für Gesellschaft nützlich, sinnvoll
- Wachstums - Bedürfnisse gute Aufstiegsmöglichkeiten, interessante Tätigkeit, Selbstständigkeit
Alle drei Ansätze sind sich ähnlich. Die Faktoren instrumentell bzw. extrinsisch sind deckungsgleich. Gleich ist auch die Zuordnung von affektiv bzw. sozial. Kognitive und intrinsische Arbeitswerte sind sich in weiten Teilen ähnlich. Ein Unterschied ist die Einteilung des Items „sinnvoll empfundener Beruf“. Während Borg und Elizur dies als Element des kognitiven Faktors sehen, ordnet Schmidt es dem sozialen Faktor zu (s. Tab. 10). Dies deckt sich mit den Überlegungen von Alderfer.
Tabelle 10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Alderfer gibt mit seiner E.R.G. - Theorie drei Faktoren vor. Eine empirische Ü- berprüfung mittels einer Faktorenanalyse gibt Rückschlüsse über den Gehalt der Theorie. Sollten die statistische Überprüfung die gleichen Ergebnisse erzielen, dann ist das Konzept von Elizur mit der graphischen Interpretation bei den Items sozial nützlicher Beruf, anerkannter Beruf und sinnvoll empfundener Beruf nicht haltbar, da beide Ansätze sich in diesen Punkten unterscheiden.
Wenn Alderfers Theorie zutrifft, dann ist bei den Faktoren eine zeitliche Konsistenz gewährleistet. Müssen aufgrund der Ergebnisse Teile der Theorie verworfen werden, dann kann dies entweder an prinzipiell falschen Prämissen liegen oder an einem zeitlichen Wandel.
3 Datenbasis
Die Daten entstammen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) aus dem Jahr 1991. Der Datensatz stellt einen repräsentativen Querschnitt der bundesdeutschen Bevölkerung dar.20
Er enthält die Angaben von 3058 Befragten, die anhand einer mehrstufig ge- schichteten Zufallsauswahl ausgewählt und mittels eines standardisiertem Frage- bogens interviewt wurden.21 Die Daten können als objektiv und valide erachtet werden.
In dem Fragebogen wird nach der Wichtigkeit verschiedener Berufsmerkmale gefragt. Die Befragten sollen die Bedeutung verschiedener Berufsmerkmale auf einer siebenstufigen Skala von unwichtig bis sehr wichtig beurteilen. Es wird nach dreizehn Arbeitswerten gefragt.22
1. sichere Berufsstellung
2. hohes Einkommen
3. gute Aufstiegsmöglichkeiten
4. ein Beruf, der anerkannt und geachtet wird
5. Ein Beruf, der einem viel Freizeit läßt
6. Interessante Tätigkeit
7. Eine Tätigkeit, bei der man selbständig arbeiten kann
8. Aufgaben, die viel Verantwortungsbewußtsein erfordern
9. Viel Kontakt zu anderen Menschen
10. Ein Beruf, bei dem man anderen helfen kann
11. Ein Beruf, der für die Gesellschaft nützlich ist
12. Gibt einem das Gefühl, etwas sinnvolles zu tun
13. sichere und gesunde Arbeitsbedingungen
Der Allbus Datensatz enthält dreizehn Items. Eine vollständige Erfassung aller e- xistierenden und relevanten Arbeitswerte ist damit nicht gewährleistet. Es kann damit zumindest die Gültigkeit der Ansätze im Bezug auf diese Items überprüft werden.
Ausgehend von Alderfers Theorie müßte sich der Faktor materielle Arbeitswerte - auf materiellen Bedürfnissen beruhend - aus den Items 1, 2, 5, und 13 zusammen- setzen. Der Faktor Soziale Arbeitswerte aus den Items 4, 9, 10, 11 und 12 und der Faktor Arbeitswerte, die auf Wachstum bezogen sind, aus den Items 3, 6, 7 und 8.
4 Faktorenanalyse
Die verschiedenen theoretischen Zugänge besitzen eine wesentliche Gemeinsamkeit. In jeder Theorie wird davon ausgegangen, daß die verschiedenen Items Ausdruck einer darüberstehenden Variablen sind. Für die empirische Überprüfung der Theorien eignet sich daher die Faktorenanalyse sehr gut..
Die Faktorenanalyse unterstellt, daß für den Zusammenhang der einzelnen Vari- ablen eine „hinter diesen beiden Variablen stehende Größe“ kausal verantwortlich ist. Ein Faktor stellt die hinter den Variablen stehende Größe dar.23 Das Ziel der Faktorenanalyse besteht darin, zahlreiche Merkmale eines Sachverhalts auf weni- ge wichtige Einflußfaktoren zurückzuführen.24 Grundsätzlich unterscheidet man zwischen explorativer und konfirmatorischer Faktorenanalyse. Bei der explorati- ven Faktorenanalyse wird die Struktur der Variablen ohne theoretischen Hinter- grund aus den Ergebnissen gebildet. Die hier angewandte konfirmatorische Fakto- renanalyse hingegen geht von a priori aufgestellten Hypothesen aus, die getestet werden.25
Die Überprüfung von Hypothesen mittels der Faktorenanalyse erfolgt in mehreren Schritten.
4.1 Zusammenhänge zwischen den Variablen
Mit Hilfe der Korrelationanalyse werden die Zusammenhänge zwischen den Variablen meßbar gemacht und die ermittelten Korrelationskoeffizienten in der Korrelationsmatrix zusammengetragen. Dies ist notwendig, da die Faktoren als Repräsentanten dieses Zusammenhangs stehen.26 Die Korrelationsmatrix zeigt an, ob die Variablen „irgendwie zusammenhängen“. Die Form des Zusammenhangs gibt einen ersten Hinweis auf die Zahl der Faktoren.27
Um die Faktoren sinnvoll interpretieren zu können ist eine homogene Datenstruk- tur von Vorteil. Für die Eignung der Ausgangsvariablen ist eine Reihe von Prüf- kriterien entwickelt worden, die eine Antwort darauf geben, ob eine Faktorenana- lyse mit dem gegebenen Datenmaterial einen Sinn ergibt oder nicht. Nach Back- haus ist das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium das beste zur Verfügung stehende Verfahren zur Prüfung der Korrelationsmatrix auf Eignung des Datenmaterials.28 Es wird ein measure of sampling adequacy, kurz MSA- Wert, berechnet, der anzeigt, in welchem Umfang die Ausgangsvariablen zusammengehören und somit als Indikator dafür dient, ob eine Faktorenanalyse sinnvoll erscheint oder nicht.29 Nach Kaiser ist ein MSA - Wert von 0,8 wünschenswert, während ein Wert von kleiner als 0,5 als untragbar gilt; die gewählten Untersuchungsvariablen sind da- mit nicht für eine Faktorenanalyse geeignet. Variablen mit einem niedrigen MSA - Wert sollten sukzessiv aus der Untersuchung ausgeschlossen werden.30
4.2 Extraktion der Faktoren
Wie können die Faktoren aus den Variablen rechnerisch ermittelt werden? Die Rechnung basiert auf einer grundlegenden Annahme:
„Jeder Beobachtungswert einer Ausgangsvariablen xkj (...) läßt sich als Linearkombination mehrerer (hypothetischer) Faktoren beschreiben.“31
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
p = Faktor
a = Faktorladung bzw. Gewicht
Die Faktorladung ist eine Maßgröße für den Zusammenhang zwischen den Variablen und dem Faktor. Sie ist der Korrelationskoeffizient zwischen der Variablen und dem Faktor.32
4.3 Kommunalitäten
Im Normalfall korrelieren der Faktor nicht hundertprozentig mit den Variablen. Es bleibt noch eine Reststreuung übrig. Dies wird von Backhaus als das „Kommunalitätenproblem“ bezeichnet.33
Die Kommunalität ist der „Teil der Gesamtvarianz einer Variablen, der durch die gemeinsamen Faktoren erklärt werden soll.“34
Der Forscher muß festlegen, wieviel der Streuung der Variablen durch die Faktoren erklärt werden soll. Als Orientierungshilfe wurden drei praxisorientierte Verfahren entwickelt:35
- Man setzt die Kommunalitäten auf 1, d.h. die gesamte Varianz soll erklärt werden.
- Man gibt aufgrund inhaltlicher Überlegungen einen Schätzwert vor oder
- läßt die Kommunalitäten iterativ durch SPSS schätzen.
Da für die Untersuchung keine Hinweise auf einen Schätzwert vorliegen und eine vollständige Erklärung der Varianz durch die gesuchten drei Faktoren unwahrscheinlich ist, wird die Höhe der Kommunalitäten durch SPSS geschätzt.
4.4 Faktorextraktionsverfahren
Die Bestimmung der Kommunalitäten hängt mit der Wahl des Faktorextraktions- verfahren zusammen. Es gibt die Hauptkomponenten und die Hauptachsenanaly- se, die auf unterschiedlichen theoretischen Modellen beruhen.36 Mit Hauptkomponentenanalyse sucht man nach einem Sammelbegriff für die I- tems, während man mit der Hauptachsenanalyse nach den Ursachen forscht.37 In unserem Fall ist bspw. das Wachstumsbedürfnis die Ursache für den Zusammen- hang zwischen der Variablen „interessante Tätigkeit“ und dem Faktor „Wachs- tum“. Für die Hypothesenprüfung ist daher die Hauptachsenanalyse von Bedeu- tung.
Bei der Hauptachsenanalyse wird unterstellt, daß die Varianz einer Variablen aus zwei Einzelbestandteilen zusammengesetzt ist, der Kommunalität und der Einzel- restvarianz. Das Ziel der Analyse besteht darin, die Varianz in der Höhe der Kommunalitäten zu erklären.38
Als nächstes stellt sich nun die Frage nach der Anzahl der Faktoren.
4.5 Zahl der zu extrahierenden Faktoren
Im Prinzip ist die Zahl der Faktoren frei wählbar. Es wurden jedoch eine Reihe von statistischen Kriterien entwickelt, von denen das Kaiser - Kriterium am häufigsten angewendet wird.39 Das Kaiser - Kriterium legt die Zahl der Faktoren anhand des Eigenwertes fest. Der Eigenwert ist der „Varianzbeitrag eines Faktors im Hinblick auf die Varianz aller Variablen“40
Die Anzahl der Faktoren wird durch die Faktoren bestimmt, die einen Eigenwert von größer 1 haben.41
In dieser Untersuchung ist die Zahl der Faktoren vorgegeben. Das Kaiser - Krite- rium wird jedoch angewendet, um die grundsätzlichen Annahmen der Theorie zu überprüfen. Die Theorie gilt als nicht widerlegt, wenn sich tatsächlich drei Fakto- ren ergeben.
4.6 Faktorinterpretation
Die Faktoren werden mittels der Faktorladungen interpretiert; je höher die Ladung, desto stärker die Korrelation des Faktors mit der jeweiligen Variablen.42 Bei mehreren Faktoren können die Variablen auch auf mehreren Faktoren laden. Für die Zuordnung der Variablen zu den Faktoren gibt es die Konvention, daß ab einer Ladungshöhe von 0,5 die Variable dem Faktor zugeordnet wird. Dies gilt für jeden Faktor auf dem die Variable mit 0,5 oder größer lädt.43
Diese Konvention wird hier leicht abgeändert. Anstatt Items mit einer Ladung von kleiner 0,5 nicht zuzuordnen, werden diese als „theoretische Items“ trotzdem zu- geordnet, solange sie im Vergleich zu den anderen Faktoren den höchsten Wert auf dem betreffenden Faktor besitzen. Items mit einer Faktorladung von größer 0,5 werden als „Kernitems“ bezeichnet. Sie stellen die Zuordnung nach der gängigen Konvention dar.
Die Interpretation der Faktorladungen kann durch die rechtwinklige Drehung des Koordinationskreuzes erleichtert werden. Die Drehung wird meist mittels der Va- rimax - Rotation durchgeführt.44 Durch die Rotation bleiben die Ergebnisse gleich. Die Beziehungen zwischen Variablen und Faktoren werden nicht verän- dert.45
5 Ergebnisse
Betrachtet man zunächst die Häufigkeitsauszählung der 13 Items, dann fällt deren schiefe Verteilung auf. Bei keiner Variablen liegt der Median bei unter 5. Die si- chere Berufsstellung und die sicheren, gesunden Arbeitsbedingungen werden im Median mit ‚sehr wichtig‘ beurteilt. Diese rechtssteile Verteilung spiegelt sich auch beim Mittelwert. Dieser liegt zum Teil leicht über und zum Teil leicht unter dem Median (vgl. Tab. 1).
Tabelle 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die erste Faktorenanalyse wird mit der Hauptachsenanalyse durchgeführt. Zur Bestimmung der Zahl der Faktoren wird das Kaiser - Kriterium verwendet. Die Faktorenmatrix wird Varimax rotiert.
Einen ersten Eindruck zur Datenstruktur gibt die Korrelationsmatrix. Die hoch si- gnifikanten Ergebnisse liefern eine Korrelation der Variablen von größtenteils deutlich unter 50%. Größere Korrelationen gibt es bei „Einkommen“ mit „Auf- stiegschancen“ (51%), „selbständige“ mit „verantwortungsvolle Tätigkeit“ (55%), sowie „helfender“ und „sozial nützlicher Beruf“ (52%) (s. Tab. 2 im Anhang)
Anhand der niedrigen Korrelation kann damit gerechnet werden, daß die Faktor- ladungen sich auch eher in einem niedrigen Bereich bewegen. Der Anteil an gemeinsamer Streuung ist verhältnismäßig niedrig.
In die Untersuchung können alle Variablen aufgenommen werden. Der MSA - Wert liegt bei allen Items um die 0,8 und ist somit „verdienstvoll“. (vgl. Tab. 3 im Anhang).
Die extrahierten Kommunalitäten sind erwartungsgemäß niedrig. Bei der Variab- len „Freizeit“ liegt der Anteil an erklärter Varianz bei nur 11%. (vgl. Tab. 4 im Anhang). Dieses Problem zeigt sich auch bei Schmidt und Faulbaum. Beide hat- ten Probleme bei der Zuordnung von dem Item „Freizeit“.46 Freizeit scheint für eine Dimension von Arbeitswerten zu stehen, die in den verschiedenen Modellen nicht erfaßt werden.
Niedrige Werte finden sich auch bei den Arbeitsbedingungen (0,27), Beruf mit menschl. Kontakt (0,34), sichere Berufsstellung (0,35) und dem sinnvoll empfundenen Beruf. Der höchste Wert findet sich bei der selbständigen Tätigkeit mit einem Anteil von 62% an erklärter Varianz. (vgl. Tab. 4).
Es ergeben sich - wie erwartet - drei Faktoren mit einem Eigenwert größer als eins. Der erste Faktor bringt den mit Abstand höchsten Erklärungsanteil (29%). Die erklärte Gesamtvarianz durch die drei Faktoren liegt bei unter 50%. (vgl. Tab. 5 im Anhang).47
Die Interpretation der unrotierten Faktormatrix ist nicht möglich. Alle Faktoren laden auf dem ersten Faktor hoch und zeigen bei den weiteren Faktoren häufig eine negative Korrelation (vgl. Tab. 6 im Anhang).
Die rotierte Faktorenmatrix ergibt verschiedene Kernitems und theoretische Items. Dem Faktor Wachstum können die Items interessante Tätigkeit, selbständige Tä- tigkeit und verantwortungsvolle Tätigkeit eindeutig zugeordnet werden. Dies ent- spricht der theoretischen Zuordnung. Dagegen wird das Item gute Aufstiegschan- cen nicht dem Faktor Wachstum, sondern dem materiellen Faktor zugeordnet (vgl. Tab.7).
Tabelle 7
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dies widerspricht der Theorie von Alderfer um so mehr, da bereits die hohe Korrelation mit dem Item hohes Einkommen und die verhältnismäßig hohe Kommunalität für die Gültigkeit des Ergebnisses sprechen.
Die Befragten scheinen die Bedeutung von Aufstiegsmöglichkeiten weniger unter dem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung zu betrachten, sondern verbinden mit einem beruflichen Aufstieg vor allem das damit zusammenhängende höhere Ein- kommen.
Das „hohe Einkommen“ und die „sichere Berufsstellung“ sind die Kernitems des materiellen Faktors. Sie entsprechen der theoretischen Zuordnung. Die Items „Freizeit“ und „Arbeitsbedingungen“ können als theoretische Items auch dem ma- teriellen Faktor zugeordnet werden. Sie weisen im Vergleich zu den anderen Fak- toren die höchste Ladung auf. Keiner der beiden Items erreicht allerdings die 0,5 Grenze. (vgl. Tab.7) Die Gültigkeit des materiellen Faktors kann nicht widerlegt werden.
Der soziale Faktor wird zum Teil widerlegt. Die Kernitems sind der „helfende Be- ruf“ und der „sozial nützliche Beruf“. Ein „sinnvoller Beruf“ und der „Beruf mit menschlichem Kontakt“ sind theoretische Items. Das Item „anerkannter Beruf“ wird jedoch nicht dem sozialen Faktor zugeordnet. Es ist mit den drei Faktoren nicht erklärbar.
Wird eine Faktorenanalyse mit 4 zu extrahierenden Faktoren durchgeführt, dann ändert sich die Zuordnung des Items Arbeitsbedingungen. Es lädt dann als einzi- ges auf diesem unbekannten Faktor hoch. (vgl. Tab. 8 im Anhang) Das Problem der eindeutigen Zuordnung dieses Items findet sich auch bei Borg.48
Eine Untersuchung mittels einer Hauptkomponentenanalyse führt zu strukturgleichen Ergebnissen (vgl. Tab.9 im Anhang).
6 Ausblick
Die E.R.G. Theorie von Alderfer kann durch das gegebene Datenmaterial nicht widerlegt werden. Die meisten Items lassen sich mit der Faktorenanalyse durch SPSS fehlerfrei den entsprechenden Faktoren zuordnen. Problematisch erscheint die Zuordnung der Items Freizeit, Arbeitsbedingungen und anerkannter Beruf. Sie scheinen durch die drei Faktoren Modelle nicht erfaßt zu werden. Es bedarf hier weitergehender Forschung, die darauf abzielt, die mit diesen Items verbundenen Faktoren zu ermitteln. Bei dem Item gute Aufstiegschancen stellt sich die Frage, ob die Zuordnung zum Wachstumsfaktor grundsätzlich falsch ist, ober ob die in- haltliche Bedeutung einem zeitlichen Wandel unterworfen ist.
Literaturverzeichnis
Alderfer, Clayton (1972): Existence, Relatedness, and Growth. Human Needs in Organizational Settings. New York.
Backhaus, Klaus et al. (1996): Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungs- orientierte Einführung. 8. Aufl., Berlin usw..
Borg, Ingwer (1986): A Cross - Cultural Replication on Elizur’s Facets of Work Values. In: Multivariate Behavioral Research, 21 (1986), S. 401 - 410.
Borg, Ingwer und Withold Galinat (1986): Struktur und Verteilung von Arbeits- werten. In: Psychologische Beiträge, 28 (1986), S. 495 - 515.
Borg, Ingwer und Thomas Staufenbiel (1991): Ein idiographisches Modell und Meßverfahren zur Analyse von Arbeitswerten und Arbeitszufriedenheit. In: Fischer, Lorenz (Hrsg.) (1991): Arbeitszufriedenheit. Stuttgart, S. 157 - 175.
Borg, Ingwer und Michael Braun und Michael Häder (1993): Arbeitswerte in Ost- und Westdeutschland. Unterschiedliche Gewichte, aber gleiche Struktur. In: ZUMA - Nachrichten, 33 (1993), S. 64 - 82.
Elizur, Dov (1984): Facets of Work Values. A Structural Analysis of Work Out- comes. In: Journal of Applied Psychology, 69 (1984), S. 379 - 389.
Faulbaum, Frank (1983): Konfirmatorische Analysen der Reliabilität von Wich- tigkeitseinstufungen beruflicher Merkmale. In: ZUMA - Nachrichten, 13 (1983), S. 22 - 44.
Fischer, Lorenz (Hrsg.) (1991): Arbeitszufriedenheit. Stuttgart.
Glöckner - Rist, A. und Schmidt, P. (Hrsg.) (1999): ZUMA - Informationssys- tem. Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumen- te. Version 3.00, Mannheim
Lewis-Beck, Michael (1994): Factor Analysis and Related Techniques. o.O..
Schmidt, Peter (1983): Messung von Arbeitsorientierungen. Theoretische Fundie- rung und Test alternativer kausaler Meßmodelle. In: Analyse und Kritik, 5 (1983), S. 115 - 153.
Anhang
Tabelle 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 8
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 9
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 vgl. Elizur 1984, S. 379.
2 Rokeach 1968, S. 124, zitiert nach: Borg und Staufenbiel 1991, S. 158.l
3 Wollack et al. 1971, S. 331, zitiert nach Borg und Galinat 1986, S. 497.
4 vgl. Borg und Galinat 1986, S. 497.
5 vgl. Elizur 1984, S. 380.
6 vgl. Elizur 1984, S. 381.
7 vgl. Elizur 1984, S. 380.
8 vgl. Elizur 1984, S. 380f.
9 vgl. Elizur 1984, S. 386.
10 vgl. Borg 1986a, S. 406f.
11 vgl. Borg 1986a, S. 402.
12 vgl. Borg 1986a, S. 406f.
13 vgl. hierzu und zu dem Folgendem: Schmidt 1983, S. 123.
14 vgl. Alderfer 1972, S. 6.
15 Borg und Braun und Häder, 1993, S. 67.
16 Alderfer 1972, S. 9.
17 Alderfer 1972, S. 9.
18 Alderfer 1972, S. 9.
19 vgl. Borg und Braun und Häder, 1993, S. 73.
20 vgl. http://www.zuma-mannheim.de/allbus/inform.htm, 6.9.99.
21 vgl. http://www.za.uni-koeln.de/data/allbus/all1991.htm 6.9.99.
22 vgl. ZA & ZUMA (1999): Wichtigkeit verschiedener Berufsmerkmale. In: Glöckner-Rist, A. und P. Schmidt (Hrsg.): ZUMA-Informationssystem. Elektronisches Handbuch sozialwissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. Version 3.00, Mannheim, o.S..
23 vgl. Backhaus et al 1996, S. 195f.
24 vgl. Backhaus et al 1996, S. XXI.
25 vgl. Lewis - Beck 1994, S. 3.
26 vgl. Backhaus et al 1996, S. 199
27 vgl. Backhaus et al 1996, S. 202.
28 vgl. Backhaus et al 1996, S. 202ff.
29 vgl. Backhaus et al 1996, S. 206.
30 vgl. Backhaus et al 1996, S. 206f.
31 vgl. Backhaus et al 1996, S. 208.
32 vgl. Backhaus et al 1996, S. 208.
33 vgl. Backhaus et al 1996, S. 220.
34 Backhaus et al 1996, S. 220.
35 vgl. Backhaus et al 1996, S. 221f.
36 vgl. Backhaus et al 1996, S. 221f.
37 Backhaus et al 1996, S. 223f.
38 vgl. Backhaus et al 1996, S. 222.
39 vgl. hierzu Backhaus et al 1996, S.226.
40 Backhaus et al 1996, S. 226.
41 Backhaus et al 1996, S. 226.
42 vgl. Backhaus et al 1996, S. 228.
43 vgl. Backhaus et al 1996, S. 229.
44 vgl. Backhaus et al 1996, S. 229.
45 vgl. Lewis - Beck 1994, S. 44.
46 vgl. Borg 1986a, S. 409.
47 Eine mögliche Ursache ist die hohe Zahl an Befragten, da die Gesamtstreuung mit Anzahl der Befragten bekanntlich steigt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit beschäftigt sich mit Arbeitszufriedenheit und den damit verbundenen Arbeitswerten. Es werden verschiedene Klassifikationen von Arbeitswerten untersucht.
Welche Ansätze zur Strukturierung von Arbeitswerten werden in der Arbeit betrachtet?
Es werden drei Hauptansätze skizziert: der Ansatz von Elizur (Modality of Outcome), der Ansatz von Schmidt (intrinsisch, extrinsisch, sozial) und die E.R.G.-Theorie von Alderfer (Existence, Relatedness, Growth).
Was ist der "Modality of Outcome" nach Elizur?
Elizur unterscheidet drei Faktoren: instrumentelle (z.B. Bezahlung), affektive (z.B. Kontakt zu Kollegen) und kognitive (z.B. Verantwortung) Arbeitswerte.
Was besagt die E.R.G.-Theorie von Alderfer?
Alderfer geht von drei grundlegenden Arten von Bedürfnissen aus: materielle (Existence), soziale (Relatedness) und Wachstumsbedürfnisse (Growth). Arbeitswerte werden entsprechend diesen Bedürfnissen klassifiziert.
Welche Datenbasis wurde für die empirische Überprüfung verwendet?
Die Daten stammen aus der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) von 1991, die einen repräsentativen Querschnitt der bundesdeutschen Bevölkerung darstellt.
Welche Analysemethode wurde angewendet?
Es wurde eine Faktorenanalyse mit dem Statistikprogramm SPSS durchgeführt, um die theoretischen Ansätze empirisch zu überprüfen.
Was ist das Ziel der Faktorenanalyse in dieser Arbeit?
Ziel ist es, zu überprüfen, ob die verschiedenen theoretischen Ansätze zur Strukturierung von Arbeitswerten durch die Daten gestützt werden, insbesondere ob sich die von Alderfer postulierten drei Faktoren bestätigen lassen.
Was ist das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (MSA)?
Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (MSA) ist ein Maß, um die Eignung der Ausgangsvariablen für eine Faktorenanalyse zu prüfen. Es zeigt an, in welchem Umfang die Variablen zusammengehören. Ein Wert über 0.8 ist wünschenswert, während ein Wert unter 0.5 als untragbar gilt.
Was sind Faktorladungen und Kommunalitäten?
Faktorladungen sind Maßgrößen für den Zusammenhang zwischen Variablen und Faktoren. Kommunalitäten geben an, welcher Teil der Gesamtvarianz einer Variablen durch die gemeinsamen Faktoren erklärt wird.
Was wurde in der Faktorenanalyse als Ergebnis festgestellt?
Die E.R.G. Theorie von Alderfer konnte durch das gegebene Datenmaterial nicht widerlegt werden. Die meisten Items lassen sich mit der Faktorenanalyse durch SPSS fehlerfrei den entsprechenden Faktoren zuordnen. Problematisch erscheint die Zuordnung der Items Freizeit, Arbeitsbedingungen und anerkannter Beruf. Sie scheinen durch die drei Faktoren Modelle nicht erfaßt zu werden.
Was ist die Bedeutung des Items „gute Aufstiegsmöglichkeiten“?
Die Befragten scheinen die Bedeutung von Aufstiegsmöglichkeiten weniger unter dem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung zu betrachten, sondern verbinden mit einem beruflichen Aufstieg vor allem das damit zusammenhängende höhere Ein- kommen.
- Citation du texte
- Frank Holoch (Auteur), 1999, Die Struktur von Arbeitswerten. Eine faktorenanalytische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97049