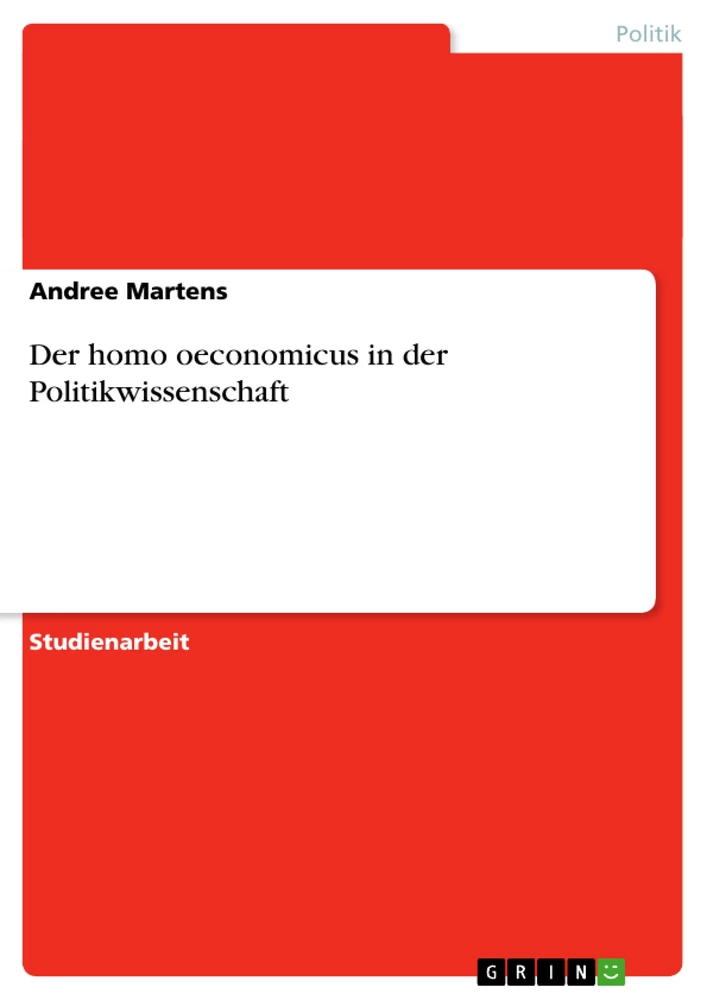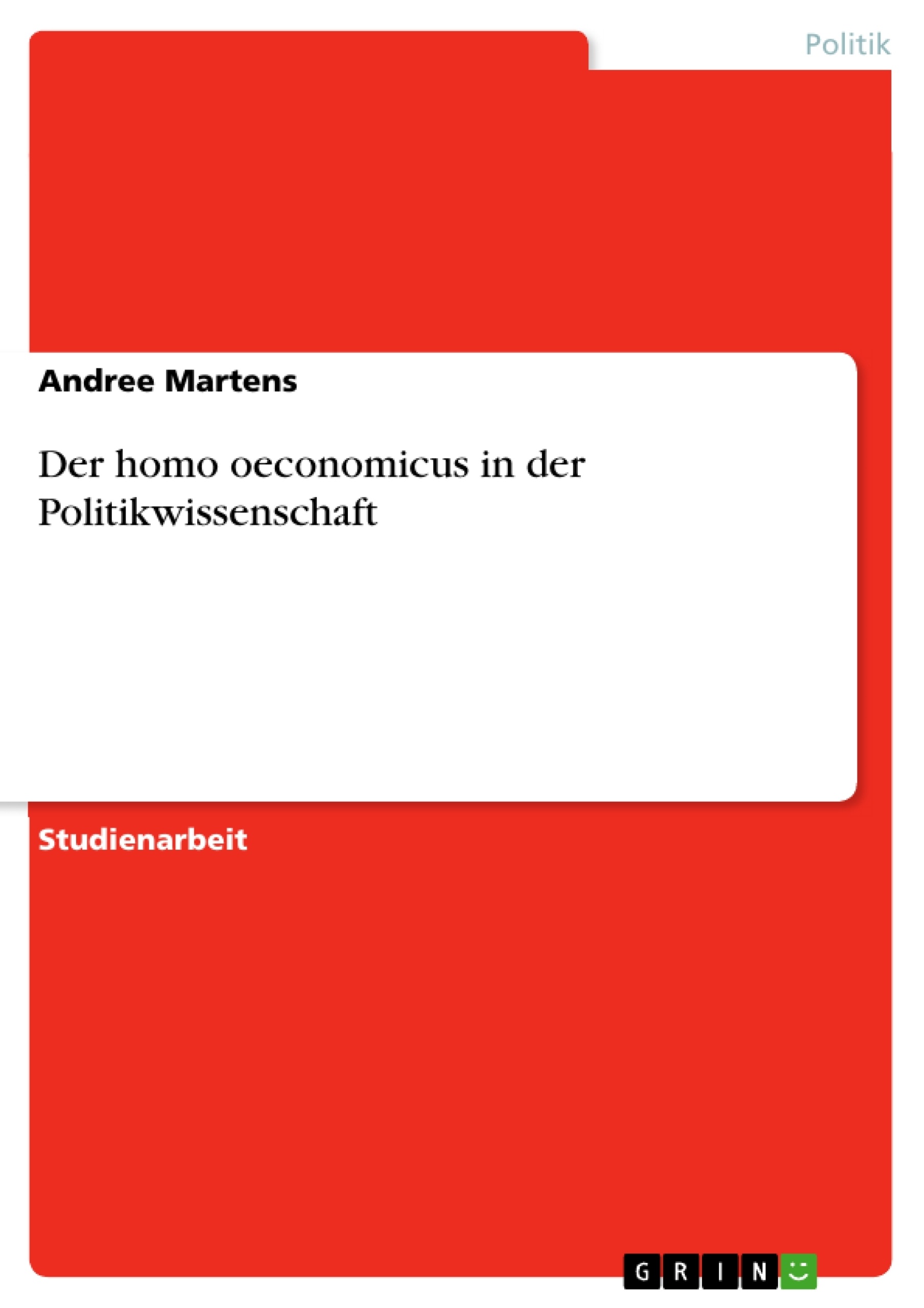Der allgemeine Glaube, dass der homo oeconomicus allein in der Wirtschaft zu Hause wäre, ist weit verbreitet. "Der homo oeconomicus ist eben der in der Wirtschaft tätige Mensch."
Das Menschenbild des homo oeconomicus geht allerdings darüber hinaus. Es ist ein Erklärungsversuch für menschliches Verhalten, in dem es dem Menschen Rationalität und Egoismus unterstellt.
Da es keinen vernünftigen Grund gibt anzunehmen, dass Menschen sich grundsätzlich anders verhalten, wenn sie beispielsweise soziale und politische Probleme lösen als wenn sie wirtschaftliche oder juristische Aufgaben angehen, gibt es auch keinen Grund, den homo oeconomicus aus den anderen Sozialwissenschaften auszusperren.
In dieser Arbeit soll der homo oeconomicus in der modernen Politikwissenschaft betrachtet werden bzw. das Verhalten der Politiker in demokratischen Systemen unter Voraussetzung des ökonomischen Menschenbildes analysiert werden.
Einleitend wird auf die Entwicklung des Menschenbildes des homo oeconomicus in der Historie eingegangen, wo vor allem deutlich gemacht werden soll, dass dieses Menschenbild tatsächlich kein Kind der Ökonomie sondern vielmehr im Bereich der Staatsphilosophie anzusiedeln ist. Die Anwendung des ökonomischen Menschenbildes in der modernen Politikwissenschaft kann von dieser Seite aus betrachtet vielleicht sogar als Schritt "back to the roots" betrachtet werden.
"Wie verhalten sich Politiker in Demokratien unter Zugrundelegung des ökonomischen Menschenbildes?", lautet die Frage, welcher hier vor allem nachgegangen werden soll.
Eine erste Antwort wird mit dem von Downs entwickelten Modell der Parteienkonkurrenz gegeben, in dem den Parteien im besonderen bzw. den Politikern im allgemeinen ein Verhalten unterstellt wird, welches im Prinzip auf eine mittlere Interessenvertretung der Wähler hinausläuft.
Anschließend wird diese Annahme durch drei aus der "Public-Choice-Perspektive" vorgetragenen Argumente konterkariert, welche dafür sprechen, dass Politiker nicht die mittleren Interessen der Wähler sondern vielmehr Minoritäteninteressen vertreten.
Im Zuge dieser Argumentation rücken neben den Politikern die Vertreter von Interessengruppen als weiterer wichtiger Akteur im politischen Prozess ins Zentrum der Betrachtung.
Eine dritte wichtige Gruppe der "politischen Unternehmer", die Bürokraten, werden nicht außen vorgelassen. Ihr Verhalten wird auf dem Hintergrund des ökonomischen Verhaltensmodells abschließend untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Geschichte des homo oeconomicus
- Das ökonomische Verhaltensmodell
- Präferenzen und Restriktionen
- Die Eigenständigkeit der Entscheidung
- Die Rationalität der Entscheidung
- Downs ökonomische Theorie der Demokratie
- Der Politiker als Nutzenmaximierer
- Das ökonomische Modell der Parteienkonkurrenz
- Modellkritik aus der "Public-Choice-Perspektive"
- Die Konzentration der Interessen
- Der Informationsgrad der Wähler
- Der Organisationsgrad der Wähler
- Bürokraten als Nutzenmaximierer
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Menschenbild des homo oeconomicus in der modernen Politikwissenschaft und analysiert das Verhalten von Politikern in demokratischen Systemen unter der Prämisse eines ökonomischen Menschenbildes. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des homo oeconomicus und zeigt auf, dass dieses Menschenbild nicht spezifisch aus der Ökonomie stammt, sondern seine Wurzeln in der Staatsphilosophie hat.
- Die Entwicklung des Menschenbildes des homo oeconomicus
- Die Anwendung des ökonomischen Menschenbildes in der Politikwissenschaft
- Das Verhalten von Politikern in Demokratien unter der Annahme des homo oeconomicus
- Das ökonomische Modell der Parteienkonkurrenz nach Downs
- Kritik an der Annahme von mittleren Interessenvertretung durch Politiker und die Bedeutung von Minoritäteninteressen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar und skizziert die Forschungsfrage: Wie verhalten sich Politiker in Demokratien unter Zugrundelegung des ökonomischen Menschenbildes? Das Kapitel "Zur Geschichte des homo oeconomicus" zeichnet die Entwicklung dieses Menschenbildes von der Antike bis in die Neuzeit nach, wobei die Beiträge von Platon, Hobbes, Mandeville und Adam Smith hervorgehoben werden.
Das Kapitel "Das ökonomische Verhaltensmodell" erläutert die zentralen Elemente des homo oeconomicus, nämlich Präferenzen, Restriktionen, die Eigenständigkeit der Entscheidung und die Rationalität der Entscheidung. Im Anschluss daran analysiert das Kapitel "Downs ökonomische Theorie der Demokratie" das von Downs entwickelte Modell der Parteienkonkurrenz, in dem Politikern ein Verhalten unterstellt wird, welches auf eine mittlere Interessenvertretung der Wähler hinausläuft.
Das Kapitel "Modellkritik aus der \"Public-Choice-Perspektive\"" stellt drei Argumente vor, die gegen die Annahme von mittleren Interessenvertretung sprechen und für die Bedeutung von Minoritäteninteressen argumentieren. Diese Argumente beziehen sich auf die Konzentration der Interessen, den Informationsgrad der Wähler und den Organisationsgrad der Wähler.
Das Kapitel "Bürokraten als Nutzenmaximierer" untersucht das Verhalten von Bürokraten im politischen Prozess, wobei deren Rolle als "politische Unternehmer" hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem homo oeconomicus, einem Menschenbild, das in der Ökonomie, aber auch in anderen Sozialwissenschaften Anwendung findet. Zentrale Themen sind die ökonomische Theorie der Demokratie, die "Public-Choice-Perspektive", die Modellkritik und die Rolle von Politikern und Bürokraten im politischen Prozess.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Menschenbild des „homo oeconomicus“?
Es unterstellt dem Menschen rationales Handeln, Eigeninteresse (Egoismus) und die Maximierung des eigenen Nutzens.
Warum wird dieses Modell in der Politikwissenschaft angewendet?
Man geht davon aus, dass Politiker und Wähler sich bei politischen Entscheidungen ähnlich rational und eigennützig verhalten wie bei wirtschaftlichen Transaktionen.
Was besagt Downs’ Modell der Parteienkonkurrenz?
Downs nimmt an, dass Parteien ihre Programme so gestalten, dass sie die Interessen des „Medianwählers“ (der Mitte) treffen, um ihre Wahlchancen zu maximieren.
Was kritisiert die „Public-Choice-Perspektive“?
Sie argumentiert, dass Politiker oft nicht die Mehrheit, sondern gut organisierte Minoritäten (Interessengruppen) bedienen, da diese einen höheren Einfluss haben.
Handeln auch Bürokraten als Nutzenmaximierer?
Ja, die Theorie unterstellt Bürokraten, dass sie versuchen, ihr Budget, ihren Einfluss oder ihre Kompetenzen zu maximieren, anstatt nur effizient zu verwalten.
Wo liegen die historischen Wurzeln des homo oeconomicus?
Obwohl oft der Ökonomie zugeordnet, liegen die Wurzeln eher in der Staatsphilosophie bei Denkern wie Hobbes, Mandeville oder Adam Smith.
- Citar trabajo
- Andree Martens (Autor), 2001, Der homo oeconomicus in der Politikwissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9706