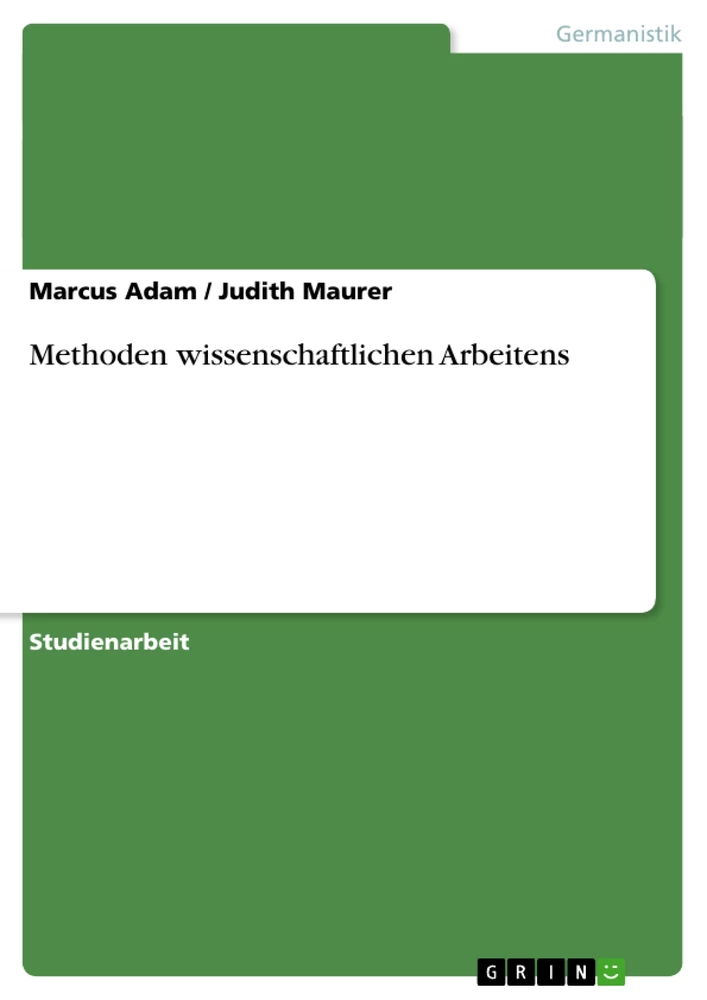I. Arten schriftlicher Arbeiten
- Examensarbeit
- Dissertation (Doktorarbeit)
- Magisterarbeit
- Seminararbeit
II. Vorbereitung: Literaturrecherche, Auffinden, Aufzeichnen und Ordnen des Materials
II.1. Literatursuche
II.1.1 Ort:
- Suche in Verschiedenen Bibliotheken möglich
- → für wissenschaftliches Arbeiten sind Universitäts- Verwaltungs- Hochschul- und Staatsbibliotheken zu verwenden
- Präsenzbibliotheken
- Ausleihbibliotheken Vorsicht: Wartezeiten möglich
- Suche nach Büchern oder Aufsätzen zu einem bestimmten Thema: Systematischer Katalog (falls vorhanden auch der Schlagwortkatalog)
- Suche nach Texten, deren Verfasser oder Titel man kennt: Alphabetischer Katalog
EDV-Katalog (OPAC) in beiden Fällen möglich
II.1.2. Fundstellen
- Monographien, Aufsätze, Forschungsberichte, Dokumentationen usw. (Bild, Ton), Computer
- Fachlexika (z.B. Kindlers Literaturlexikon)→ Verweisen auf weiterführende Literatur ® verweist wiederum auf spezielle Literatur ( in Literaturverzeichnissen)
- Fachzeitschriften oder Handbüchern des speziellen Themengebietes (z.B. Deutschunterricht an Grundschulen)→ Literaturangaben in Anmerkungen und Literaturverzeichnissen
- Literaturlisten der Lehrveranstaltungen oder HandapparateÆ weisen oft auf (ohnehin notwendige) (Pflicht-) Literatur hin - für die Anfangsschritte helfen Dozenten meist auch mit Hinweisen
- Internet → noch umstritten
II.2. Materialverwaltung und Organisation
- Ablage: Aktenordner DIN A 4Æ Register je nach Zweck oder Klebezettel
- Ordnen: alphabetisch nach Verfasser, Thema oder WerktitelnÆ je nach Zweck chronologisch nach Bearbeitungsreihenfolge oder Erscheinungsdatum
- Beschriftung:
- Merke: Blätter können leicht durcheinander geraten, daher immer Quelle am Literaturfragment notieren
→ am besten gleich korrekte Literaturangabe auf dem ersten Blatt vermerken, auch Signatur ist empfehlenswert
→ Primär- und Sekundärliteratur
- das gleiche bei herausgeschriebenen Zitaten (Bedenke: Literaturverzeichnis!)
- mehrblättrige Aufzeichnungen (ggf.. auch Kopien) durchnumerieren und am Rand der Seite Verfassernamen und Kurztitel der Quelle vermerken
- Seiten prinzipiell nur einseitig beschriften (Austausch, Ausschneiden und Zusammenkleben möglich)
- eigene Gedankengänge am Text markieren:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
III. Formales / Gestaltung des Manuskripts
Formalitäten werden in der Regel vom Dozenten zumindest teilweise vorgegeben. Es gibt aber grundlegende Allgemeinheiten:
Äußere Gestaltung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
III.1 Die Gestaltung des Schriftbildes
- mit PC oder Schreibmaschine verfassen
- einseitig beschriebene Blätter / anderthalbfacher Zeilenabstand (normal)
- Rand: links 2 cm , rechts 4 cm, unten 2,5 cm
- Seitennumerierung: Ab Titelbaltt (einschl.) durchlaufend, bei Seminararbeiten jedoch ohne Zählung von Titelseite und Inhaltsangabe)
- Umfang : individuell, jedoch in der Regel: Grundstudium bzw. "kleiner Schein" (QuaSt) ca 15 Seiten ; Hauptstudium bzw "großer Schein" (LN) ca 25-30 Seiten
- zusammenheften oder binden (Diplomarbeit)
Zitate:
- alle Textstellen , die direkt oder indirekt fremdes Gedankengut enthalten, müssen im Text besonders ausgewiesen sein. Es genügt nicht, die Angabe im Literaturverzeichnis.
- Direkte Zitate : doppelte Anführungszeichen (") , bei Auslassung eckig eingeklammerte Punkte, übernommene Fehler oder Unklarheiten mit eckig eingeklammertem (!) oder (sic!) kennzeichnen.
- Indirekte Zitate (inhaltliche Übernahmen anderer im eigenen Wortlaut): einfache Anführungszeichen.
- Alle Zitate werden mit Kurzbeleg oder Fußnote nachgewiesen.
Anmerkungen:
a. Fußnoten:
- werden mit hochgestellter Ziffer gekennzeichnet und unten auf der Seite aufgeführt; sind meist gedankliche Ergänzungen , Erläuterungen oder Exkurse, die jedoch den Textfluß stören würden.
b. im Text:
- werden in Klammern in den Textfluß eingefügt.
Abkürzungen:
- müssen erklärt werden (evtl. auf eigener Seite "Abkürzungen"), falls die Abkürzung über das normalsprachliche hinausgeht.(s. Beispiel!)
Fremsprachige Begriffe im Text:
- werden unterstrichen (z.B. entente cordiale) bzw. beim Druck kursiv gestzt
Anhang:
Beispiele für Literatur- und Quellenangaben
Selbständig erschienene Quelle:
Vester, Frederic: Neuland des Denkens: Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter. 2. Aufl. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1981.
Unselbständig erschienene Quelle:
Nowotny, Karl Anton: "Klassische Archäologie und ethnographische Theorien". Entwicklung und Fortschritt: Soziologische und ethnologische Aspekte des sozialkulturellen Wandels. Wilhelm Emil Mühlmann zum 65. Geburtstag. Hg. Horst Reimann und Ernst W. Müller. Tübingen: Mohr, 1969. Seite 44 - 53.
Veröffentlichte und unveröffentlichte Dissertationen
Hunter, Charles K.: Der Interpersonalitätsbeweis in Fichtes früher angewandter praktischer Philosophie. Monographien zur philosophischen Forschung 106. (Diss. München, 1971.) Meisenheim: Hain, 1073.
Fremdsprachige Quellen
Wiener, Norbert: Cybernetics Or Control in the Animal and the Machine. New York: Wiley, 1948.
Filme / Fernsehsendungen, Tonträger, Internet
Schlöndorff, Volker und Margarethe von Trotta, Reg. : Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Spielfilm. Nach der Erzählung von Heinrich Böll .Paramount - Orion / Bioskop / WDR, 1975.
Wecker, Konstantin: "Lied vom Mannsein". Kontantin Wecker Live. Schallplatte. Hamburg: Polydor, Stereo 2664239, 1979.
http:// www.uni-koeln/ezw-fak.de.
Literatur:
Poenicke, Klaus: Die schriftliche Arbeit. Dudenverlag; 2. verb. Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien 1988. Seite 3 - 21 .
Rothmann, Kurt: Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten. Reclam; Stuttgart 1997. Seite 1 - 61.
Häufig gestellte Fragen
Welche Arten schriftlicher Arbeiten werden unterschieden?
Es werden Examensarbeiten, Dissertationen (Doktorarbeiten), Magisterarbeiten und Seminararbeiten unterschieden.
Wie bereitet man sich auf das wissenschaftliche Arbeiten vor?
Die Vorbereitung umfasst Literaturrecherche, das Auffinden, Aufzeichnen und Ordnen des Materials.
Wo kann man Literatur suchen?
Die Literatursuche ist in verschiedenen Bibliotheken möglich, wobei für wissenschaftliches Arbeiten Universitäts-, Verwaltungs-, Hochschul- und Staatsbibliotheken relevant sind. Es gibt Präsenzbibliotheken und Ausleihbibliotheken. Man kann systematisch nach Büchern oder Aufsätzen zu einem Thema suchen oder alphabetisch nach Texten, deren Verfasser oder Titel bekannt sind, wobei EDV-Kataloge (OPAC) hilfreich sein können.
Welche Fundstellen gibt es für Literatur?
Zu den Fundstellen gehören Monographien, Aufsätze, Forschungsberichte, Dokumentationen, Fachlexika (wie Kindlers Literaturlexikon), Fachzeitschriften oder Handbücher des speziellen Themengebietes, Literaturlisten der Lehrveranstaltungen oder Handapparate sowie das Internet.
Wie verwaltet und organisiert man das gefundene Material?
Die Materialverwaltung und Organisation erfolgt idealerweise in Aktenordnern DIN A4 mit Registern oder Klebezetteln. Das Material kann alphabetisch nach Verfasser, Thema oder Werktiteln oder chronologisch nach Bearbeitungsreihenfolge oder Erscheinungsdatum geordnet werden. Wichtig ist, immer die Quelle am Literaturfragment zu notieren, am besten gleich mit korrekter Literaturangabe und Signatur auf dem ersten Blatt. Primär- und Sekundärliteratur sollten getrennt behandelt werden. Mehrblättrige Aufzeichnungen durchnummerieren und am Rand der Seite Verfassernamen und Kurztitel der Quelle vermerken. Seiten prinzipiell nur einseitig beschriften, um Austausch und Bearbeitung zu ermöglichen. Eigene Gedankengänge am Text markieren.
Welche formalen Aspekte sind bei der Gestaltung des Manuskripts zu beachten?
Die Formalitäten werden in der Regel vom Dozenten vorgegeben, es gibt aber grundlegende Allgemeinheiten. Dazu gehört die äußere Gestaltung, das Schriftbild (PC oder Schreibmaschine, einseitig beschriebene Blätter, anderthalbfacher Zeilenabstand, Rand: links 2 cm, rechts 4 cm, unten 2,5 cm), Seitennumerierung ab Titelblatt (einschl.), Umfang (variiert je nach Art der Arbeit) und Art der Bindung (heften oder binden). Zitate müssen korrekt ausgewiesen werden (direkte Zitate mit doppelten Anführungszeichen, indirekte Zitate mit einfachen Anführungszeichen) und mit Kurzbeleg oder Fußnote nachgewiesen werden.
Wie werden Anmerkungen formatiert?
Anmerkungen können als Fußnoten (mit hochgestellter Ziffer gekennzeichnet und unten auf der Seite aufgeführt) oder im Text (in Klammern in den Textfluss eingefügt) erfolgen. Fußnoten enthalten meist gedankliche Ergänzungen , Erläuterungen oder Exkurse, die jedoch den Textfluss stören würden.
Wie geht man mit Abkürzungen, fremdsprachigen Begriffen und Anhängen um?
Abkürzungen müssen erklärt werden (evtl. auf eigener Seite "Abkürzungen"), falls sie über das normalsprachliche hinausgehen. Fremdsprachige Begriffe im Text werden unterstrichen (bzw. beim Druck kursiv gesetzt). Ein Anhang kann Beispiele für Literatur- und Quellenangaben enthalten.
Wie werden Literatur- und Quellenangaben korrekt angegeben?
Es werden Beispiele für selbständig erschienene Quellen, unselbständig erschienene Quellen, veröffentlichte und unveröffentlichte Dissertationen, fremdsprachige Quellen, Filme/Fernsehsendungen, Tonträger und Internetquellen gegeben. Es werden auch Beispiele für gängige Literatur wie z.B. Werke von Klaus Poenicke und Kurt Rothmann aufgelistet.
- Arbeit zitieren
- Marcus Adam (Autor:in), Judith Maurer (Autor:in), 2000, Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97109