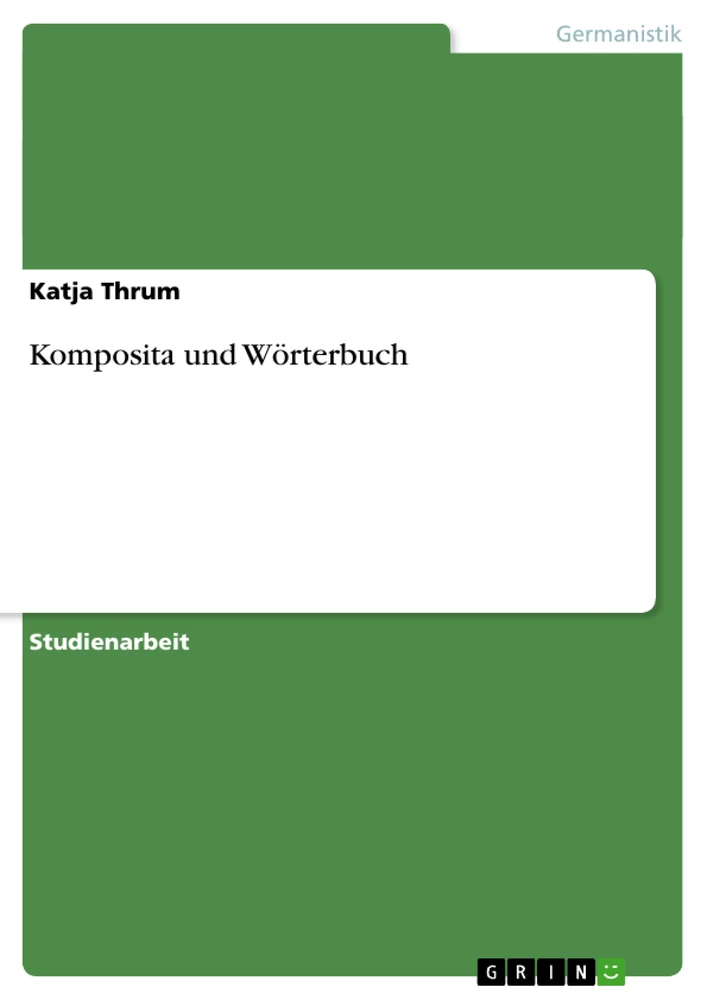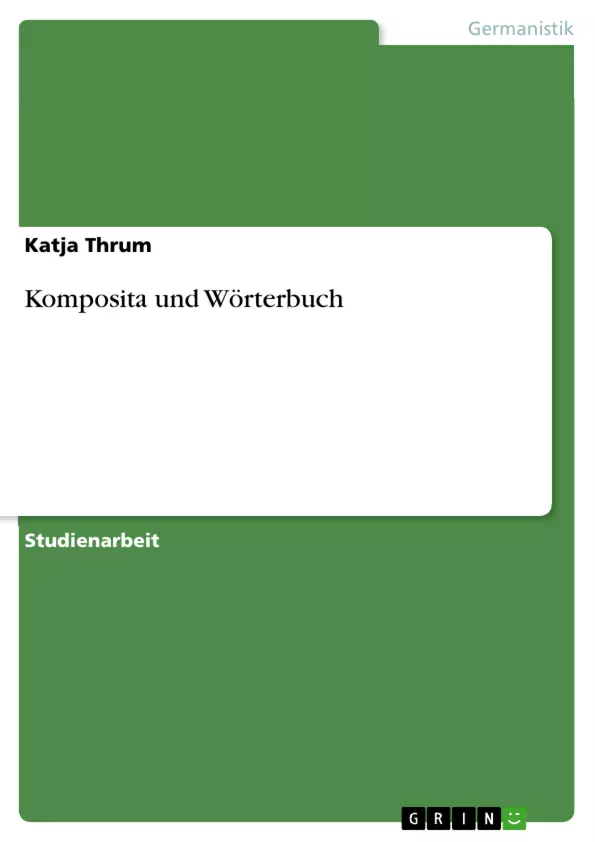Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Wörter in Wörterbüchern stehen und andere nicht? Diese tiefgründige Analyse der deutschen Komposita, jener faszinierenden Wortzusammensetzungen, die unsere Sprache so reichhaltig machen, wirft ein neues Licht auf die oft willkürliche Welt der Lexikographie. Die Autorin nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Struktur und Funktion von Komposita, von den alltäglichen Determinativkomposita wie "Pferderennen" bis hin zu den kreativen Ad-hoc-Bildungen, die im Moment entstehen und vielleicht nie den Weg in ein Wörterbuch finden werden. Dabei werden nicht nur die theoretischen Grundlagen der Wortbildung beleuchtet, sondern auch die praktischen Probleme der Lexikalisierung und der Auswahl von Lemmata in Wörterbüchern kritisch hinterfragt. Welche Kriterien bestimmen, ob ein Wort "wörterbuchwürdig" ist? Wie gehen verschiedene Wörterbücher mit der Aufnahme und Anordnung von Komposita um? Und welche Rolle spielt der Benutzer bei der Erschließung der Bedeutung neuer Wortbildungen? Anhand eines detaillierten Vergleichs verschiedener Wörterbücher werden die Stärken und Schwächen der lexikographischen Praxis aufgezeigt und konkrete Empfehlungen für eine benutzerfreundlichere und wissenschaftlich fundiertere Gestaltung von Wörterbüchern gegeben. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für deutsche Sprache, Linguistik, Lexikographie und die Geheimnisse des Wortschatzes interessieren, und bietet wertvolle Einblicke in die dynamischen Prozesse der Wortbildung und die Herausforderungen der lexikalischen Erfassung. Es regt dazu an, die Konventionen der Wörterbuchgestaltung kritisch zu hinterfragen und über die Zukunft der Lexikographie im digitalen Zeitalter nachzudenken. Eine unverzichtbare Lektüre für Sprachwissenschaftler, Lexikographen, Deutschlehrer und alle, die ihre Kenntnisse der deutschen Sprache vertiefen möchten. Die Untersuchung zeigt auf, dass die Aufnahme von Komposita in Wörterbüchern oft subjektiven Kriterien folgt und plädiert für eine stärkere Berücksichtigung der Benutzerbedürfnisse und der wissenschaftlichen Erkenntnisse der Linguistik. Das Buch schlägt konkrete Verbesserungen für die Auswahl und Anordnung von Lemmata vor, um die Benutzerfreundlichkeit von Wörterbüchern zu erhöhen und den produktiven Gebrauch der Sprache zu fördern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung der Wortbildungselemente und ihrer systematischen Erfassung in Lexika. Abschließend wird ein Wörterbuchvergleich durchgeführt, um die theoretischen Erkenntnisse zu überprüfen und die praktische Relevanz der vorgeschlagenen Verbesserungen zu demonstrieren.
Katja Thrum
Komposita und Wörterbuch
1 Einleitung
Den größten Beitrag zur Gesamtheit der Wortbildungen leisten die Zusammensetzungen, darunter vor allem die Nominalkomposition, der rund zwei Drittel des Wortschatzes zu verdanken sind (größtenteils Substantivkomposita).[1] Die Grenzen zwischen Grammatik und Lexikon sind fließend, somit wirft sich die Frage auf, ob die Wortbildung als Teil des Regelsystems der Grammatik betrachtet werden kann, oder ob sie auf Grund ihrer nicht ausreichenden Regelmäßigkeit dem Lexikon zugeordnet werden muß[2]. Die Zahl der in Lexika aufgenommenen Komposita ist groß, und doch begegnet man täglich in gesprochener und geschriebener Sprache Zusammensetzungen, die man vergeblich in den Wörterbüchern sucht.
2 Komposita
Zusammensetzungen (Komposita) sind Wörter, die ohne zusätzliche Ableitungsmittel aus zwei oder mehreren selbständig vorkommenden Wörtern gebildet sind. Der erste Bestandteil stellt hierbei das Bestimmungsglied dar, während der zweite Teil als Basis fungiert und die Wortart der Zusammensetzung festlegt. Komplexere Komposita lassen sich weiter aufgliedern, wobei das Bestimmungswort häufiger mehrgliedrig ist als die Basis[3].
2.1 Kopulativzusammensetzungen
Unter Kopulativkomposita versteht man Zusammensetzungen, deren beide Glieder der gleichen Bezeichnungsklasse angehören und gleichrangig sind, so z.B. Hemdbluse oder Ofenkamin. Ihre Reihenfolge kann man theoretisch vertauschen. Dies geschieht in der Praxis öfter in Ausdrücken der Mode oder in der Werbung: Hosenrock - Rockhose, Uhrenradio - Radiouhr. In der Alltagssprache jedoch herrscht ohne Zweifel die Zusammensetzung vom Typ des Determinativkompositums vor [4] .
2.2 Determinativzusammensetzungen
Hier legt die Reihenfolge der einzelnen Bestandteile fest, welche Bedeutung näher bestimmend ist. Beim Pferderennen gibt das Bestimmungswort an, um welche ,,Art" der Gattung Rennen es sich handelt, und bei Rennpferd, von welcher ,,Art" von Pferd man spricht. Würde man die Glieder der Zusammensetzung vertauschen, führte dies zu ganz anderen Bedeutungsbeziehungen, vgl. Glashaus - Hausglas, Kundentelefon - Telefonkunden, Wandregal - Regalwand [5] .
2.3 Ad hoc-Bildungen
Ad hoc-Bildungen, auch Gelegenheitsbildungen oder potentielle Komposita genannt, sind Wortbildungen, die in einer Situation oder in einem Text gemäß den Regeln neu gebildet werden, deshalb noch nicht lexikalisiert sind und ggf. auch nicht in den Wortschatz übernommen werden. Davon abzugrenzen sind Neologismen, ebenfalls neue Wörter also, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in Gebrauch genommen und von der Sprachgemeinschaft als neu empfunden werden. Meist handelt es sich dabei um Wortbildungen, die Neuartiges benennen, z.B. Muttertag oder Ozonloch.
3 Komposita im Sprachgebrauch
Komposita in unserem Sprachgebrauch können entweder aus dem Lexikon entnommen (lexikalisierte Komposita) oder ad hoc gebildet worden sein (potentielle Komposita). Im letzten Fall bilden sie entweder eine ,,Einheit auf beschränkte Dauer" oder sie werden in das Wörterbuch aufgenommen. KÜRSCHNER identifiziert lexikalisierte Komposita mit Hilfe eines Tests: seine Untersuchung basiert auf dem Satztyp ,,(Ein-) AB sei (ein) B", wobei A dem Bestimmungswort und B der Basis der Zusammensetzung entspricht[6]. Trifft diese Aussage für ein Kompositum zu, so kann sich der Adressat, der mit dieser Wortbildung konfrontiert wird, die Bedeutung derselben selbst erschließen; ein Eintrag ins Lexikon, vorausgesetzt die Einzelbestandteile fanden Einzug in das Wörterbuch, erübrigt sich somit. Komposita lassen mehrere Deutungen zu. Allein Simplica wie tragen, die häufig zur Wortbildung verwandt werden, besitzen schon mehrere Interpretationsmöglichkeiten (z.B. Hosenträger, Leitungsträger...). Weiterhin läßt sich beispielsweise Holzkiste entweder als Kiste, welche aus Holz besteht, interpretieren oder aber als Kiste, in welcher Holz aufbewahrt wird, Geburtstag nicht nur als ,,Tag, an dem man geboren ist", sondern auch als ,,jährliche Wiederkehr, die mit Feier und Geschenken verbunden ist"[7]. Bei häufigerem Gebrauch in einem bestimmten Zusammenhang mag sich eine der möglichen Interpretationen durchsetzen, was jedoch andere Verwendungen nicht ausschließen muß. Die jeweils genau zutreffende Perspektive und damit die Funktion der einzelnen Glieder im Kompositum bestimmt wohl erst der Gebrauch der Komposita im Kontext oder in der Sprechsituation.
Seppänen unterscheidet zwischen ,,parole-Komposita" und ,,langue-Komposita", wobei parole-Komposita den ad hoc-Bildungen und langue-Komposita den lexikalisierten Komposita entsprechen. Von Parole-Komposita, so Seppänen, müßte man eigentlich behaupten, daß die Zahl ihrer Bedeutungen - betrachtet man die neue Wortbildung separat - völlig unbegrenzt sei. Da sie jedoch spontan im Sprachgebrauch gebildet werden, sind sie in einen Zusammenhang eingebunden und besitzen im Gegensatz zu den langue-Komposita immer nur eine Bedeutung.[8] Doch, so möchte ich meinen, besitzt ein lexikalisiertes Kompositum ebenfalls nur eine Bedeutung, sobald man es in einem Textzusammenhang betrachtet, und ein parole-Kompositum gelangt zu einer höheren Anzahl möglicher Bedeutungen, falls es öfter im Sprachgebrauch verwendet wird. Seppänen zitiert hierzu H. Brekle: ,,H. Brekle meint - und das scheint die allgemeine Auffassung zu sein - die produktiven (die ad hoc gebildeten) Komposita seien ,,als im Prinzip lexikonfähige ,Wörter' erzeugt und ,,als quasi-lexikalische Einheiten behandelt"."[9] Danach wären ad hoc-Komposita langue-ähnliche Bedeutungen zuzuordnen.
Müller spricht vom ,,lexikalischen Input", der dem Benutzer als Grundlage für ,,innovativen Output" dient[10]. Zwar schränkt er diese Aussage im folgenden Kapitel etwas ein, doch gewinnt man zunächst den Eindruck, daß der Sprachanwender ausschließlich durch die Informationen, die das Wörterbuch liefert, dazu fähig sei, Komposita ad hoc zu bilden. Allein die Tatsache, daß auch Muttersprachler, die niemals ein Wörterbuch in der Hand hielten, dennoch in der Lage sind, spontan innovative Komposita zu bilden, zeigt, daß Neuentwicklungen einer Sprache durchaus ohne die Hilfe eines Wörterbuches stattfinden können, wenn nicht sogar - bezogen auf Wortbildungsprozesse - immer ohne ,,Anleitung" durch Lexika stattfinden. Bildet jemand Komposita ad hoc, so tut er dies nach vorgegebenen Strukturmustern, die er, sofern er zu der entsprechenden Sprachgemeinschaft gehört, unbewußt als Sprachregeln beherrscht. Ein Wörterbuch dokumentiert nur, hält den zu einem bestimmten Zeitpunkt und für eine bestimmte Sprachgemeinschaft geltenden aktuellen Sprachstand fest. Die spannende Frage, ob sich eine Sprache ohne die Dokumentation durch ein anerkanntes Wörterbuch auf gleichem Wege weiterentwickeln würde, wie mit derselben, möchte ich offen lassen, wie auch die Frage nach der unterschiedlichen Bedeutung eines Wörterbuches für Muttersprachler oder Zweitspracherwerber bzgl. ihrer Fähigkeit, spontan neue Komposita zu bilden.
4 Lexikalisierung von Komposita
In der Lexikonorganisation sind Makro- und Mikrostrukturen zu erkennen. Makrostrukturen existieren auf einer abstrakten Ebene und beziehen sich auf die Auswahl der Lemmata, reflektieren sich aber auch auf der lokalen Ebene der Mikrostrukturen, also der Lexikoneinträge, so z.B. bei Komposita.[11]
Unter Lexikalisierung versteht man den Prozeß, daß Wortbildungsprodukte stärker als syntaktische Konstruktionen dahin tendieren, in den Wortschatz aufgenommen zu werden.[12] Dieser Prozeß besteht aus zwei Komponenten: Speicherung und Demotivation.[13] Dabei bedeutet Speicherung, daß das betreffende Wortbildungsprodukt in den gesellschaftlichen Sprachschatz aufgenommen wurde und in der intersubjektiven Kommunikation verwendet wird. Demotivation erfaßt den Sachverhalt, daß die Funktion der unmittelbaren Konstituenten als ganzheitliches Aushängeschild für eine Klasse von Gegenständen im Vordergrund steht, nicht die interne semantische Beziehung der Konstruktionskonstituenten. Lexikalisierung und die Tendenz zur Demotivation sind in der Regel Erscheinungen, die sich gegenseitig bedingen.
G. Thiel untersuchte einen Textkorpus im Umfang von 18 Seiten einer Wochenzeitung hinsichtlich der vorkommenden Komposita.[14] Von den insgesamt 1331 Wortbildungen, waren 827 weder im Rechtschreib-DUDEN, noch in den Wörterbüchern von MACKENSEN und von WAHRIG aufgeführt. Damit enthielt der untersuchte Textkorpus 62,1% Neologismen, also Zusammensetzungen, die zwar schon sprachüblich, jedoch noch nicht im Lexikon verzeichnet sind, oder okkasionelle Zusammensetzungen (Okkasionalismen) gegenüber nur 37,9% Lexikoneintragungen. Nicht alle Okkasionalismen festigen sich im Sprachgebrauch so weit, daß sie gespeichert werden. Die Lexikalisierung hängt davon ab, ob in der Sprachgemeinschaft eine Bezeichnungsnotwendigkeit vorliegt und das Kompositum akzeptiert wird.[15] Weitere Bedingungen zur Lexikalisierung sind u.a. der Bekanntheitsgrad des bezeichneten Objekts und das Verhältnis zu konkurrierenden Bezeichnungen. Ein eindeutiges Kriterium, eine Zusammensetzung ins Wörterbuch aufzunehmen, wäre ein negativer Befund bei der Analyse ihrer einzelnen Bestandteile, falls also deren Bedeutungen nicht mehr oder nur zum Teil bestimmend sind für den Gebrauch der Bildung insgesamt. Häufig begegnet man Zusammensetzungen, deren Ausgangswörter im Wörterbuch vorkommen, deren Inhalt jedoch nicht mehr mit ihnen wiederzugeben ist wie beispielsweise Jungfrau, Junggeselle, Armbrust, Schreckschraube. Viele Zusammensetzungen wie diese haben sich verglichen mit der Ausgangssituation so weit verselbständigt, daß sie sich allein aus ihr nicht mehr erklären lassen. Man sieht sie nicht nur als lexikalisierte, sondern auch als feste Bestandteile unseres Wortschatzes an. Noch einen Schritt weiter auf dem Weg von der Zusammensetzung zum einfachen Wort ist z.B. die Bildung Jungfer, bei der man heute kaum noch erkennen kann, daß es sich um eine alte Zusammensetzung handelt.[16]
4.1 Auswahl der Lemmata in Wörterbüchern
Die Entscheidung darüber, welche Wortbildungen in ein Wörterbuch aufgenommen werden sollen, hängt zunächst von der angestrebten Gesamtzahl der Eintragungen ab. Mit der Gesamtzahl der Stichwörter steigt in der Regel nicht nur die absolute Zahl der verzeichneten Wortbildungen, sondern auch ihr prozentualer Anteil. Dies gilt insbesondere für Zusammensetzungen, die im Deutschen den produktivsten Bereich der Wortbildung ausmachen. So sind im Buchstaben J beim TASCHEN-WB DT- POLN (mit rund 12000 Stichwörtern) über die Hälfte der Einträge Simplica und weniger als ein Viertel Komposita; beim GROSSEn WB DT-RUSS (mit rund 160000 Stichwörtern) verhält es sich gerade umgekehrt[17].
Zwischen der Gesamtzahl der Stichwörter und dem Umfang des Wörterbuchs besteht kein unmittelbarer Zusammenhang. Daß man etwa in ULLSTEIN und WAHRIG-dtv wesentlich weniger Einträge (und speziell weniger Komposita) findet als in PEKRUN oder HERDER, liegt nicht an dem verfügbaren Platz, sondern an bewußten lexikographischen Entscheidungen.
Im GRIMMschen Wörterbuch sind alle Komposita des deutschen Wortschatzes nach bestem Wissen und Gewissen ,,so vollständig wie möglich" aufgeführt. Eine andere mögliche Entscheidung zur Auswahl der Komposita besteht z.B. in der Weise, wie im PAULschen Wörterbuch verfahren wird.[18] Hier werden zur Veranschaulichung eine Anzahl regelmäßiger Ableitungen und Zusammensetzungen aufgeführt, ohne daß ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird.
Grimm unterscheidet zwischen eigentlichen und uneigentlichen Komposita.[19]
Zusammensetzungen sind uneigentlich, wenn sie mit einem Fugenelement gebildet wurden, z.B. Pfau en auge im Ggs. zum eigentlichen Kompositum Kochtopf. Solche uneigentlichen Komposita bewertet er als negativ, da sie in vergangenen Zeiten noch getrennt geschrieben wurden, und bezeichnet das Zusammensetzen solch freier Fügungen als zu Komposita ,,verknöchert". Weiterhin schreibt Grimm:
,,[...] die aufzählung solcher zusammensetzungen im wörterbuch zeugt von keinem reichthum unserer sprache, blosz von einem zwang, der ihrer syntax angethan wird." (1854, Sp.XXV)[20]
,,Das allein richtige verfahren für das wörterbuch wird sein, dasz es allen gangbaren und geläufigen, an sich auch günstigen und treffenden bildungen [...] einlasz gewähre [...]
Insgemein aber hat es vielmehr den ableitungen als den zusammensetzungen, vielmehr den einfachen wörtern als den abgeleiteten nachzustreben. [...] Jedes einfache wort wiegt an gehalt fünfzig ableitungen und jede ableitung zehn zusammensetzungen auf."[21]
Grimms Gewichtung gilt vorrangig also den Simplica, vor den Ableitungen und den Zusammensetzungen, die an letzter Stelle stehen. Der Tendenz des deutschen Wortschatzes, immer längere Komposita zu bilden, wird Grimm damit nicht gerecht. Kein Wunder, denn diese kritisiert er heftig:
,,Erst im nhd. finden sich zuweilen solche decomposita: erd-beer-kalt-schale, [...] rhein-schiff- fahrts-central-commission, general-feld-zeug-meister, ober-hof-marschall-amt, geschmacklose unformen, deren die poesie und reine prosa enträth;"[22]
Und tatsächlich tauchen in den sechs bis 1930 erschienenen Bänden des GRIMMschen Wörterbuchs nur wenige und wenn, dann fast immer zweigliedrige Komposita auf. Mehrgliedrige erhalten so fast nie einen eigenen Eintrag, werden jedoch inkonsequenterweise in Erklärungen anderer Lemmata verwendet. So findet beispielsweise die Zusammensetzung Stuhlmachermeister in der Erklärung für Stuhlmeister Einzug ins Wörterbuch, doch wird sie nicht als eigenständiges Lemma aufgeführt.
Eine Innovation führt das Wörterbuch ab 1930 ein: am Ende eines Wortartikels steht nun eine besondere Abteilung ,,Compositionsgebrauch und -typen".[23]
Offen bleibt nur, ob man aus diesem Sachverhalt nun ableiten könnte, daß im Laufe der letzten 200 Jahre die Bildung von drei- oder mehrgliedrigen Substantivzusammensetzungen zugenommen hat oder daß lediglich immer mehr dieser Wortbildungen ins Wörterbuch aufgenommen wurden.
4.2 Artikelaufbau lexikalisierter Komposita
Da die Bestandteile von Komposita in einigen Eigenschaften mit den entsprechenden Simplica übereinstimmen, sind die Angaben bei Komposita i.d.R. fast durchweg von geringerem Umfang. Z.B. werden in ULLSTEIN Komposita nur dann mit Ausspracheangaben versehen, wenn die Betonung ,,von der üblichen Anfangsbetonung abweicht"[24], während Ableitungen diese durchweg erhalten. Das Auffinden der vom Benutzer gesuchten Information wird erschwert, denn sie steht nicht direkt beim Stichwort.
Assimilationsvorgänge wie bei der Aussprache des ersten ,s' in Aussprache kommen somit ebenfalls nicht zum Ausdruck.
Etymologische Hinweise zu Komposita werden in DUDEN-GWB und BROCKHAUS- WAHRIG nur gelegentlich gegeben, während sie bei Simplica immer genannt werden.
Auch hier läßt sich das Bedürfnis des Benutzers, direkt beim Stichwort sämtliche Informationen zu erhalten, schlecht mit dem Streben nach Ökonomie der Wörterbuchmacher vereinbaren.
5 Kritik an der Auswahl der Lemmata
Die folgende Kritik bezieht sich im Wesentlichen auf 17 von Mugdan untersuchte Wörterbücher.
Die meisten Wörterbücher bemühen sich um Quantität und legen dafür weniger Wert auf viel Information beim Einzelstichwort. Als erstrebenswert erscheint es, "den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache mit allen Ableitungen und Zusammensetzungen so vollständig wie möglich" zu erfassen, wie es im Vorwort von DUDEN-GWB heißt. Nicht erwähnt wird, daß dieses Ziel völlig unerreichbar ist. Dagegen die ehrliche Aussage Jacob Grimms:
"Die zusammensetzungsfähigkeit unserer sprache (...) ist so unermeszlich, dasz sich lange nicht alle hergebrachten, geschweige alle möglichen wortbildungen anführen lassen."[25]
Die Auswahl der Lemmata kann nur teilweise durch ihre Häufigkeit erklärt werden. Anscheinend entscheiden eher intuitive Urteile der Wörterbuchmacher - wie in allen Bereichen der Lexikographie, so Mugdan[26] -, ob sich ein Wort als "wörterbuchwürdig" erweist, statt Ergebnisse empirischer Forschung. Die Aufnahmeprinzipien bei KLAPPENBACH/STEINITZ lauten: "Aufgenommen sind alle Komposita, die als Ganzes einen neuen Bedeutungsgehalt bekommen haben, der aus den einzelnen Teilen nicht zu erschließen ist (z.B. Adamsapfel, Goldjunge). Es werden auch alle diejenigen aufgeführt, die wohl inhaltlich keine Schwierigkeiten bieten, die aber durch ihre Häufigkeit zum festen und typischen Wortschatz unserer Sprache gehören (z.B. Achsenbruch, Bühneneingang, Sporthemd). Ableitungen, die zwar gebildet werden können, aber kaum üblich sind, werden nicht aufgenommen (z.B. Abschickung, Allmählichkeit)." Während es bei ULLSTEIN heißt: "Zusammensetzungen, deren Bedeutung aus den aufgelösten Teilen eindeutig hervorgeht, wurden im allgemeinen weggelassen und nur dann gebracht, wenn besondere Gründe (z.B. semantischer Art) dies erforderten." Für DUDEN-GWB ist die Semantik ohne Bedeutung: "Das Wörterbuch will den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache vollständig erfassen. Es berücksichtigt aber nicht Individualsprachliches und keine Augenblicks- oder Situationsbildungen, d.h. Wörter, die jederzeit gebildet werden können, aber nicht fester Bestandteil unseres Wortschatzes sind, z.B. Autohimmel..." Einige Wörter kommen nicht als Lemma im Wörterbuch vor, werden jedoch im selben Wörterbuch zur Erklärung eines anderen Stichworts herangezogen. Z.B.: Lernjahr ist bei Mackensen in der Erklärung von Wanderjahre zu finden, wird aber im selben Wörterbuch nicht aufgenommen. Etymologische Hinweise zu Komposita sind in DUDEN-GWB und BROCKHAUS- WAHRIG in der Regel nicht vorgesehen und finden sich nur gelegentlich (etwa bei Jakobslilie, Jakobsmuschel, Johannisbeere, Johannisbrot...), während die Etymologie bei Simplica stets genannt wird. Lediglich ULLSTEIN macht immer eine etymologische Angabe.
Es ist weiterhin auffällig, daß in manchen Wörterbüchern bestimmte Wortbildungen ohne jegliche semantische Information in Erscheinung treten, also als sogenannter "Wortfriedhof".
Ziel eines Wörterbuches sollte es sein, den Wörterbuchbenutzer in Verbindung mit den Regeln der Grammatik beim produktiven Gebrauch der Sprache zu unterstützen. Worauf dabei letztlich die Wörterbuchwürdigkeit eines Wortes beruht und wo die Grenzen zwischen Grammatik und Lexikon verläuft, scheint unklar. Dabei verfahren Wörterbücher bei der Aufnahme von Komposita sehr unterschiedlich[27]. Vermeiden sollte ein Wörterbuchverfasser ebenfalls die Vermischung von der Bedeutung eines Wortes mit enzyklopädischen Informationen.
In einer Untersuchung einsprachiger Wörterbücher fordert Motsch, Bildungsprinzipien, v.a. Wortbildungsregeln herauszustellen. Dieses Ziel wird von den meisten untersuchten Werken nicht verfolgt.[28] So wird im Artikel Säugling im WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE, das Motsch für eines der ,,vollständigsten und lexikologisch fundiertesten" hält, angegeben: ,,Kind im ersten Lebensjahr". Somit wird kein Bezug zum Verb saugen hergestellt. Zu überlegen wäre, ob man Worbildungsregelmäßigkeiten ebenfalls in ein Lexikon aufnehmen sollte, um sich so Bedeutungsbeschreibungen von Komposita, bei denen ein Wortbildungsmuster noch erkennbar ist (im Ggs. zu Komposita wie Ohrfeige, Brombeere...) durch Verweise auf eine Wortbildungsregel zu sparen.[29] Dies würde jedoch wiederum höhere Anforderungen an den Benutzer eines Wörterbuches stellen.
6 Möglichkeiten zur Auswahl und Anordnung der Lemmata
Wie ein Wörterbuchunternehmen bei der Auswahl und Anordnung der Komposita verfahren sollte, stellt Mugdan anschaulich dar. Vorwiegend an seinen Vorschlägen lehne ich mich im Folgenden an.[30] Für zu umfangreich und für den Benutzer verwirrend halte ich Müllers Vorschlag, daß jeder Bildungstyp etliche Beispiele nichtlexikalisierter Wörter zum Illustrieren enthalten sollte[31], denn so nähme der Benutzer tatsächlich ein Werk gleich eines Wortfriedhofes zur Hand; ein bis zwei bereits fest lexikalisierte Wörter des zu veranschaulichenden Typs sollten als Leitmuster genügen.
Auch sollten Wörterbuchdefinitionen bestrebt sein, in einer Sprachgemeinschaft gültige Werte zu beschreiben, wo solche vorliegen.[32]
6.1 Empfehlungen zur Auswahl der Lemmata
Ausgehend von einem ausreichend großen und repräsentativen Textkorpus sollte eine Wortbildung nur aufgenommen werden, wenn sie in diesem Korpus mit einer bestimmten Mindesthäufigkeit, die von der geplanten Gesamtlemmazahl abhängt, vorkommt, und auch nur dann, wenn die angegebenen Informationen über Banales hinausgeht. Sollte ein Kompositum diesen Anforderungen nicht genügen, müßte es auf seine Semantik hin untersucht werden und abhängig davon unter Umständen doch Einzug ins Wörterbuch finden. Den Versuch, Abstufungen der Durchsichtigkeit von Wortbildungen genauer zu beschreiben als es bis zum damaligen Stand der Forschung geschehen war, unternimmt Püschel im Jahre 1978. Seine Überlegungen faßt er schematisch in einer Tabelle zusammen.[33] Daraus geht hervor, was mir sehr vernünftig erscheint, daß er Komposita, die inhaltsseitig und ausdrucksseitig den vollen Grad der Durchsichtigkeit besitzen, für nicht lexikalisierenswert hält.
Desweiteren könnte man eine Probantenbefragung durchführen, um festzustellen, welche Komposita besonderer Erläuterung bedürfen.
6.2 Empfehlungen zur Anordnung der Lemmata
Verweise in einem Wörterbuch erschweren dem Benutzer die Handhabung. Deshalb plädiere ich für so wenig Verweise wie möglich. Oft nimmt ein Verweis sogar mehr Platz ein als die Information, auf die verwiesen wird, selbst. Ableitungen und Zusammensetzungen sollten in ihrer Beschreibung, also bzgl. Aussprache, grammatischer Angaben, Etymologie etc., mit jener der Simplica übereinstimmen. Um dem Benutzer zu verdeutlichen, nach welchen Regeln ein Zusammensetzung gebildet wurde, sollten in einer Paraphrase die einzelnen Bestandteile des betreffenden Stichwortes aufgeführt werden. Weiterhin sollte die Bedeutungserklärung von sämtlichen enzyklopädischen Angaben frei sein und die gegebenen Informationen zumindest die Bedeutungen umfassen, die der Zusammensetzung im untersuchten Textkorpus zu Grunde liegen. Mugdan schlägt u.U. eine Angabe der morphologischen Struktur von Wortbildungen vor, je nachdem welche Entscheidungen über die Anordnung der Lemmata und über die Aufnahme von Wortbildungselementen getroffen werden[34]. Inhaltlich gesehen bestünde dabei die Wahl zwischen einer vollständigen Zerlegung des Kompositum oder einer Zerlegung in die unmittelbaren Konstituenten. Formal betrachtet zwischen der Möglichkeit, die Zerlegung schon im Lemma selbst zu kennzeichnen und jener, das Lemma nochmals zu wiederholen, wobei der letztere Vorschlag aus Gründen der Ökonomie wohl eher wieder verworfen würde.
Wie sollten sich die Zusammensetzungen in die allgemeine Anordnung eines Wörterbuchs eingliedern? Denkbar wäre eine Anordnung in Wortfamilien oder eine Anordnung in Wortnestern. Solch eine Lösung würde dem Benutzer jedoch das Auffinden des gesuchten Wortes erschweren. Deshalb schließe ich mich Mugdans Vorschlag[35] an, sämtliche Lemmata streng alphabetisch zu sortieren. Zusammenhänge, die durch eine solche Anordnung möglicherweise verlorengehen, lassen sich anderweitig verdeutlichen, so z.B. durch Hinweise auf einzelne Wortbildungselemente im etymologischen Teil des Lemmaartikels, durch Verweise auf eigene Artikel von einzelnen Kompositionsteilen, die häufiger zur Wortbildung verwendet werden oder durch Überblicksartikel zu manchen Wortfamilien oder Querverweise zwischen Wörtern einer Familie. Am benutzerfreundlichsten wäre eine Anordnung, in der jedem Lemma eine eigene Zeile zukommen würde und die Bestandteile der Komposita - statt durch Tilde ersetzt - ausgeschrieben werden würden. Leider verstößt diese Anordnung gegen Grundsätze der Ökonomie und würde wohl an ,,Platzverschwendung" grenzen. So muß der Wörterbuchmacher auf dem schmalen Pfad zwischen Benutzungskomfort und Wirtschaftlichkeit wandeln.
6.3 Empfehlungen zur Aufnahme von Wortbildungselementen
Durch die Aufnahme von Wortbildungselementen kann ein Wörterbuch eigentlich nur gewinnen, sofern die Bedeutung dieser Elemente tatsächlich klar dargestellt werden kann. Die Berücksichtigung der Wortbildungsmittel sollte ebenfalls von einer gewissen im Textkorpus auftretenden Mindestanzahl abhängig gemacht werden. Daß sie nicht vom Umfang eines Wörterbuches bestimmt werden muß, zeigt die unterschiedliche Handhabung in einbändigen Wörterbüchern wie der Sprach-BROCKHAUS und HERDERs Sprachbuch.[36] Im WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE beispielsweise kann man im Artikel ,,-wesen" deutlich erkennen, daß dieses Element als suffixähnliches Wortbildungsmittel zwischen Kompositionsglied und Suffix eingeordnet wird.[37] Solche Informationen können die Qualität eines Wörterbuches nur noch steigern.
7 Praktischer Teil der Arbeit - ein Wörterbuchvergleich
In den nun folgenden Ausführungen möchte ich die Ergebnisse eines kurzen synchronen Vergleiches zwischen den beiden allgemeinen Einbändern BERTELSMANN- Rechtschreibewörterbuch (1996) - der Nachfolger von KNAURS Rechtschreibung - und dem DUDEN-Rechtschreibewörterbuch (1996) und eines diachronen Vergleiches zwischen dem genannten DUDEN und dem DUDEN aus dem Jahre 1949 darstellen. Bei empirischen Untersuchungen über die Aufnahme und Behandlung von Komposita in Wörterbüchern muß die in zweiten Kapitel angegebene Definition noch weiter differenziert werden. Festzulegen ist zunächst, ob ein Kompositionsglied schon zu einem Suffix übergegangen ist. Der Wörterbuchverfasser H. Paul (1920) betrachtet ,,die aus selbständigen Wörtern entstandenen - tum, -schaft, -heit" als Ableitungsuffixe und ist der Meinung, daß man ein entsprechendes Sprachgefühl ,,schon für die ahd. Zeit"[38] voraussetzen dürfe. Auch Adjektive mit den Suffixen - haft, -sam, -lich, -bar ordnet er den Ableitungen zu. Fleischer definiert die Zuordnung einer Wortbildungskomponente zu Kompositionsglied oder Affix über Wortbildungsreihen[39] und dem Allgemeinheitsgrad der lexikalischen Bedeutung eines Morphems.[40] Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Kriterien läßt sich bei Komposita nachweisen. Bei ihnen tritt Reihenbildung verstärkt dann ein, wenn die unmittelbare Konstituente (Erst- oder Zweitglieder) besonders gut geeignet ist, als zweites Glied bzw. als Suffix zu fungieren. Dazu geeignet sind nach Fleischer relativ wenige, wie z.B. grund-, -gut, haupt-, -mittel, -stoff, -zeug. Diese Wörter besitzen noch eine eigene lexikalische Bedeutung. Hinzu kommen Wörter, bei denen eines der Sememe erst im zusammengesetzten Wort zu einer Verallgemeinerung tendiert. Doch solange Wörter wie Mittel, Stoff usw. auch noch frei in einer allgemeinen Bedeutung vorkommen, können sie trotz Reihenbildung nicht als Affixe bestimmt werden, so Fleischer.[41] Für die Anerkennung von Suffixen aus Wörtern, die ursprünglich einmal selbständig waren, bzw. Grundwörtern von Komposita legt er vier Bedingungen fest:[42]
- Starke Fähigkeit zur Reihenbildung bei der zweiten unmittelbaren Konstituenten.
- Gegenüber der Semantik des freien Morphems ist die Bedeutung der zweiten unmittelbaren Konstituenten stärker verallgemeinert.
- Das Verhältnis zwischen der Bedeutung der ersten Konstituenten und jener der zweiten Konstituenten unterliegt einer Verschiebung, und zwar verschiebt sich der Bedeutungskern von der zweiten auf die erste unmittelbaren Konstituente.
- Der freie Gebrauch wird zunehmend eingeschränkt, so daß eine Tendenz zur Homonymie erkennbar wird.
R. Lühr definiert ein weiteres Kriterium:[43]
- Paraphrasen, die mit der zweiten unmittelbaren Konstituenten gebildet werden, führen zu von der Wortbildungskonstruktion semantisch abweichenden Ausdrücken, da das homonyme freie Morphem eine andere Bedeutung als das gleichlautende Suffix oder Präfix hat.
Eine Entscheidung über die Art der Wortbildung, ob es sich im konkreten Einzelfall um Kompositum oder Derivat handelt, möchte ich im folgenden Wörterbuchvergleich offen lassen. In die Zählung wurden die eben aufgeführten Zweifelsfälle nicht miteinbezogen.
7.1 Ergebnis der Kompositazählung
In Anlehnung an Mugdans Untersuchung wählte ich für den Gegenstand der folgenden Auszählung ebenfalls den Buchstaben ,J', da dessen Kapitel im Wörterbuch eines der überschaubarsten ist.
Senkrecht listete ich die untersuchten Wörterbücher auf, waagrecht die Komposita-Typen. Dabei beschränkte ich mich auf vier Arten:
1. Komposita, deren Konstituenten aus zwei oder mehreren Substantiven bestehen (Jägerschnitzel, Jazzkapelle, Justizbehörde...); Konstituenten vom Typ -flugzeug, -mannschaft usw ., die in der einschlägigen Literatur als Zweifelsfälle gelten, werden als eine einzige Konstituente gezählt.
2. Komposita, deren Konstituenten aus einem Adjektiv und einem oder mehreren Substantiven bestehen (Jungtier, Junggrammatiker,...)
3. Komposita, die noch mit Bindestrich geschrieben werden (Jalta-Abkommen, Jamaika-Rum, Jesus-People-Abkommen...)
4. mehrgliedrige Komposita (Jugendwohlfahrtspflege, Johanniterunfallhilfe...)
Dabei ergibt die Summe der ersten beiden Gruppen die Gesamtzahl der ausgezählten Komposita.
Mit dem Suffix -in gebildete Feminina wie Jugendfreundin, Junggesellin... wurden nicht mitgezählt. Abkürzungen für Komposita wurden ebenfalls nicht berücksichtigt, ebensowenig wie geographische Eigennamen (Jadebusen, Jütland...).
In der folgenden Tabelle wird das Ergebnis der Auszählung deutlich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1[44][45]
7.1.1 Vergleich der Wörterbücher DUDEN-Rechtschreibung und BERTELSMANN-Rechtschreibung
Über Aufnahmekriterien von Komposita schreibt BERTELSMANN im Kapitel ,,Einführung und Regelteil":
,,Wörter von nur lokaler Verbreitung, täglich neu aufkommende Fachwörter und anderes stehen dem im Wege, vor allem aber auch die Leichtigkeit, mit der gerade unsere Sprache neue Zusammensetzungen bildet. Deshalb sind Komposita zwar in reicher Zahl aufgenommen, doch ist Vollständigkeit nicht angestrebt worden; neben ,,Verkehrsminister" bietet ,,Verkehrsministerium" keine neuen rechtschreiblichen Probleme, es kann daher entfallen."[46]
Ebensowenig, so denke ich, würde Jugendfreundschaft neben Jugendfreund neue rechtschreibliche Probleme bereiten, die jedoch beide ins Wörterbuch aufgenommen wurden - jeweils ohne etymologische Angabe. Desweiteren wurde auch Jungmann sowie
Jungmannschaft, wobei ebensowenig oder ebensoviel rechtschreibliche Probleme erkenne wie bei der Erweiterung des Wortes Minister zu Ministerium, aufgenommen.
Von Vorteil ist, wie auch bei DUDEN (1996) der Fettdruck, der bei Nestlemmata verwendet wird. Innerhalb eines Artikels werden bei BERTELSMANN durch die Einhaltung der alphabetischen Reihenfolge auch sehr entfernt verwandte Wörter abgehandelt, was den Benutzer eventuell verwirren könnte. So erscheint Jacketkrone beispielsweise nach Jackenkleid im Artikel jäck. Bei DUDEN (1996) erhält sowohl Jackenkleid wie auch Jacketkrone ein eigenes Lemma. Vorteilhaft für die Auffindung eines gesuchten Wortes ist auch der formale Aufbau bei DUDEN (1996). Mehrzeilige Lemmaartikel stehen hier eingerückt im Vergleich zum Hauptlemma.
Den Benutzer verwundern werden sicherlich einige unterschiedliche Schreibweisen in beiden Wörterbüchern. So erscheint das dem DUDEN (1996) entnommene Lemma Jaltaabkommen bei BERTELSMANN als Jalta-Abkommen. Ist DUDEN (1996) hier angesichts der Tendenz in der deutschen Sprache, ursprüngliche Bindestrich-Komposita zusammenzuschreiben, seiner Zeit voraus, oder hinkt BERTELSMANN hinterher? Auch Jujutsu wird bei DUDEN (1996) - vgl. BERTELSMANN: Jiu-Jitsu - nicht nur zusammen sondern auch völlig anders geschrieben.
7.1.2
7.1.3
8 Schlußbemerkung
Wünschenswert wäre, und hier schließe ich mich Mugdans Wunsch an, eine klare und konsequente Konzeption eines Wörterbuchs, die nicht nur der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens Genüge leistet, sondern sich auch mit den Bedürfnissen des Wörterbuchbenutzers auseinandersetzt und wissenschaftlichem Anspruch gerecht wird.
Produktive und besonders aktive Wortbildungen und Wortbildungsmittel müssen lexikographisch erfaßt werden. Auch scheint es mir ratsam, daß sämtliche Wörterbuchunternehmen statt nur zu konkurieren mehr miteinander kooperieren sollten, um z.B. Fragen des Benutzers nach der Rechtschreibung (s. Kapitel 7.1.1) einhellig beantworten zu könne. Die Gefahr dabei, daß auf Grund mangelnder Konkurrenz schließlich nur noch ein Einheitswörterbuch diverser Unternehmen auf den Markt käme, sehe ich nicht für gegeben, da die verschiedenen Wörterbuchunternehmen verschieden großen Wert auf einzelne Aspekte legen. So denke ich, sei bei größerer Kooperation die gesunde Konkurrenz zwischen den Unternehmen immer noch gewährleistet.
9 Literatur
Andersson, Sven-Gunnar: Zur Beachtung der Nominalkomposita in Grimms Wörterbuch. In: Die Brüder Grimm. Erbe und Rezeption. Stockholmer Symposium 1984. Hrsg. Von Astrid Stedje.
Fleischer, Wolfgang, Barz, Irmhild: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer, 1995².
Herberg, Dieter: Neologismen - lexikologisch und lexikographisch betrachtet. In: Sprachpflege 37. 1988. S.109-112.
Kürschner, Wilfried: Zur syntaktischen Beschreibung deutscher Nominalkomposita. Tübingen 1974, S.32-38.
Motsch, Wolfgang: Wortbildungen im einsprachigen Wörterbuch. In: Agricola, Erhard u.a. (Hrsg.): Wortschatzforschung heute. Aktuelle Probleme der Lexikologie und Lexikographie. Leipzig (Enzyklopädie). 1982.
Mugdan, Joachim : Grammatik im Wörterbuch: Wortbildung. In: Germanistische Linguistik 1-3. 1983. S.237-308.
Müller, Wolfgang: Wortbildung und Lexikographie. In: Germanistische Linguistik. H.3-6. 1980. S.153-188.
Püschel, Ulrich: Wortbildung und Idiomatik. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 6, S.151-167.
Ruiter, Vera de: Sind ,,-wesen", ,,-geschehen", ,,-bereich" und ,,-Betrieb"
Kompositionsglieder oder Suffixoide? Die Behandlung dieser Wortbildungsmittel in Wörterbüchern. In: Sprachpflege 35. 1986, S.141-143.
Seppänen, Lauri: Zur Ableitbarkeit der Nominalkomposita. In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 6. 1978. S.133-150.
Starke, Günter: Der Übergang von Kompositionsgliedern zu Suffixern im Spiegel des einsprachigen Wörterbuchs. In: Beiträge zur Phraseologie (S.115-124), Wortbildung, Lexikologie. Festschrift für Wolfgang Fleischer zum 70. Geburtstag. Rudolf Große u.a. (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 1992.
Thiel, Gisela: Die semantischen Beziehungen in den Substantivkomposita der deutschen Gegenwartssprache. In: Muttersprache 83. 1973. S.377-404.
Tossavainen, Leena: Lexikonorientierter Beschreibungsansatz der Substantivkomposita in der Gegenwartssprache. In: Phraseologie und Wortbildung - Aspekte der
Lexikonerweiterung. Finnisch-deutsche sprachwissenschaftliche Konferenz 5.-6.
Dezember 1990 in Berlin. Hrsg. Von Jarmo Korhonen. Tübingen: Niemeyer, 1992. S.143-148.
[...]
[1] Vgl. DUDEN - Die Grammatik, S.399.
[2] Vgl. Mugdan, S.240.
[3] Vgl. DUDEN - Die Grammatik, S.421.
[4] Vgl. DUDEN - Die Grammatik, S.467.
[5] Vgl. DUDEN - Die Grammatik, S.467.
[6] Vgl. Kürschner, Wilfried: Zur syntaktischen Beschreibung deutscher Nominalkomposita. Tübingen 1974,
S.32-38.
[7] Vgl. Motsch, S. 67.
[8] Vgl. Seppänen, S.147.
[9] H. Brekle, Generative Satzsemantik und Transformationelle Syntax im System der englischen Nominalkomposition, 1970, S.31. Zitiert nach Seppänen, S.149.
[10] Vgl. Müller, S.155.
[11] S. Tossavainen, S.144.
[12] Vgl. Fleischer/Barz, S.15.
[13] Vgl. Fleischer/Barz, S.16.
[14] Vgl. Thiel, S.379.
[15] Vgl. Fleischer/Barz, S.24.
[16] DUDEN - Die Grammatik, S.407.
[17] Vgl. Mugdan, S.241.
[18] Vgl. Andersson, S.92.
[19] Vgl. Andersson, S.93.
[20] zitiert nach Andersson, S.93.
[21] zitiert nach Andersson, S.94.
[22] Jacob Grimm: Deutsche Grammatik. II. Teil 1826. Zitat nach dem vermehrten Abdruck 1878; dort 911; zitiert nach Andersson, S.94.
[23] Vgl. Andersson, S.95.
[24] Zitiert nach Mugdan, S.259.
[25] Zitiert nach Mugdan, S.241.
[26] Vgl. Mugdan, S.243.
[27] Vgl. Mugdan, S.248ff.
[28] Vgl. Motsch, S.69.
[29] Vgl. Motsch, S.70.
[30] Vgl. Mugdan, S.284ff.
[31] Vgl. Müller, S.179.
[32] Vgl. Seppänen, S.142.
[33] Vgl. Püschel, S.164.
[34] Vgl. Mugdan, S.289.
[35] Vgl. Mugdan, S.290.
[36] Vgl. Müller, S.171.
[37] Vgl. Ruiter, S.141.
[38] Zitiert nach Starke, S.115.
[39] Wortbildungsreihen = Gesamtheit der Wortbildungsprodukte, die nach ein und demselben Modell gebildet sind.
[40] S. Fleischer/Barz, S.69.
[41] S. Fleischer/Barz, S.70.
[42] S. Starke, S.115f.
[43] S. Starke, S.116.
[44] Erläuterungen zur Tabelle: Subst. = Substantiv Adj. = Adjektiv mehrgl. = mehrgliedrig Bindestrich = Komposita, die noch mit Bindestrich geschrieben werden Gesamtanzahl = der ausgezählten Komposita
[45] 21. Auflage, 1996
Häufig gestellte Fragen
Was sind Komposita laut Katja Thrum?
Komposita sind Wörter, die ohne zusätzliche Ableitungsmittel aus zwei oder mehreren selbständig vorkommenden Wörtern gebildet werden. Der erste Bestandteil ist das Bestimmungsglied, der zweite die Basis, welche die Wortart der Zusammensetzung bestimmt.
Was sind Kopulativkomposita?
Kopulativkomposita sind Zusammensetzungen, bei denen beide Glieder der gleichen Bezeichnungsklasse angehören und gleichrangig sind (z.B. Hemdbluse, Ofenkamin). Die Reihenfolge kann theoretisch vertauscht werden.
Was sind Determinativkomposita?
Bei Determinativkomposita legt die Reihenfolge der einzelnen Bestandteile fest, welche Bedeutung näher bestimmend ist (z.B. Pferderennen, Rennpferd). Das Vertauschen der Glieder führt zu anderen Bedeutungsbeziehungen.
Was sind Ad-hoc-Bildungen (Gelegenheitsbildungen)?
Ad-hoc-Bildungen sind Wortbildungen, die in einer Situation oder einem Text gemäß den Regeln neu gebildet werden und noch nicht lexikalisiert sind. Sie sind von Neologismen abzugrenzen.
Was bedeutet Lexikalisierung im Kontext von Komposita?
Lexikalisierung ist der Prozess, bei dem Wortbildungsprodukte (z.B. Komposita) in den Wortschatz aufgenommen werden. Er besteht aus Speicherung (Aufnahme in den gesellschaftlichen Sprachschatz) und Demotivation (die interne semantische Beziehung der Konstruktionskonstituenten tritt in den Hintergrund).
Welche Kriterien werden für die Aufnahme von Komposita in Wörterbücher genannt?
Die Aufnahme von Komposita in Wörterbücher hängt von Faktoren wie der angestrebten Gesamtzahl der Eintragungen, der Häufigkeit des Vorkommens, dem Vorliegen eines neuen Bedeutungsgehalts, der Notwendigkeit einer Bezeichnung in der Sprachgemeinschaft, dem Bekanntheitsgrad des bezeichneten Objekts und dem Verhältnis zu konkurrierenden Bezeichnungen ab.
Wie unterschied Grimm zwischen eigentlichen und uneigentlichen Komposita?
Grimm betrachtete Komposita mit Fugenelementen (z.B. Pfauenauge) als uneigentlich und bewertete sie negativ, da er sie als "verknöchert" ansah. Eigentliche Komposita sind Zusammensetzungen ohne Fugenelemente (z.B. Kochtopf).
Welche Kritik wird an der Auswahl der Lemmata in Wörterbüchern geübt?
Kritisiert wird, dass die Auswahl der Lemmata oft auf intuitiven Urteilen der Wörterbuchmacher basiert und weniger auf empirischer Forschung. Es wird auch bemängelt, dass manche Wörterbücher Wortbildungen ohne semantische Information enthalten ("Wortfriedhof").
Welche Empfehlungen gibt es zur Auswahl und Anordnung der Lemmata in Wörterbüchern?
Empfohlen wird, dass Wortbildungen nur aufgenommen werden, wenn sie in einem repräsentativen Textkorpus mit einer bestimmten Mindesthäufigkeit vorkommen und die Informationen über Banales hinausgehen. Die Anordnung sollte streng alphabetisch erfolgen, um das Auffinden zu erleichtern.
Welche Rolle spielen Wortbildungselemente in Wörterbüchern?
Die Aufnahme von Wortbildungselementen kann ein Wörterbuch verbessern, sofern die Bedeutung dieser Elemente klar dargestellt wird. Die Berücksichtigung sollte von einer gewissen Mindestanzahl im Textkorpus abhängig gemacht werden.
Was sind die Ergebnisse des Wörterbuchvergleichs zwischen DUDEN-Rechtschreibung (1996) und BERTELSMANN-Rechtschreibewörterbuch (1996)?
Der Vergleich zeigt Unterschiede in der Anzahl der Komposita, der Aufnahmekriterien, dem formalen Aufbau der Artikel und der Schreibweise einzelner Wörter.
Welche Schlussfolgerung zieht die Autorin bezüglich der Gestaltung von Wörterbüchern?
Die Autorin wünscht sich eine klare und konsequente Konzeption von Wörterbüchern, die sowohl den wirtschaftlichen Aspekten als auch den Bedürfnissen der Benutzer und wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Sie plädiert für mehr Kooperation zwischen Wörterbuchunternehmen.
- Citar trabajo
- Katja Thrum (Autor), 1998, Komposita und Wörterbuch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97263