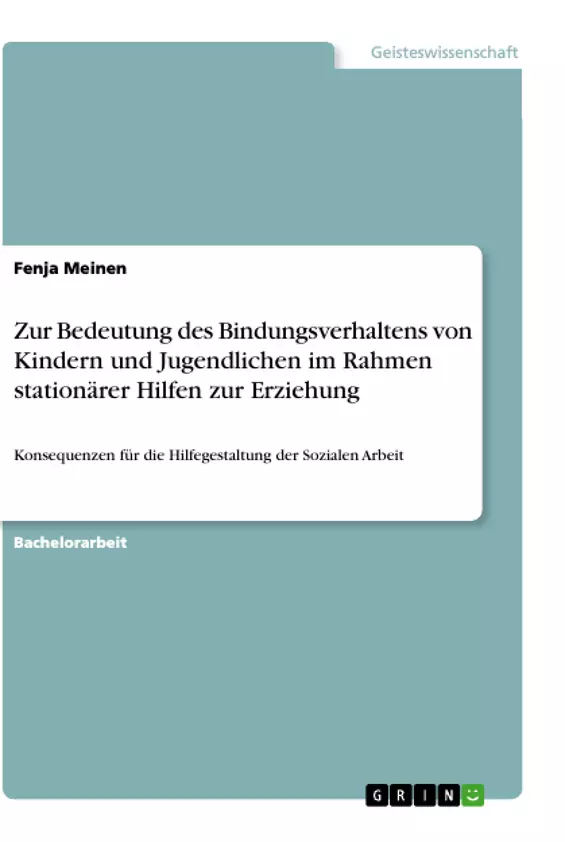Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Bindungsverhaltens im Kontext der stationären Jugendhilfe sowie den daraus resultierenden Konsequenzen der Hilfegestaltung der sozialen Arbeit. Dazu wird zunächst die Bindungstheorie von John Bowlby erklärt, die er aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen mit verhaltensauffälligen Kindern aufstellte. Zudem werden theoretische Inhalte zur Bindungstheorie sowie der stationären Jugendhilfe erläutert.
Gerade in der Heimerziehung ist die Kenntnis über Bindung und Beziehung wichtig, um das Verhalten der Kinder und Jugendlichen nachvollziehen zu können sowie dementsprechend zu handeln. Anschließend werden Bindung und Heimerziehung miteinander verknüpft und kritisch betrachtet. Die Heimerziehung hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert, doch die Rahmenbedingungen für ein gesundes Bindungsverhalten sind bis heute nicht gegeben. Es wird daher beleuchtet, welche Bedingungen sich negativ auf das Bindungsmuster der Kinder und Jugendlichen auswirken und welche Änderungen dem entgegenwirken könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen und Definitionen der Bindungstheorie
- 2.1. Begriffserklärungen
- 2.2. Die Phasen der Bindungsentwicklung
- 2.3. Die Fremden Situation
- 2.4. Das Adult Attachment Interview
- 2.5. Bindungsstörungen
- 3. Stationäre Hilfen zur Erziehung
- 3.1. Die Entwicklung der Heimerziehung seit den 60er Jahren
- 3.2. Aufgaben und rechtliche Grundlagen der Jugendhilfe
- 3.3. Betreuungsformen der stationären Jugendhilfe
- 3.4. Lebensweltorientierung und Partizipation
- 3.5. Die Hilfeplanung in stationären Jugendhilfe
- 4. Die Gestaltung der stationären Jugendhilfe im Kontext der Bindungstheorie
- 4.1. Erziehung in einer Gruppe
- 4.2. Die professionelle Beziehung
- 4.3. Anforderungen an die Qualifikation der Fachkräfte
- 4.4. Problematiken des Schichtdienstes
- 5. Bindungsarbeit im Kontext der stationären Jugendhilfe
- 5.1. Das Bezugsbetreuersystem
- 5.2. Korrigierende Bindungserfahrungen in stationären Jugendhilfen
- 5.3. Elternarbeit und Loyalitätskonflikte
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung des Bindungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen im Kontext stationärer Hilfen zur Erziehung und analysiert die daraus resultierenden Konsequenzen für die Hilfegestaltung der sozialen Arbeit. Die Arbeit beleuchtet die Bindungstheorie von John Bowlby, erklärt die Funktionsweise der stationären Jugendhilfe und untersucht, wie sich die beiden Bereiche gegenseitig beeinflussen.
- Das Konzept der Bindungstheorie und ihre Anwendung in der stationären Jugendhilfe
- Die Herausforderungen für ein gesundes Bindungsverhalten in der Heimerziehung
- Die Bedeutung von Beziehungen und Bindung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen
- Die Auswirkungen von Bindungsstörungen auf das Verhalten und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Mögliche Ansätze zur Optimierung der Hilfegestaltung in der stationären Jugendhilfe im Hinblick auf das Bindungsverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik und skizziert die Relevanz des Themas Bindungsverhalten im Kontext der stationären Jugendhilfe. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen der Bindungstheorie vorgestellt, einschließlich der Phasen der Bindungsentwicklung, der Fremden Situation und des Adult Attachment Interview. Das dritte Kapitel befasst sich mit den stationären Hilfen zur Erziehung, ihrer Entwicklung, ihren rechtlichen Grundlagen und den verschiedenen Betreuungsformen. In Kapitel vier werden die Herausforderungen der Hilfegestaltung in der stationären Jugendhilfe im Kontext der Bindungstheorie beleuchtet, einschließlich der Anforderungen an Fachkräfte und die Problematiken des Schichtdienstes. Das fünfte Kapitel diskutiert die Bedeutung der Bindungsarbeit in der stationären Jugendhilfe, insbesondere das Bezugsbetreuersystem, korrigierende Bindungserfahrungen und die Herausforderungen der Elternarbeit. Das sechste Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, stationäre Jugendhilfe, Heimerziehung, Bindungsverhalten, Bindungsstörungen, Beziehungsgestaltung, professionelle Beziehung, Bezugsbetreuung, Korrigierende Bindungserfahrungen, Lebensweltorientierung, Partizipation, Hilfeplanung, Schichtdienst, Elternarbeit, Loyalitätskonflikte, soziale Arbeit
- Citar trabajo
- Fenja Meinen (Autor), 2018, Zur Bedeutung des Bindungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen im Rahmen stationärer Hilfen zur Erziehung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/972732