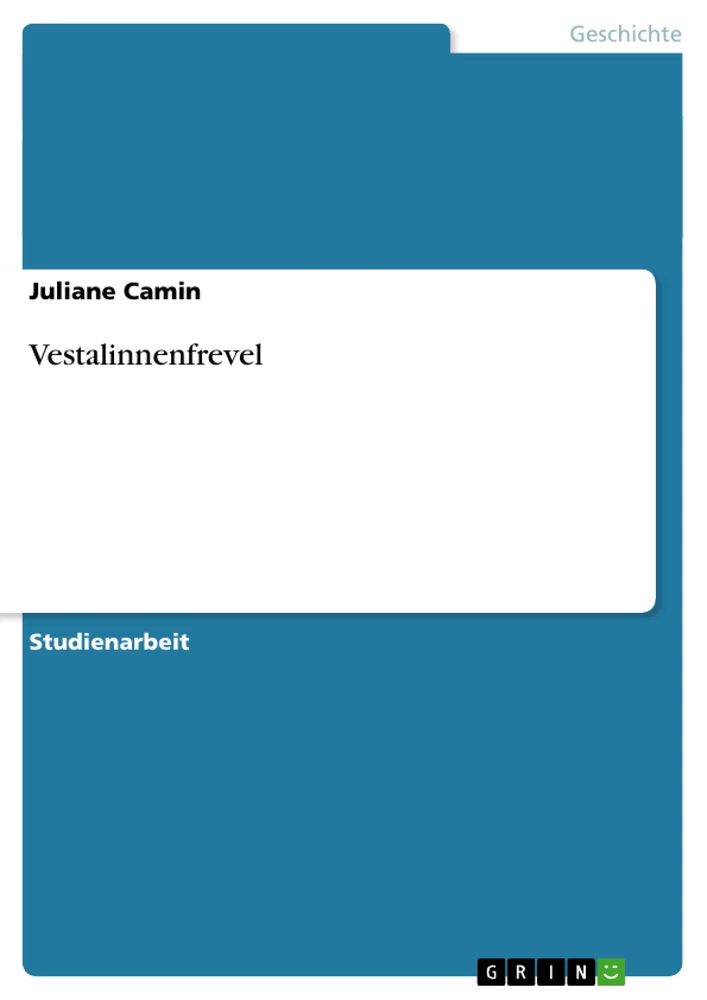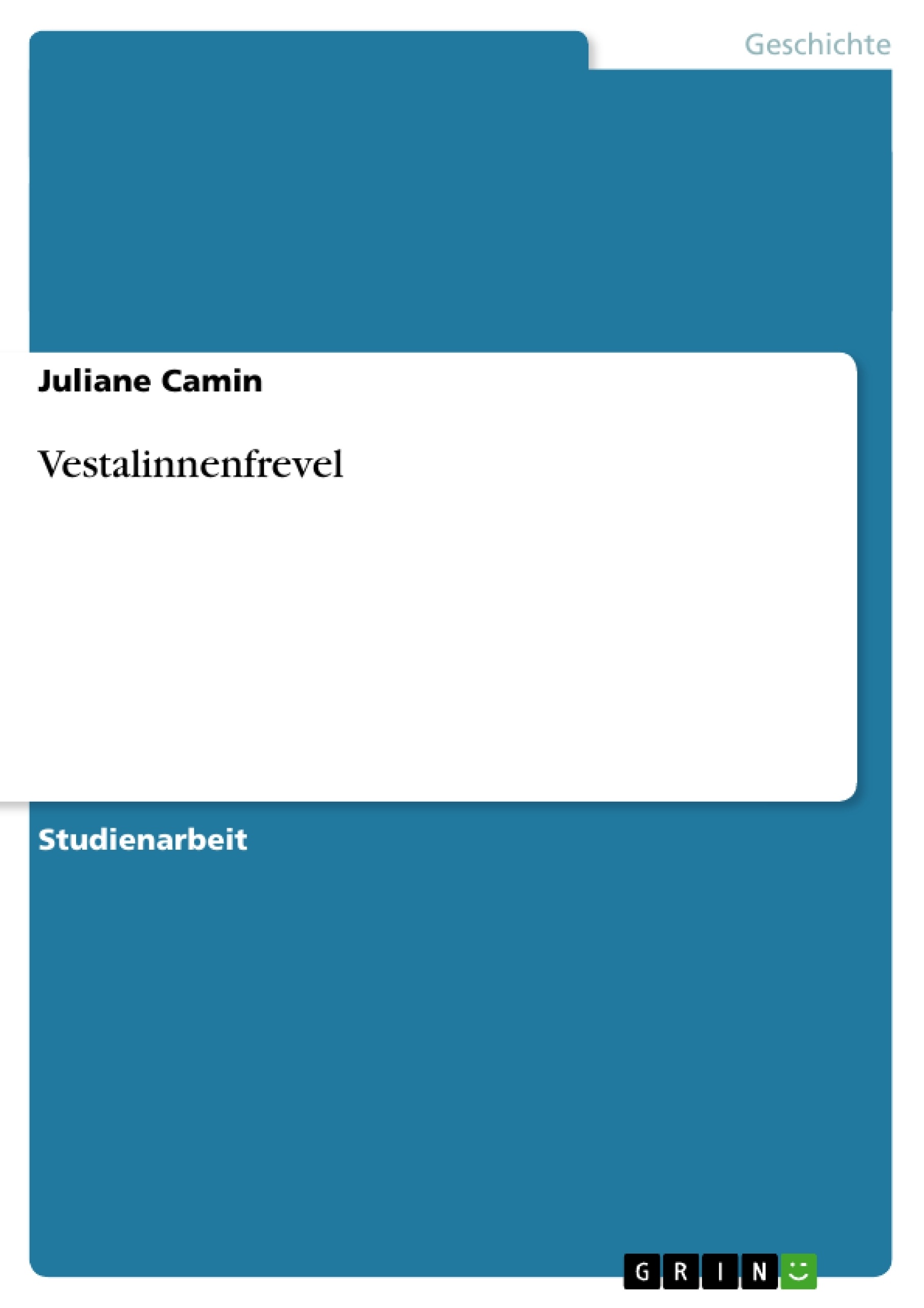EINLEITUNG
Die Verehrung und der Kult um die latinische Feuergöttin Vesta war in der römischen Antike von langer Dauer. Sie und ihre Dienerinnen, die Vestalinnen, waren bereits vor der Stadtgründung Roms 753 v. Chr. von Bedeutung und erst im Jahre 380 v. Chr. liegt die Überlieferung der letzten Vestalenoberin.1 Die Aufgabe der Dienerinnen der Vesta, eine der wichtigsten Gottheiten des römischen Staatskultes, bestand darin, das heilige Feuer,welches nie ausgehen durfte, zu unterhalten. Davon hing auf geheimnisvolle Weise das Schicksal Roms ab. Nun wäre es schon Frevel genug gewesen, wenn eine der Vestalinnen das heilige Feuer ausgehen lassen hätte, aber hier soll es um eine andere Art des Vestalinnenfrevels gehen. Die Vestapriesterinnen mussten nämlich während ihrer 30-jährigen Dienstzeit, die im Alter von 6-10 Jahren begann, jungfräulich bleiben. Doch trotz drohender Todesstrafe bei Mißachtung des Keuschheitsgebotes war es schwer, es in der annähernd tausendjährigen Geschichte des Vestalinnenordens aufrechtzuerhalten.2
Um diese „zweite“ Art des Vestalinnenfrevels soll es in der folgenden Arbeit gehen. Mit der Fragestellung, welche äußeren Umstände mit einem Vestalinnenfrevel einhergingen, wird sich das erste Kapitel des Hauptteils beschäftigen. Daran anschließend lautet die Fragestellung für das zweite Kapitel, wie bei dem Verdacht eines Vestalinnenfrevels gegen die betreffenden Vestalinnen vorgegangen wurde und welche Rolle der Pontifex Maximus, von dem die Vestalinnen unmittelbar abhängig waren3, bei diesem Vorgehen spielte. Schließlich soll es im dritten und letzten Kapitel des Hauptteils um die verschiedenen Sichtweisen der Historiker auf diese Art des Vestalinnenfrevels, des sogenannten „incestum“4, gehen. Als was betrachteten sie den Vestalinnenfrevel? Wie äußerten sie sich zu ihm und wie ist ihre Haltung zu bewerten? Dies sollen die im letzten Kapitel zu erörternden Leitfragen sein. Am Schluss der Arbeit sollen durch die Zusammenfassung sowohl die zentralen Fragestellungen der Arbeit noch einmal genannt und im Anschluss daran in knapper Form die Ergebnisse der Reflexion dargelegt werden. Damit soll ein Überblick über die gesamte Arbeit gegeben werden. Aufgrund dessen, dass zu diesem Thema relativ wenig und vor allem ältere Literatur zu finden war, wird die folgende Arbeit mit diesen Einschränkungen von den wenigen und älteren Quellen leben und dafür mehr Wert auf Analyse und Interpretation der vorhandenen Literatur gelegt werden.
ÄUßERE UMSTÄNDE EINES VESTALINNENFREVELS
Zunächst ist festzuhalten, dass ein Vestalinnenfrevel einerseits als persönliche Verfehlung einer bzw. mehrerer Vestalinnen gesehen werden kann, und andererseits als göttliche Bestimmung, die die Vestalin unweigerlich in diese Versuchung brachte, der sie sich nicht entziehen konnte.5 Für den Historiker Wissowa scheint die letztere Betrachtungsweise eher den Tatsachen zu entsprechen, da z. B., wie er schreibt, schon bei Livius der Vestalinnenfrevel eindeutig als Prodigium bezeichnet wurde: „hoc nefas cum inter tot, ut fit, clades in prodigium versum esset“6, das bedeutet als Ausdruck des aus dem Einklang gebrachten Zustandes guten Einvernehmens zwischen dem römischen Volk und seinen Göttern („pax deorum“). Alle Vorkommnisse wie ein Vestalinnenfrevel, abnorme Geburten, Blitzeinschläge an auffallenden Stellen etc., die nach allgemeinem römischen Volksglauben den „pax deorum“ beeinträchtigten, waren Prodigien und entsprangen den Launen der Götter. Ein Prodigium bedeutete nach römischer Anschauung „nie ein bestimmtes bevorstehendes Unglück, sondern [...] dass die Gemeinde sich mit Sündenschuld befleckt und nunmehr für Reinigung zu sorgen hat.“7 Zur Abwendung des angedrohten Unheils und zur Wiederherstellung des „pax deorum“, der für das römische Volk im Allgemeinen sehr wichtig war, mussten bestimmte Sühnemaß- nahmen getroffen werden. Diese Maßnahmen sollen an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden, sondern Thema des nächsten Kapitels sein. Es gab aber bei dem Vestalinnenprodigium im Gegensatz zu anderen Prodigien noch eine Besonderheit. Während Prodigien für gewöhnlich in erschreckender Weise an die Öffentlichkeit traten, ging das Vestalinnenprodigium im Verborgenen vor sich und entzog sich der allgemeinen Kenntnis. Dafür bietet das in Georg Wissowas Abhandlung „Vestalinnenfrevel“ dargestellte Vestalinnenprodigium aus dem Jahre 114 v. Chr. ein anschauliches Beispiel. „Angekündigt“ wurde es durch ein Blitzprodigium, welches die Tochter eines römischen Ritters tötete. Das Mädchen wurde daraufhin in einer anstößigen Stellung wieder aufgefunden, „mit entblößtem Unterleib und heraushängender Zunge, so daß man den Eindruck erhält, der Blitz sei durch die Geschlechtsteile in den Leib eingedrungen und habe ihn durch den Mund wieder verlassen.“8 Durch das Grausige des ganzen Vorfalls wurde das Ereignis nicht als gewöhnliches Blitzprodigium gesehen, sondern, in der Überzeugung, dass es eine besondere Bedeutung haben müsse, ein zusätzliches Gutachten der „haruspices“ (Eingeweideschauen bei Opfertieren) eingefordert. Die Wahrsagung aus den Eingeweiden verkündete einen ungeheuren Skandal für die Vestalinnen und den Ritterstand. Und wirklich deckten weitere Nachforschungen durch die Denunziation eines Sklaven einen seit langer Zeit bestehenden und weit ausgedehnten Geschlechtsverkehr von drei Vestalinnen mit einer Anzahl junger römischer Ritter auf.9 Bis zur Aufdeckung dieses Frevels folgte für Wissowa gewissermaßen ein Prodigium dem anderen. Die Eigentümlichkeit des Hergangs bezeugt nach Wissowa den bereits genannten Sonderfall, der der Vestalinnenfrevel ist, da er schon nicht in herkömmlicher Weise an die Öffentlichkeit trat. Es hat den Anschein, als ob es bei dieser Art des Vergehens besonderer Mahnungen durch die Gottheiten bedurfte, um die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auf den im Verborgenen vor sich gehenden Verfall des öffentlichen Wesens zu lenken, der sich in den Verfehlungen der Vestapriesterinnen äußerte.
Diese Verfehlungen verursachten daher eine so große öffentliche Erregung, da die gewissenhafte Amtsausübung der Vestalinnen eng an das Schicksal Roms geknüpft war. Im römischen Denken war die Tugendhaftigkeit der Frauen untrennbar mit der Wohlfahrt des Staates verbunden und in der uns überlieferten Geschichtsschreibung finden sich immer wieder Ausdrücke dieses Denkens. So sah beispielsweise Aristoteles in der Verderblichkeit der spartanischen Frauen die Ursache für den Verfall Spartas, Theopompos und Livius in dem verschwenderischen Lebenswandel der etruskischen Frauen einen wesentlichen Grund für den raschen Niedergang Etruriens und Juvenal wurde nicht müde, immer wieder die Verdorbenheit der römischen Frauen anzuprangern, die er als Symptom für den Verfall der römischen Gesellschaft betrachtete.10 Dieser enge Zusammenhang zwischen der Tugendhaftig- keit der Frauen und dem Schicksal des Staates musste für die Vestalinnen in besonderem Maße gelten. Aufgrund ihrer Jungfräulichkeit, durch die sie im Gegensatz zu den verheirateten Frauen keinem einzelnen Mann angehörten, konnten sie die ganze Gemeinschaft verkörpern.11 Somit stand und fiel mit ihrer Tugendhaftigkeit das Wohl des gesamten Staatswesen. Welche Auswirkungen das auf die Ahndungen von Vestalinnenfreveln hatte und in welcher Weise auch diese Vorgehensweisen eine Sonderstellung im Vergleich zu denen gegen andere Vergehen einnahmen; darauf wird im nächsten Kapitel näher eingegangen werden.
DIE VORGEHENSWEISE BEI VESTALINNENFREVELN
„In religiösen Fragen nahmen es die Römer peinlich genau; für Vergehen gleich welcher Art gab es kein Pardon.“12 Der Satz weist bereits deutlich auf die zu erwartenden harten Ahndungen religiöser Vergehen hin. Auf einen „incestum“ stand für die betreffenden Vestalinnen die Todesstrafe in Form des Lebendigbegrabens.13 Es wurde nun folgendermaßen vorgegangen: Der Pontifex Maximus, der über die Vestalinnen die „patria potestas“ (d. h. die Oberaufsicht, die Herrschaftsgewalt und die richterliche Gewalt) ausübte14, entschied mit seinem Pontifikalkollegium über das weitere Verfahren mit der für schuldig befundenen Vestalin. Diese gewählte Formulierung („über das weitere Verfahren entscheiden“), ist hier die wohl Unverfänglichste. In „Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft“ lautet es: „Das Ermittlungsverfahren leitet der pont. max. mit seinem Kollegium [...]“15, wodurch das Vorgehen gegen die schuldig gesprochene Vestalin als Strafprozess interpretiert wird, während Georg Wissowa in seiner Abhandlung über den Vestalinnenfrevel die Auffassung des Vorgehens auch als Sühnung des „Prodigiums Vestalinnenfrevel“ einräumt. Doch lassen wir die eingehendere Beschäftigung mit den unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten der verschiedenen Historiker für den nächsten Teil - sie seien hier nur zur Information gegeben, um zu zeigen, dass in diesem Punkt sehr entgegengesetzte und doch jeweils begründbare Betrachtungsweisen existieren, so dass man sie des Verständnisses halber, da es deshalb in den Darstellungen des weiteren Vorgehens gegen die Vestalinnen immer wieder zu konträren Aussagen kommen wird, erwähnen sollte - und bleiben wir zunächst bei der unverfänglichen Formulierung „Vorgehens- weise“. Bei einem Verdacht auf einen Vestalinnenfrevel stellte also der Pontifex Maximus zusammen mit seinem Pontifikalkollegium den Sachverhalt fest, und wenn die gegen die Vestalin erhobenen Beschuldigungen als begründet anerkannt wurden, war ihr Schicksal besiegelt. Sie wurde in einem feierlichen Begräbniszug über das Forum in den äußersten Nordosten Roms zum sogenannten „Sündenfeld“ („campus sceleratus“) geleitet, welches noch innerhalb der Stadtmauern Roms an der Porta Collina lag. Dort sprach der Pontifex Maximus mit zum Himmel erhobenen Händen noch einige letzte Gebetsformeln, bevor die Sünderin in eine für sie vorbereitete Gruft hinabstieg und die Grabkammer mit Erde zugeschüttet wurde. Sonst übliche Grabehren und Totenspenden blieben in diesem Falle versagt.16
Über das „Verfahren“ mit der schuldig gesprochenen Vestalin ist man sich bis hierher erstmal einig. Nun kommt aber der Punkt, an dem für die Mehrzahl der Historiker, die das Vorgehen gegen die Vestalinnen als Strafprozess sehen, der Fall mit der Tötung der Vestalin abgeschlossen ist, da deren frevelhaftes Vergehen nun in vorgesehener Weise bestraft worden war. Für Georg Wissowa jedoch, der die Betrachtung des „incestums“ der Vestalinnen auch als Prodigium zuließ und dem diese Möglichkeit offensichtlich auch plausibler schien als die allgemeine Auffassung17, ist der Fall des Vestalinnenfrevels mit dem Lebendigbegraben der Vestalin noch nicht beendet. Wie bereits erwähnt, nimmt die Betrachtung des Vestalinnenfrevels als Prodigium im Gegensatz zur Betrachtung als Straftat die Schuld von der betroffenen Vestalin. Sie haben nicht willentlich so gehandelt, sondern wurden unwillkürlich dazu verleitet. Nun mussten Prodigien, die ja einen verderblichen Zustand im öffentlichen Staatswesen anzeigten zunächst „beseitigt“ und dann auf irgendeine Art und Weise gesühnt werden, um den „pax deorum“ wiederherzustellen.18 So sah Wissowa in dem Lebendigbegraben der für schuldig befundenen Vestalin im Gegensatz zu den Verfechtern des Strafdeliktes einfach die Beseitigung dieses Prodigiums. Er schrieb: „Sobald im Vordergrunde nicht der Gesichtspunkt der Strafe, sondern der Beseitigung steht, ist die Erklärung für das Lebendigbegraben gegeben [...].“19 Warum aber gerade die Todesart in der Form des Lebendigbegrabens gewählt wurde bzw. warum dieses Vergehen überhaupt mit dem Tod „bestraft“ wurde, ist nicht eindeutig geklärt. Es gibt verschiedene Ansätze zur Beantwortung dieser Frage, beispielsweise, dass das römische Religions- empfinden wie ein ungeschriebenes Gesetz forderte, „dass eigentlich alle Verfeh- lungen im V.-Kulte mit dem Tode bestraft werden müssten [...].“20 Der Historiker Lugand zog in Erwägung, dass das Lebendigbegraben der Vestalin womöglich eine in früheren Zeiten Exekutionsform bei Frauen gewesen ist. Gagé und viele vor ihm sahen in dieser Todesart die Verbindung des Motivs, dass bei der Hinrichtung geweihter Personen kein Blut vergossen werden durfte, mit dem einer Weihung der lebendig Begrabenen an die Unterirdischen. Historiker wie Kristensen und Lambrechts verstanden die Vestalin als „bräutliche Magd einer Gottheit“21 und glaubten, dass sie nach ihrer Sünde in dem „unterirdischen Gemach der Verfügung ihres ‚Gatten‘ ausgeliefert“22 wurde. („Son tombeau, en réalité, était sa chambre nuptiale“23 ). Diese Fragen lassen sich nicht gänzlich beantworten, ohne dass Zweifel und Widersprüche bestehen bleiben. Festhalten lässt sich nur die Art des Todes, wobei Wissowa in seiner Abhandlung über den Vestalinnenfrevel ausdrücklich betont, dass das Verfahren gegen die des „incestums“ beschuldigten Vestalinnen, wenn man es als Strafprozess betrachtet, einen Einzelfall darstellte, da es im römischen Strafrecht keine Sakraldelikte, keine Bestrafung des Meineids oder eines gebrochenen (Keuschheits-)gelübdes, welches die Vestalinnen im übrigen gar nicht ablegten, wie er schrieb, gab. Und selbst wenn es ein solches gegeben hätte, führt er weiter aus, stand ein Kapitalverfahren wegen eines Priesterdeliktes wie im Falle des Vestalinnenfrevels im römischen Strafrecht ebenso vereinzelt da, wie die Art der Todesstrafe. Des Weiteren sei ihm auf römischem Boden kein weiteres Beispiel einer Hinrichtung durch Lebendigbegraben bekannt; selbst aus dem gesamten Altertum findet sich nur eine einzige Analogie: der Fall der Antigone in Sophokles gleich- namiger Tragödie.24 Halten wir also für dieses Kapitel soviel fest, dass das Lebendigbegraben als Form der antiken Todesstrafe etwas nur ganz vereinzelt vorkommendes war und sich dafür im antiken Strafrecht keine Erklärung findet.
Auf die Darstellung der Sühnung des frevelhaften Vestalinnenprodigiums nach Wissowa soll hier aus inhaltlichen und Platzgründen nicht näher eingegangen werden, da sie einiger nicht unmittelbar zum Thema gehörender Erläuterungen bedarf. Nachzulesen ist sie in Georg Wissowas Abhandlung „Vestalinnenfrevel“, deren vollständige Literaturangabe im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit zu finden ist.
UNTERSCHIEDLICHE BETRACHTUNGEN DER HISTORIKER
Wie im vorangegangenen Kapitel schon angedeutet wurde, gingen bzw. gehen die Auffassungen der Historiker über den Fall des Vestalinnenfrevels auseinander. Selbst Georg Wissowa, dem die Betrachtung des „incestums“ der Vestapriesterinnen als Prodigium am nahesten zu liegen scheint, räumt ein, dass „die gewöhnliche und für uns auch an sich nächstliegende Auffassung“25 ist, „daß das Verfahren gegen die Vestalin als ein Strafverfahren anzusehen sei [...]: die Entscheidung des Pontifex maximus wird als eine richterliche, die Tötung der Vestalin als Vollziehung der Todesstrafe aufgefaßt, und es besteht kein Zweifel, daß das in der historischen Zeit die Anschauung der Römer selber war.“26 Zumal die Römer sehr genau waren, was die Willenseinstellung gegenüber den römischen Tugenden und Werten und vor allem der Religiosität betraf.27 Demzufolge ist nicht anzunehmen, dass sie glaubten, die Vestalinnen hätten sich im Moment der irdischen Versuchung ihrer Sünde nicht entziehen können, sondern vielmehr, dass ihre Willenseinstellung verdorben war. Neben dem „Willensargument“ spricht noch ein weiteres Argument für die Betrachtung des Vestalinnenfrevels als Strafdelikt. Man ist sich einig, dass in historischer Zeit rein sakrale Verbrechen von der Gemeinde nicht bestraft wurden. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass mit dem Vollzug der Todesstrafe im Falle eines „incestums“ die Grenze des rein sakralen Verbrechens überschritten worden sein muss, d. h., dass die Vestalinnen nicht nur gegenüber der Gottheit, sondern auch gegenüber sich selbst und dem gesamten römischen Staatswesen gesündigt haben. Damit ist der Grund für ein Strafverfahren gegeben. Den Verteidigern des Strafverfahrens, zu denen Mommsen und Münzer zählten, sowie natürlich auch der Anschauung der Römer selbst, steht die zweite mögliche Hypothese Wissowas mit dem Vestalinnenprodigium entgegen. Diese begründet sich in dem auffälligen Zusammenfallen von Vestalinnenfreveln und der Opferung von je einem Gallier- und Griechenpaar in den Jahren 228 v. Chr., 216 v. Chr. und 114 v. Chr. bis zum Ende der römischen Republik, in denen Wissowa die bereits angesprochene Sühnung des Vestalinnenprodigiums sah. Auch argumentiert er, dass die antike Denkart durchaus auch diese Betrachtungsweise zuließ.29 Sowohl in „Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft“ als auch in Georg Wissowas Abhandlung „Vestalinnenfrevel“ sind neben den genannten Argumenten auch jeweils historische Zitate als Belege für die divergierenden Auffassungen geliefert. Von dem bereits genannten Zitat: „hoc nefas cum inter tot, ut fit, clades in prodigium versum esset“30 machten sogar gleich beide für sich Gebrauch.
Diese Ausführungen machen deutlich, dass die beiden unterschiedlichen Auffas- sungen von Vestalinnenfreveln jeweils begründbar sind und daher ihre Berechtigung haben. So sollen an dieser Stelle beide als gleichberechtigte Betrachtungsmöglich- keiten stehen gelassen werden. An diesem Beispiel ließ sich nun gut nachvollziehen, dass nicht nur eine auf den Sachverhalt existierte. Vielleicht liegt dem Vestalinnenfrevel in Wirklichkeit auch noch eine ganz andere Erklärung zugrunde. Die bisherigen Interpretationsmöglichkeiten konnten nicht alle Einzelheiten des Vestalin- nenfrevels nachvollziehbar in ihr System einbauen; es blieben immer Widersprüch- lichkeiten bestehen. In einem jedoch ist sich die Wissenschaft einig: Das Vorgehen bei einem „incestum“ ist für die antike Zeit einzigartig und nahm bzw. nimmt sowohl in der damaligen Zeit als wohl noch mehr in der antiken Geschichtsforschung eine Sonderstellung ein.
ZUSAMMENFASSUNG
Im Wesentlichen leiteten drei zentrale Fragestellungen durch die Arbeit:
- Welche äußeren Umstände gingen mit einem Vestalinnenfrevel einher bzw. welche Dinge wurden damit in Verbindung gebracht?
- Wie wurde bei dem Verdacht auf einen Vestalinnenfrevel gegen die beschuldigten Vestalinnen vorgegangen?
- Wie sind die verschiedenen Sichtweisen der Historiker auf den Fall des „incestums“?
Die Ausführung dieser Fragen im vorangegangenen Teil ergab, dass in der Forschung zum Thema „Vestalinnenfrevel“ zwei grundverschiedene Auffassungen existieren. Einerseits die herkömmliche Betrachtung des Vestalinnenfrevels als Straftat mit anschließendem Strafverfahren und andererseits die von Georg Wissowa eingebrachte Möglichkeit, den „incestum“ als Prodigium anzusehen, welches nach römischem Glauben beseitigt und anschließend durch eine entsprechende andere Maßnahme gesühnt werden musste. Das Urteil des Strafverfahrens bzw. die Beseitigung des Vestalinnenprodigiums war das Lebendigbegraben der für schuldig befundenen Vestalinnen. Da das römische Strafrecht keine Bestrafung von Sakraldelikten vorsah, wurde die Bezeichnung des Verfahrens gegen die Vestalinnen als Strafprozess so begründet, dass ein Vestalinnenfrevel kein reiner Sakraldelikt mehr sei, sondern die Vestalin ihre verdorbene Natur nicht in Grenzen halten konnte. Diese Mitschuld der Vestalin an ihrem Vergehen, von der sie im Falle eines Prodigiums völlig ausgenommen war, legitimiert die Betrachtung des „incestums“ als Strafverfahren. Ausschlaggebend für die beiden verschiedenen Sichtweisen auf den Vestalinnenfrevel war also der Wille der sündig gewordenen Vestalinnen. Es wurde schließlich festgestellt, dass die beiden Denkansätze, so unterschiedlich sie sind, plausible Begründungen und somit beide ihre Berechtigung haben. Zwar kann mit keiner der beiden Interpretationsmöglichkeiten der gesamte Hergang des Vestalinnenfrevels bis in alle Einzelheiten geklärt werden, aber dafür ist der Fall des „incestums“ aufgrund dessen, dass er nicht gänzlich zu durchschauen ist und dass er sich nicht eindeutig zuordnen lässt, wahrscheinlich etwas zu Besonderes und darüberhinaus in seiner gesamten Beschaffenheit für die antike Religion Einmaliges.
ANMERKUNGSVERZEICHNIS
Einleitung:
Äußere Umstände eines Vestalinnenfrevels:
Die Vorgehensweise bei Vestalinnenfreveln:
Unterschiedliche Betrachtungen der Historiker:
LITERATURVERZEICHNIS
Cornell, T. J.: The beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (ca. 1000-264 BC), London/New York 1995.
Dieterich, A.: Kleine Schriften, Leipzig/Berlin 1911.
Koch, C.: Vesta, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 8A, 2, 1972, Sp. 1717-1776.
Le Bonniec, H.: Vesta/Vestalinnen, in: Lexikon der Alten Welt, Bd. 3, 1990, Sp. 3220- 3221.
Pomeroy, S. B.: Frauenleben im klassischen Altertum, Stuttgart 1985.
Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/1924), S. 201-214.
[...]
1 Vgl. Dieterich, A.: Kleine Schriften, Leipzig/Berlin 1911, S. 535.
2 Vgl. Zosimos 5,38, zitiert nach: Pomeroy, S. B.: Frauenleben im klassischen Altertum, Stuttgart 1985, S. 329.
3 Vgl. Le Bonniec, H.: Vesta, in: Lexikon der Alten Welt, Bd. 3, 1990, Sp. 3221.
4 Vgl. Koch, C.: Vesta, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissen- schaft, Bd. 8A, 2, 1972, Sp. 1749.
5 Vgl. Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/ 1924), S. 209.
6 Livius 22,57,4, zitiert nach: Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religions- wissenschaft 22 (1923/1924), S. 209.
7 Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/1924), S. 208.
8 Obsequ. 37[97]/Oros. 5,15,20f./Plutarch Qu. Rom. 83, zitiert nach: Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/1924), S. 212.
9 Vgl. Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/ 1924), S. 212.
10 Vgl. Pomeroy, S. B.: Frauenleben im klassischen Altertum, Stuttgart 1985, S. 330.
11 Vgl. ebd., S. 328.
12 Pomeroy, S. B.: Frauenleben im klassischen Altertum, Stuttgart 1985, S. 329.
13 Vgl. Le Bonniec, H.: Vestalinnen, in: Lexikon der Alten Welt, Bd. 3, 1990, Sp. 3221.
14 Vgl. Cornell, T. J.: The beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (ca. 1000-264 BC), London/New York 1995, S.234.
15 Koch, C.: Vesta, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 8A, 2, 1972, Sp. 1747. Hervorhebung durch den Autor.
16 Vgl. Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/ 1924), S. 201f.
17 Vgl. ebd., S. 208f.
18 Vgl. ebd., S. 209f.
19 Ebd., S. 209.
20 Koch, C.: Vesta, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 8A, 2, 1972, Sp. 1750.
21 Ebd., Sp. 1751.
22 Ebd.
23 Lambrechts, A.: Latomus V, 1946, S. 324, zitiert nach: Koch, C.: Vesta, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 8A, 2, 1972, Sp. 1751.
24 Vgl. Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/ 1924), S. 203.
25 Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/1924), S. 202.
26 Ebd.
27 Vgl. Koch, C.: Vesta, in: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissen- schaft, Bd. 8A, 2, 1972, Sp. 1748.
28 Vgl. ebd., Sp. 1748f.
29 Vgl. Wissowa, G.: Vestalinnenfrevel, in: Archiv für Religionswissenschaft 22 (1923/ 1924), S. 207-210.