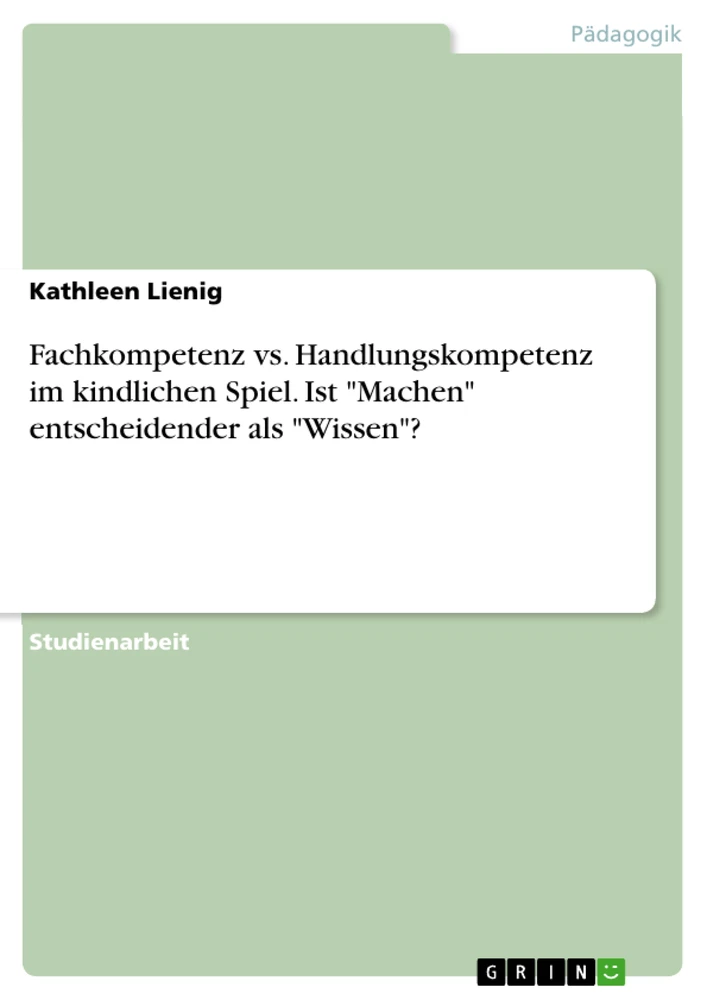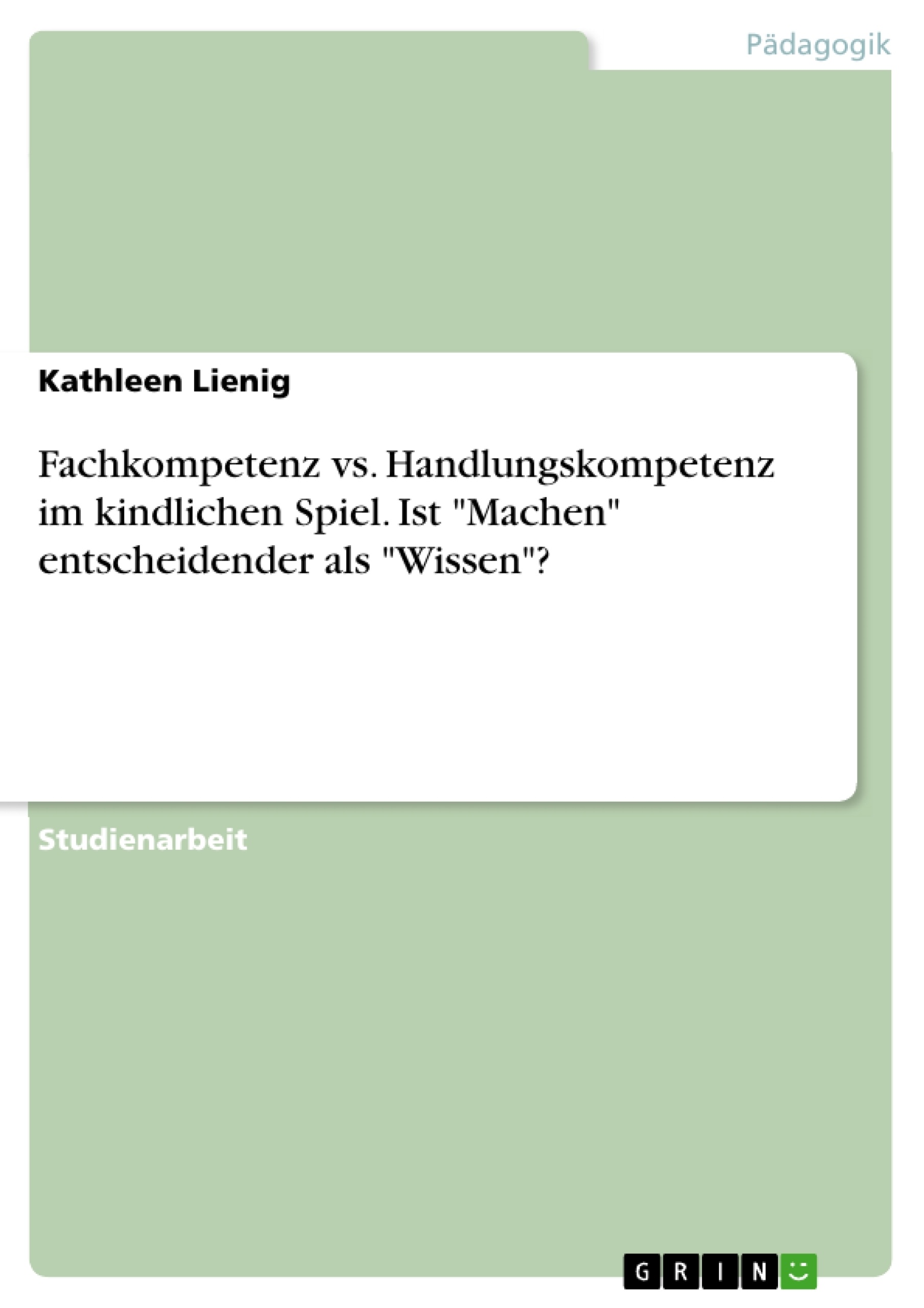Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von pädagogischen Fachkompetenzen und Handlungskompetenzen zueinander und wie diese das kindliche Spiel in der Krippe beziehungsweise im Kindergarten beeinflussen. Konkret wird die Bedeutung dieser Kompetenzen in Bezug auf die Förderung des kindlichen Spiels erforscht.
Hierbei stellen sich folgende Fragen: Welche Rolle spielt wortwörtlich das kindliche Spiel im vorgestellten Vergleich? Welche Bedeutung hat das Spiel für ein Kind und welche Rolle übernimmt die pädagogische Fachkraft? Wie viel Handeln und Wissen sind für das kindliche Spiel notwendig? Ist es "nur" eine angenehme Nebentätigkeit beziehungsweise ein automatischer Zeitvertreib im Kindergartenalltag?
Ist "Machen" entscheidender als "Wissen"? Oder bleibt es bei dem berühmten Ausspruch von Francis Bacon im Jahr 1613, "Wissen ist Macht"? Schränkt zu viel Wissen das Handeln ein? Kann ohne Wissen überhaupt gehandelt werden? Oder anders gefragt: Wenn nicht gehandelt wird, warum sollte dann Wissen bestehen? Ist das Handeln aus dem Bauch heraus Handeln ohne Wissen? Sieht die Theorie wirklich immer anders aus als die Praxis?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fach- und Handlungskompetenz
- 2.1. Kompetenzbegriff
- 2.2. Allgemeines Kompetenz-Modell nach Fröhlich-Gildhoff
- 2.3. Professionelles Handeln - Handlungskompetenz
- 3. Das kindliche Spiel
- 3.1. Formen des kindlichen Spiels
- 3.2. Die Bedeutung des Spiels
- 3.3. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft
- 4. Vergleich der Bedeutung der Fach- und Handlungskompetenz in Bezug auf die Förderung des kindlichen Spiels
- 4.1. Wie verhält sich Wissen ohne Handeln?
- 4.2. Kann ohne Wissen gehandelt werden?
- 4.3. Schränkt „zu viel“ Wissen das Handeln ein?
- 4.4. Kann Unwissen den Spieltrieb hemmen?
- 4.5. Sieht die Theorie wirklich „immer“ anders aus als die Praxis?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die relative Bedeutung von Fach- und Handlungskompetenz bei der Förderung kindlichen Spiels. Sie beleuchtet die Frage, ob "Machen" wichtiger ist als "Wissen" in diesem Kontext. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis und untersucht die Rolle der pädagogischen Fachkraft.
- Der Kompetenzbegriff und seine Facetten
- Das allgemeine Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff
- Die Bedeutung des kindlichen Spiels für die Entwicklung
- Der Einfluss von Fach- und Handlungskompetenz auf die Spielförderung
- Der Vergleich von Theorie und Praxis im Kontext der Spielpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung wirft zentrale Fragen zur Bedeutung von Fach- und Handlungskompetenz in der Förderung des kindlichen Spiels auf. Sie stellt den Vergleich zwischen "Wissen" und "Handeln" in den Mittelpunkt und hinterfragt die Rolle des Spiels im pädagogischen Kontext. Die Arbeit kündigt die Untersuchung des Zusammenspiels von pädagogischer Fach- und Handlungskompetenz und deren Einfluss auf das kindliche Spiel an.
2. Fach- und Handlungskompetenz: Dieses Kapitel definiert den Kompetenzbegriff und erläutert das allgemeine Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff. Es differenziert zwischen Fachkompetenz (theoretisches Wissen) und Handlungskompetenz (praktische Fähigkeiten) und legt den Grundstein für die spätere Analyse ihrer Bedeutung im Kontext des kindlichen Spiels. Die Vielschichtigkeit des Kompetenzbegriffs wird anhand verschiedener Definitionen aus der Literatur herausgearbeitet.
3. Das kindliche Spiel: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Formen des kindlichen Spiels (Exploration, Funktions-, Symbol-, Konstruktions- und Rollenspiel) und erläutert deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung. Es betont die Rolle der pädagogischen Fachkraft bei der Gestaltung und Förderung des Spiels. Der Abschnitt untersucht, wie Spiel die Entwicklung eines Kindes auf vielseitigen Ebenen positiv unterstützt und welche Funktionen es für Kinder erfüllt.
4. Vergleich der Bedeutung der Fach- und Handlungskompetenz in Bezug auf die Förderung des kindlichen Spiels: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und vergleicht die Bedeutung von Fach- und Handlungskompetenz für die Spielförderung. Es untersucht verschiedene Aspekte: die Bedeutung von Wissen ohne Handeln, die Möglichkeit des Handelns ohne Wissen, die mögliche einschränkende Wirkung von "zu viel" Wissen und die Rolle von Unwissen. Schließlich reflektiert es die Beziehung zwischen Theorie und Praxis im Kontext der Spielpädagogik.
Schlüsselwörter
Fachkompetenz, Handlungskompetenz, Kompetenzbegriff, kindliches Spiel, Spielförderung, pädagogische Fachkraft, Theorie, Praxis, Fröhlich-Gildhoff-Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Fach- und Handlungskompetenz in der Förderung des kindlichen Spiels
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die relative Bedeutung von Fach- und Handlungskompetenz für die Förderung des kindlichen Spiels. Im Mittelpunkt steht der Vergleich zwischen „Wissen“ (Fachkompetenz) und „Handeln“ (Handlungskompetenz) und deren jeweiliger Einfluss auf die Spielentwicklung des Kindes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Fach- und Handlungskompetenz, Das kindliche Spiel, Vergleich der Bedeutung von Fach- und Handlungskompetenz in Bezug auf die Förderung des kindlichen Spiels und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Wie wird der Kompetenzbegriff definiert?
Die Arbeit definiert den Kompetenzbegriff und erläutert das allgemeine Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff. Sie differenziert zwischen Fachkompetenz als theoretischem Wissen und Handlungskompetenz als praktischen Fähigkeiten.
Welche Arten von kindlichem Spiel werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Formen kindlichen Spiels, darunter Explorationsspiel, Funktionsspiel, Symbolspiel, Konstruktionsspiel und Rollenspiel. Die Bedeutung dieser Spielformen für die kindliche Entwicklung wird ausführlich erläutert.
Welche Rolle spielt die pädagogische Fachkraft?
Die Rolle der pädagogischen Fachkraft bei der Gestaltung und Förderung des Spiels wird hervorgehoben. Die Arbeit untersucht, wie die Fachkraft durch ihr Wissen und Handeln die positive Entwicklung des Kindes durch Spiel unterstützt.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis untersucht?
Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Theorie (Fachkompetenz) und Praxis (Handlungskompetenz) im Kontext der Spielpädagogik. Sie untersucht Fragen wie: Wissen ohne Handeln, Handeln ohne Wissen, die einschränkende Wirkung von „zu viel“ Wissen und die Rolle von Unwissen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Fachkompetenz, Handlungskompetenz, Kompetenzbegriff, kindliches Spiel, Spielförderung, pädagogische Fachkraft, Theorie, Praxis und das Fröhlich-Gildhoff-Modell.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob „Machen“ (Handlungskompetenz) wichtiger ist als „Wissen“ (Fachkompetenz) in der Förderung des kindlichen Spiels. Die Arbeit analysiert den Einfluss beider Kompetenzen auf die Spielentwicklung und den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, welche die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen erleichtern den schnellen Überblick über die gesamte Arbeit.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, das alle Kapitel und Unterkapitel mit den dazugehörigen Seitenzahlen auflistet. Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht eine schnelle Orientierung im Text.
- Quote paper
- Kathleen Lienig (Author), 2019, Fachkompetenz vs. Handlungskompetenz im kindlichen Spiel. Ist "Machen" entscheidender als "Wissen"?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/973921