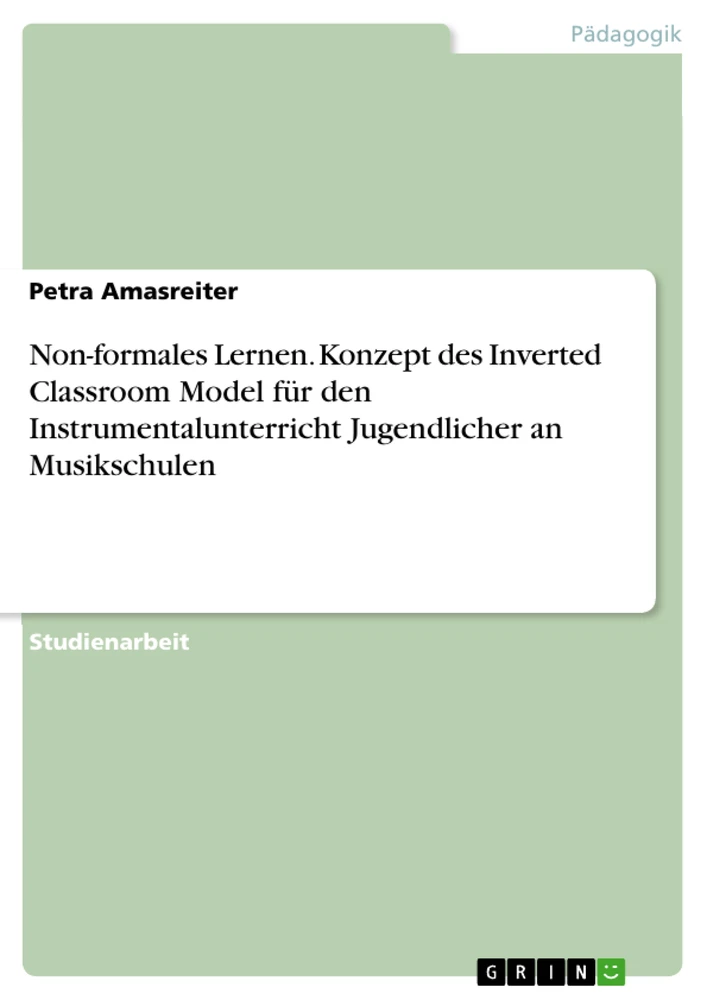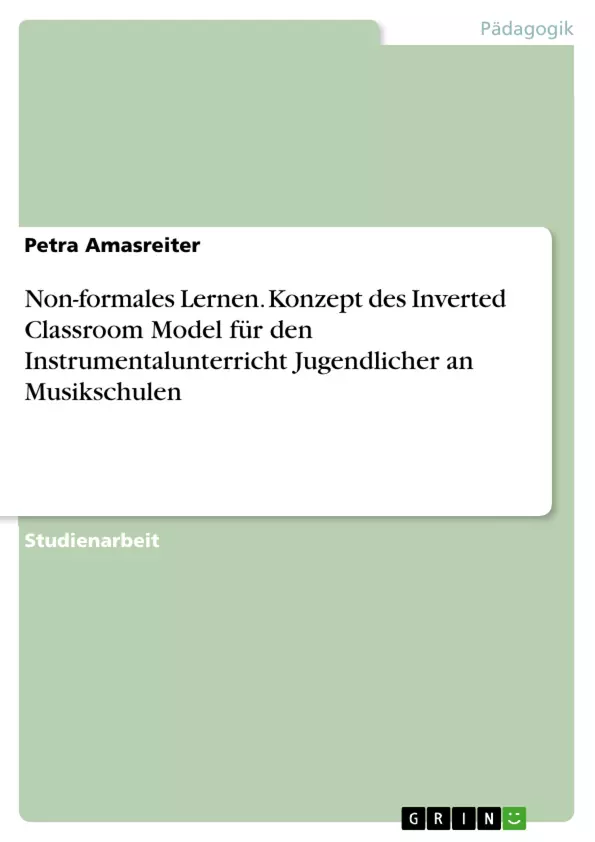Diese Arbeit lotet die Möglichkeiten des Inverted Classroom Model am Beispiel des Instrumentalunterrichts an Musikschulen aus. Dabei befasst sich das zweite Kapitel mit den didaktischen Anforderungen des instrumentalen Einzel- und Kleingruppenunterrichts an Musikschulen sowie den damit verbundenen strukturellen, motivationalen und volitionalen Aspekten des häuslichen Übens, Anschließend werden konstruktivistische Übungsansätze aus der Sicht der Lernenden verglichen.
Zielgruppe sind hierbei Jugendliche, die regelmäßig (das bedeutet in der Regel einmal wöchentlich) Instrumentalunterricht an einer Musikschule erhalten. Hierbei wird die erste These formuliert: Es wird vermutet, dass Überforderung und motivationale Probleme beim häuslichen Üben zu Unterrichtsabbrüchen führen.
Im dritten Kapitel wird das Inverted Classroom Model (ICM) vorgestellt, sowie didaktische Vorgehensweisen und lerntheoretische Hintergründe im Rahmen des Konstruktivismus beleuchtet. Im Anschluss werden am Beispiel des Modelleinsatzes im Hochschulbereich Vor- und Nachteile für die Lernenden und Lehrenden herausgearbeitet. Daraus leitet sich die zweite These ab: Es wird vermutet, dass sich die Anwendung des ICM im Unterricht positiv auf die Motivation der Lernenden, zu üben, auswirkt.
Das vierte Kapitel stellt nun den Vergleich zwischen instrumentalen Übungsansätzen und dem didaktischen Aufbau des ICM her, betrachtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede für die Lernenden und Lehrenden beider Bildungsbereiche und leistet den Transfer des ICM in den Musikschulunterricht anhand eines didaktischen Entwurfs.
Unter der Forschungsfragestellung, welches Potenzial die Anwendung des ICM auf den instrumentalen Einzel- und Kleingruppenunterricht Jugendlicher an Musikschulen für die Strukturierung und Motivationssteigerung des häuslichen Übens birgt, erfolgt im letzten Kapitel eine Zusammenfassung der aus der Literaturanalyse abgeleiteten Ergebnisse zum jetzigen Forschungsstand sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten des ICM in der Instrumentaldidaktik.
Das ICM erfreut sich als neue, stark technologisch fundierte Lehrmethode zunehmender Beliebtheit bei Lehrenden verschiedener Bildungsbereiche. In Schule und Hochschule wird es bereits vielfach angewendet, erforscht und dokumentiert; wohingegen sich sein Einsatz im Bereich des non-formalen Lernens eher zögerlicher gestaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Situation Jugendlicher an Musikschulen
- Fachdidaktik des Instrumentalunterrichts
- Motivationale und strukturelle Probleme des häuslichen Übens
- Konstruktivistisch ausgerichtete Übungsmethoden
- Vorstellung des Inverted Classroom Model (ICM)
- Begriffsdefinition und lerntheoretische Einordnung
- Anwendungsbeispiel im Bildungsbereich Hochschule
- Vor- und Nachteile des Modells
- Transfer des ICM auf den Instrumentalunterricht an Musikschulen
- Üben in beiden Bildungsbereichen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Modellhafte Anwendung des ICM im Instrumentalunterricht
- Potentiale und Konsequenzen für Unterricht und häusliches Üben
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Anwendung des Inverted Classroom Model (ICM) im Instrumentalunterricht an Musikschulen. Ziel ist es, das Potenzial dieses zukunftsweisenden Konzepts für die Strukturierung und Motivationsförderung des häuslichen Übens bei Jugendlichen zu untersuchen.
- Motivationale Herausforderungen des häuslichen Übens im Instrumentalunterricht
- Das Inverted Classroom Model als innovative Lehrmethode
- Die Übertragbarkeit des ICM auf den Bereich des non-formalen Lernens
- Potentiale und Herausforderungen des ICM im Instrumentalunterricht
- Die Rolle der Technologie und des konstruktivistischen Lernens im ICM
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Situation von Jugendlichen im Instrumentalunterricht an Musikschulen. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus den motivationalen und strukturellen Aspekten des häuslichen Übens ergeben. Das dritte Kapitel widmet sich der Vorstellung des Inverted Classroom Model (ICM) und analysiert dessen lerntheoretische Grundlagen sowie Anwendungsbeispiele im Bildungsbereich Hochschule. Im vierten Kapitel erfolgt der Transfer des ICM auf den Instrumentalunterricht an Musikschulen, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Bildungsbereichen betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Inverted Classroom Model (ICM), Instrumentalunterricht, Musikschule, non-formales Lernen, häusliches Üben, Motivation, Konstruktivismus, Lernmotivation, Didaktik, Bildungsforschung, Technologiegestütztes Lernen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Inverted Classroom Model (ICM)?
Beim ICM werden Lerninhalte vorab (z.B. per Video) zu Hause erarbeitet, während die gemeinsame Zeit im Unterricht für praktische Übungen und Vertiefung genutzt wird.
Wie kann das ICM im Instrumentalunterricht helfen?
Es hilft, das häusliche Üben besser zu strukturieren und die Motivation zu steigern, da theoretische Grundlagen flexibel vorbereitet werden können.
Welche Probleme treten beim häuslichen Üben oft auf?
Jugendliche leiden häufig unter Überforderung, mangelnder Struktur und Motivationsverlust, was oft zu einem Abbruch des Musikunterrichts führt.
Ist das ICM für Musikschulen geeignet?
Ja, der Transfer des Modells zeigt Potenziale für den Einzel- und Kleingruppenunterricht, erfordert aber eine Anpassung der Didaktik und den Einsatz digitaler Medien.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus im ICM?
Das ICM basiert auf konstruktivistischen Lerntheorien, bei denen der Schüler sein Wissen aktiv aufbaut und der Lehrer eher als Begleiter fungiert.
- Quote paper
- Petra Amasreiter (Author), 2017, Non-formales Lernen. Konzept des Inverted Classroom Model für den Instrumentalunterricht Jugendlicher an Musikschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/973993