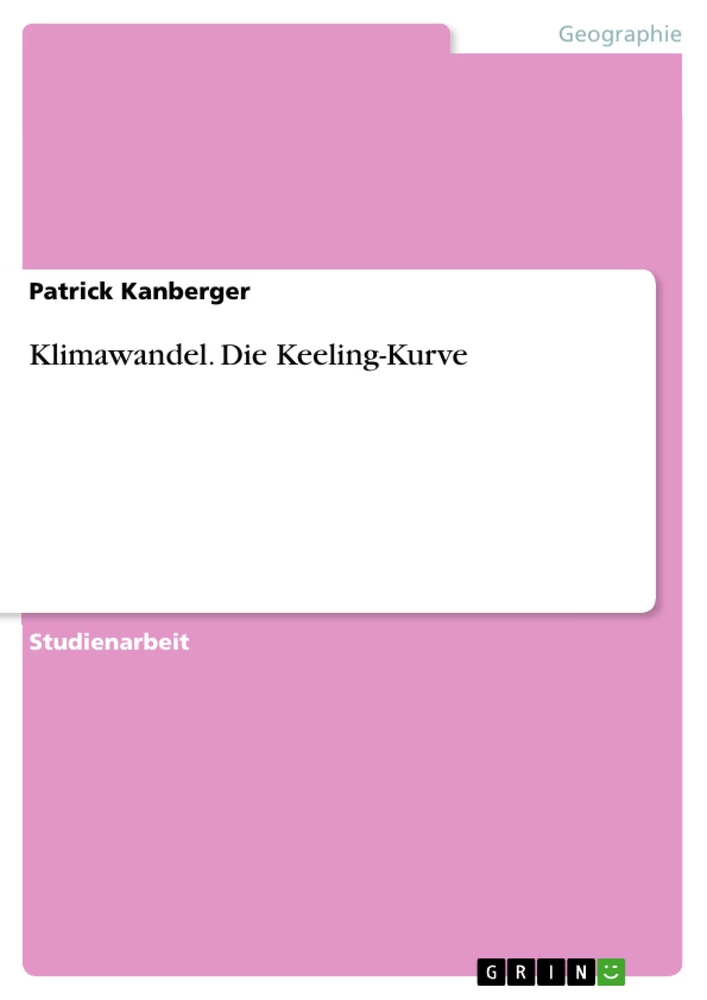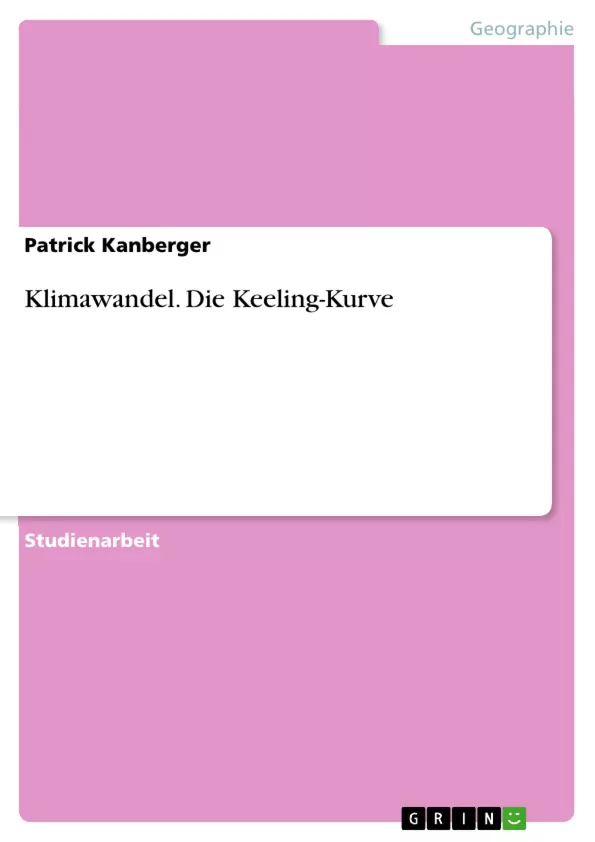Nachfolgend soll die Keeling-Kurve, welche den Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxid-Konzentration aufzeigt, skizziert und ganzheitlich beschrieben und in ihren Aussagen und eventuellen Folgen für das Erdklima diskutiert werden. Die Problemstellung dieser Ausarbeitung liegt in der Fülle der Publikationen zum Thema Klimawandel und den sich auch teilweise widersprechenden Aussagen und Forschungsergebnissen. Die Herausforderung liegt also darin, die komplexe Informationsflut entsprechend zu selektieren, um die Aufgabenstellung mit faktisch belegbaren Erkenntnissen zu bearbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in das Thema
- Problemstellung und Ziel dieser Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen Keeling-Kurve
- Klimasystem
- Klimawandel
- Treibhausgase
- Kohlenstoffdioxid
- Keeling-Kurve
- Charles David Keeling
- Historische Entwicklung
- Erläuterung des Kurventrends
- Wesentliche Auslöser des Kurvenverlaufs
- Jährlicher Verlauf
- Gesamtverlauf
- Wissenschaftlicher Stand
- Schlussbetrachtung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Keeling-Kurve, welche die steigende Konzentration von Kohlenstoffdioxid (CO2) in der Atmosphäre seit 1958 aufzeigt. Ziel ist es, die Keeling-Kurve in ihrer Gesamtheit zu beschreiben, ihre Bedeutung für das Verständnis des Klimawandels zu erläutern und die wissenschaftliche Diskussion zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Keeling-Kurve, ihren wichtigsten Auslösern und der wissenschaftlichen Debatte um ihre Aussagekraft.
- Die Keeling-Kurve als Indikator für den Klimawandel
- Die Bedeutung von Kohlenstoffdioxid als Treibhausgas
- Die Ursachen des Anstiegs der CO2-Konzentration
- Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Keeling-Kurve
- Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Erdklima
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung der Keeling-Kurve im Kontext des Klimawandels. Sie benennt die Problemstellung, das Ziel und den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel "Grundlagen Keeling-Kurve" definiert die relevanten Fachbegriffe, wie das Klimasystem, Klimawandel, Treibhausgase und Kohlenstoffdioxid. Das Kapitel "Keeling-Kurve" beschreibt die Entwicklung der Kurve, ihren Verlauf und die wesentlichen Auslöser des Anstiegs der CO2-Konzentration. Das Kapitel beleuchtet den wissenschaftlichen Stand der Forschung zur Keeling-Kurve und diskutiert die Debatte um die Aussagekraft der Kurve im Hinblick auf den Klimawandel.
Schlüsselwörter
Keeling-Kurve, Klimawandel, Kohlenstoffdioxid, Treibhausgase, atmosphärische Konzentration, wissenschaftlicher Stand, Debatte, Erdklima.
Häufig gestellte Fragen
Was zeigt die Keeling-Kurve?
Sie dokumentiert den kontinuierlichen Anstieg der atmosphärischen Kohlendioxid-Konzentration (CO2), gemessen seit 1958 auf dem Mauna Loa in Hawaii.
Warum schwankt die Kurve jährlich?
Die Schwankungen entstehen durch den jahreszeitlichen Rhythmus der Vegetation auf der Nordhalbkugel (Photosynthese im Sommer vs. CO2-Abgabe im Winter).
Wer war Charles David Keeling?
Ein US-amerikanischer Klimaforscher, der als Erster präzise Messmethoden entwickelte, um den anthropogenen Anstieg von CO2 nachzuweisen.
Welche Rolle spielt CO2 beim Klimawandel?
CO2 ist das wichtigste langlebige Treibhausgas, das die Wärmeabstrahlung der Erde in den Weltraum verringert und so zur Erderwärmung beiträgt.
Was ist der aktuelle wissenschaftliche Stand zur Kurve?
Die Kurve gilt als einer der faktisch am besten belegten Beweise für den Einfluss des Menschen auf die Zusammensetzung der Atmosphäre.
- Arbeit zitieren
- Wirtschaftsingenieur (M.Eng.) Patrick Kanberger (Autor:in), 2019, Klimawandel. Die Keeling-Kurve, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974100