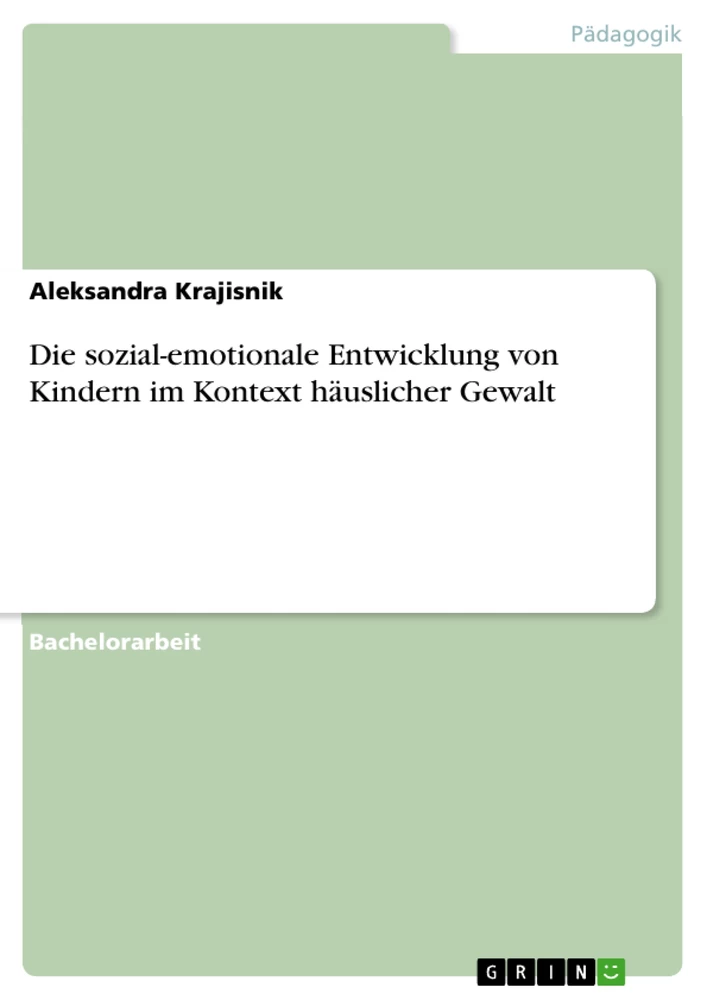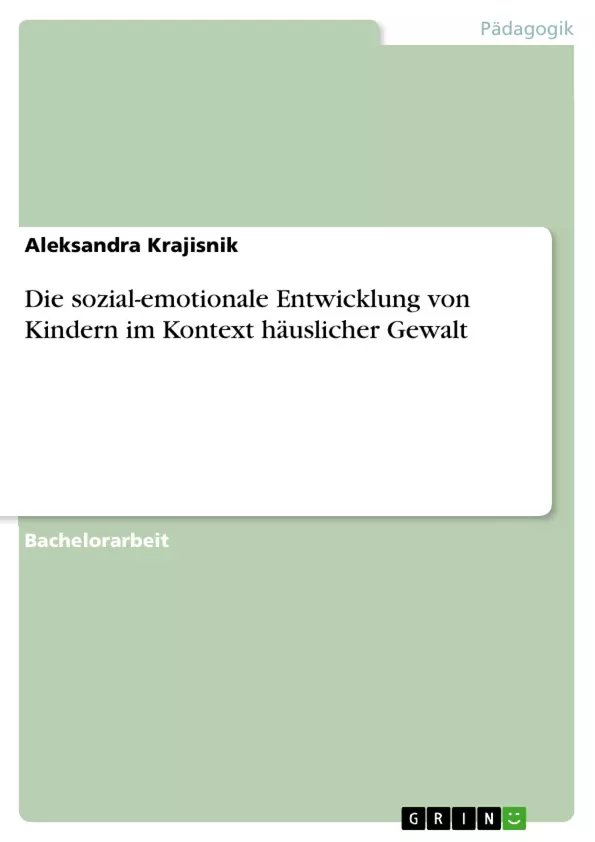Diese Arbeit beschäftigt sich mit Thema "häusliche Gewalt". Im Rahmen dieser Arbeit wird unter dem Begriff "häusliche Gewalt" die spezifische Form der Gewalt gegen Frauen verstanden. Im Fokus dieser Arbeit stehen die Kinder als Mitbetroffene von häuslicher Gewalt. Bezüglich dessen werden die Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die Kinder aufgezeigt und welche Folgen daraus für Kinder als Zeugen von häuslicher Gewalt, entstehen können.
Die Familie stellt die erste soziale Gemeinschaft im Leben eines Säuglings dar. Ein wichtiger Aspekt innerfamilialer Beziehungen ist die Eltern–Kind–Interaktion. Somit haben die Eltern, aber auch andere Institutionen wie Schule und Kindergarten die Aufgabe, die Kinder kindgemäß aufwachsen und sich entwickeln zu lassen und ihnen auch eine soziale Entwicklung zu ermöglichen. Somit wird dem familialen Beziehungssystem große Bedeutung zugeschrieben, da das Beziehungssystem primäre Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern hat. Dem zufolge besitzt die Familie eine große Bedeutung für den Verlauf der kindlichen Entwicklung. Was passiert aber, wenn die Familie keinen sicheren Ort für Kinder mehr darstellt und aufgrund dessen keine kindgerechte Förderung stattfinden kann?
Zunächst werden wichtige Begriffe zum Thema "häusliche Gewalt" erläutert und verschiedene Definitionen aufgeführt. Weiterhin werden die Gewaltformen von häuslicher Gewalt beschrieben, welche nicht getrennt voneinander, sondern vielmehr in Wechselwirkung zueinander betrachtet werden müssen. Anschließend wird in Kapitel 4 ein theoretisches Hintergrundwissen über die kindliche Entwicklung vermittelt, welches grundlegend für das Verständnis der in Kapitel 7 genannten Auswirkungen ist. Weiterhin wird in Kapitel 6 das methodische Vorgehen dargestellt, um die Transparenz für das Vorgehen dieser Arbeit zu sichern.
Im Anschluss daran zeigt diese Arbeit Folgen für Kinder auf, die Zeugen von häuslicher Gewalt sind. Dabei wird auch auf die Folgen von traumatischen Erfahrungen eingegangen, welche bezüglich häuslicher Gewalt entstehen können. Anschließend findet eine Bestätigung dieser Folgen durch angeführte Studien statt, welche die Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die kindliche Entwicklung aufzeigen und belegen.
Schließlich wird ein Fazit herangezogen, um die unterschiedlichen Blickwinkel im Hinblick auf die Forschungsfrage zu diskutieren und auf eventuell fehlende Forschung hinzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 2 Problemaufriss
- 3 Häusliche Gewalt
- 3.1 Definitionen
- 3.2 Formen von Häuslicher Gewalt
- 3.3 Ursachen
- 3.4 Kreislauf der Gewalt
- 3.5 Gründe gegen eine Trennung
- 3.5.1 Innere Gründe gegen eine Trennung
- 3.5.2 Strukturelle Gründe
- 4 Sozial-emotionale Entwicklung von Kindern
- 4.1 Die psychosozialen Stadien nach Erikson
- 4.2 Bindung
- 4.2.1 Die Bindungstheorie
- 4.2.2 Bindungsverhalten
- 4.2.3 Bindungsqualität
- 5 Fragestellung
- 6 Methodisches Vorgehen
- 7 Kinder und Häusliche Gewalt
- 7.1 Kinder als Betroffene von Häuslicher Gewalt
- 7.2 Häusliche Gewalt als Trauma
- 7.4 Risiko und Schutzfaktoren
- 7.5 Folgen für Kinder
- 7.6 Empirische Studien
- 7.6.1 Studie
- 7.6.2 STUDIE
- 8 Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis untersucht die Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern. Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Zusammenhänge zwischen häuslicher Gewalt und den verschiedenen Entwicklungsbereichen des Kindes zu beleuchten und die Folgen für die Kinder aufzuzeigen.
- Definition und Formen häuslicher Gewalt
- Entwicklungspsychologische Grundlagen der sozial-emotionalen Entwicklung
- Bindungstheorie und ihre Relevanz im Kontext von Häuslicher Gewalt
- Folgen von Häuslicher Gewalt für Kinder
- Empirische Studien zur Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern ein. Sie verdeutlicht die Vielschichtigkeit des Themas und die Bedeutung, Gewalt in all ihren Formen zu betrachten.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Konzept der Häuslichen Gewalt. Es werden verschiedene Definitionen, Formen und Ursachen von Häuslicher Gewalt erläutert, sowie der Kreislauf der Gewalt und die Gründe für die Persistenz von Gewaltbeziehungen beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern, insbesondere im Kontext von Häuslicher Gewalt. Hier wird die Bedeutung der Bindungstheorie hervorgehoben und die Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf die Bindungsqualität und das Bindungsverhalten von Kindern diskutiert.
Kapitel 7 beschäftigt sich mit den Folgen von Häuslicher Gewalt für Kinder. Es werden die besonderen Belastungen und Traumatisierungen beleuchtet, die Kinder in diesem Kontext erfahren, sowie die Auswirkungen auf ihre emotionale, soziale und kognitive Entwicklung. Zudem werden empirische Studien vorgestellt, die die Folgen von Häuslicher Gewalt auf die Entwicklung von Kindern untersuchen.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, sozial-emotionale Entwicklung, Kinder, Bindung, Bindungsqualität, Trauma, Folgen, Risiko- und Schutzfaktoren, empirische Studien.
- Quote paper
- Aleksandra Krajisnik (Author), 2017, Die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern im Kontext häuslicher Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974518