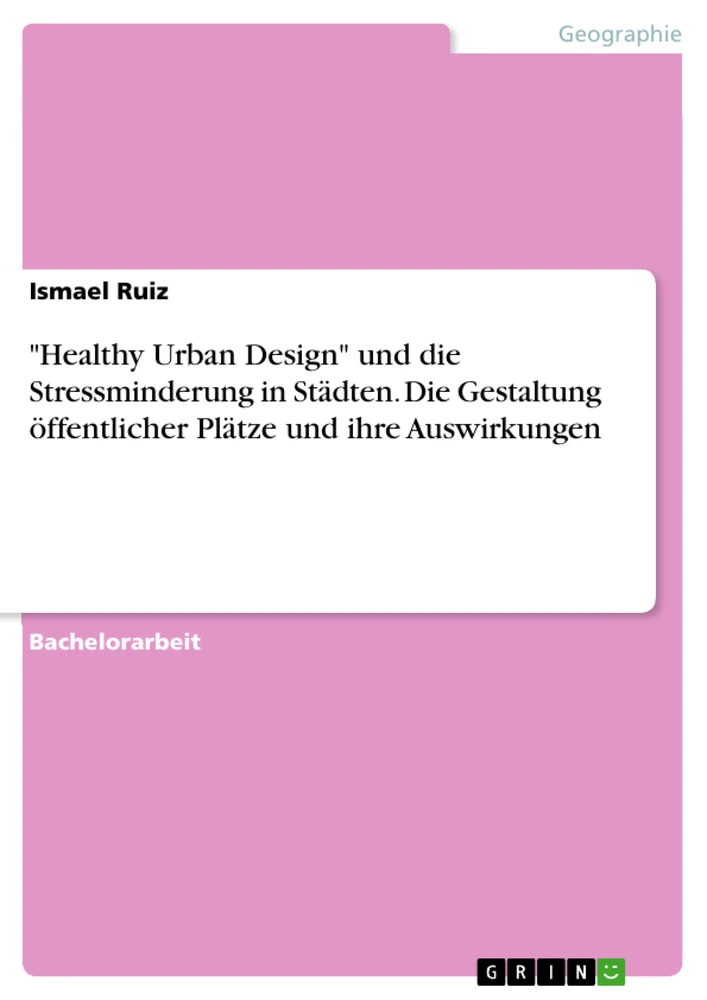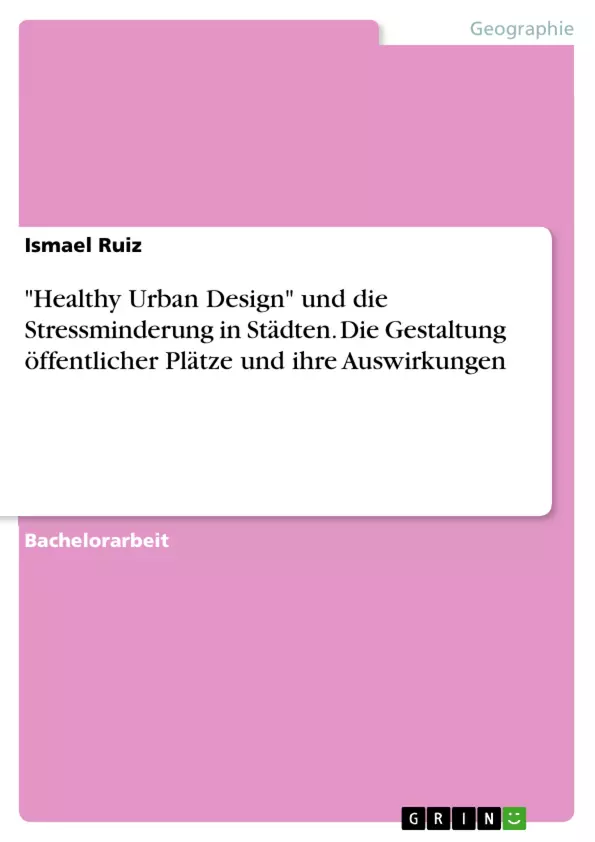Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von sekundären Daten zu erfahren, wie die Gestaltung von öffentlichen Räumen dazu beitragen kann, sozialen Stress zu mindern. Um das komplexe Themenfeld Stadt und öffentliche Räume in diesem Kontext abhandeln zu können, konzentriert sich diese Bachelor-Thesis dabei auf städtische, öffentliche Plätze. Dies resultiert aus der Annahme, dass öffentliche Plätze besonders geeignet sind, um soziale Kontakte zu ermöglichen da sie als Prototyp von öffentlichen Räumen gesehen werden können. Die Betrachtung öffentlicher Plätze bezüglich ihres Stressminderungspotenziales wird im Kontext dieser Bachelor-Thesis räumlich auf die Europäische Union, beziehungsweise auf die Bundesrepublik Deutschland begrenzt. Diese Eingrenzung des räumlichen Betrachtungsfeldes dient einer besseren Vergleichbarkeit der zu erwartenden Ergebnisse.
Die erwartete Verdichtung von Städten, bringt eine dichtere Bebauung auf Kosten der öffentlichen Räume mit sich. Welche Auswirkungen eine quantitative und qualitative Reduzierung von öffentlichen Räumen für soziale Kontakte haben kann, zeigt sich durch die Folgen der Covid-19 Pandemie. Gesperrte Spiel- oder Sportplätze verhindern nicht nur physische Bewegung, sie beschränken auch die damit verbundene Sozialisierung der betroffenen Personen. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Möglichkeit zu haben, die eigene Wohnung verlassen zu können und Erholung in öffentlichen Räumen zu erfahren. Ebenso wurde durch die Covid-19 Pandemie die Bedeutung von sozialen Strukturen in lokalem Maßstab deutlich. Menschen sind auf soziale Kontakte nicht nur zum Abbau von Stress angewiesen. Die Stadtplanung ist maßgeblich dafür verantwortlich, Städte so zu gestalten, dass soziale Kontakte entstehen können.
Daher ist die Aufgabe der Stadtplanung, sich den Herausforderungen zu stellen, die durch dichter werdende Städte erfolgen und Lösungsansätze für die daraus resultierenden gesundheitlichen Aufgaben zu finden. Eine dieser Herausforderungen ist das psychischen Wohlbefinden der in Städten lebenden Menschen zu sichern. Das heißt im Umkehrschluss, dass Beeinträchtigungen für die psychische Gesundheit, wie sozialer Stress verhindert werden sollten. Gerade weil soziale Kontakte helfen, sozialen Stress zu reduzieren, muss die Stadtplanung und alle damit verbundenen Akteure dazu beitragen, soziale Kontakte in Städten zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Gegenseitige Beeinflussung
- 2.1 Städtisches Wohlbefinden
- 2.2 Gemeinsam einsam......
- 2.2 Gemeinsam gegen Stress
- 3 Städtischer Raum
- 4 Hypothesen & Methodik
- 5 Qualitätskriterien für erholsame Räume
- 5.1 Schutz........
- 5.2 Aneignung..\n
- 5.3 Wohlbefinden........
- 5.4 Gut gelungen....
- 6 Interpretation .....
- 7 Fazit...........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht die Wechselwirkung von Stadtplanung und städtischem Wohlbefinden, insbesondere die Rolle der Gestaltung öffentlicher Plätze bei der Minimierung von sozialem Stress in Städten. Das Ziel ist, mithilfe sekundärer Daten aufzuzeigen, wie die Gestaltung von öffentlichen Plätzen dazu beitragen kann, sozialen Stress zu mindern und somit das psychische Wohlbefinden der Stadtbevölkerung zu fördern.
- Städtisches Wohlbefinden und die Auswirkungen von sozialem Stress auf die Gesundheit der Stadtbevölkerung
- Die Rolle der Gestaltung öffentlicher Plätze in der Förderung sozialer Kontakte und der Reduktion von sozialem Stress
- Qualitätskriterien für erholsame und stressreduzierende öffentliche Räume
- Die Bedeutung von Aneignung, Schutz und Wohlbefinden in der Gestaltung öffentlicher Plätze
- Analyse eines Praxisbeispiels zur Veranschaulichung der Zusammenhänge zwischen Gestaltung und Stressminderung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die gegenseitige Beeinflussung von Stadtplanung und Stadt. Es stellt den Zusammenhang zwischen städtischem Wohlbefinden, sozialem Stress und der Bedeutung von sozialen Kontakten heraus. Kapitel 2 widmet sich dem Thema „Städtischer Raum“ und untersucht die Rolle von öffentlichen Plätzen als Orte für soziale Interaktion. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch die zunehmende Urbanisierung und Verdichtung ergeben, sowie die Bedeutung der Gestaltung öffentlicher Räume für die Förderung von sozialen Kontakten. Kapitel 3 führt die Hypothesen und die Methodik der Arbeit ein. Kapitel 4 präsentiert Qualitätskriterien für erholsame und stressreduzierende öffentliche Räume, die sich an den Bewertungskatalog von Jan Gehl orientieren. Anschließend wird ein Praxisbeispiel analysiert, um die Zusammenhänge zwischen Gestaltung und Stressminderung zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Städtisches Wohlbefinden, sozialer Stress, soziale Isolation, soziale Dichte, öffentliche Räume, öffentliche Plätze, Gestaltung, Aneignung, Schutz, Wohlbefinden, Stressminderung, Urbanisierung, Stadtplanung.
Häufig gestellte Fragen
Wie mindert Stadtplanung sozialen Stress?
Durch die Gestaltung öffentlicher Räume, die soziale Interaktion ermöglichen und gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten sowie Schutz vor Lärm und Hektik bieten.
Warum sind öffentliche Plätze wichtig für die Gesundheit?
Sie dienen als Orte der Erholung und Sozialisierung, was Einsamkeit vorbeugt und das psychische Wohlbefinden in verdichteten Städten steigert.
Was sind Qualitätskriterien für erholsame Räume?
Nach Jan Gehl sind dies vor allem Schutz (vor Verkehr/Wetter), Aufenthaltsqualität (Sitzgelegenheiten) und die Möglichkeit zur Aneignung des Raumes.
Welchen Einfluss hatte die Covid-19 Pandemie auf die Wahrnehmung von Parks?
Die Pandemie hat verdeutlicht, wie essenziell öffentliche Freiflächen für die psychische Gesundheit sind, wenn private Kontakte und Innenräume eingeschränkt sind.
Was bedeutet „Aneignung“ in der Stadtplanung?
Es beschreibt die Möglichkeit der Bürger, einen Platz flexibel zu nutzen (z. B. für Sport, Spiel oder Treffen), was die Identifikation mit dem Wohnort stärkt.
- Citar trabajo
- Ismael Ruiz (Autor), 2020, "Healthy Urban Design" und die Stressminderung in Städten. Die Gestaltung öffentlicher Plätze und ihre Auswirkungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974847