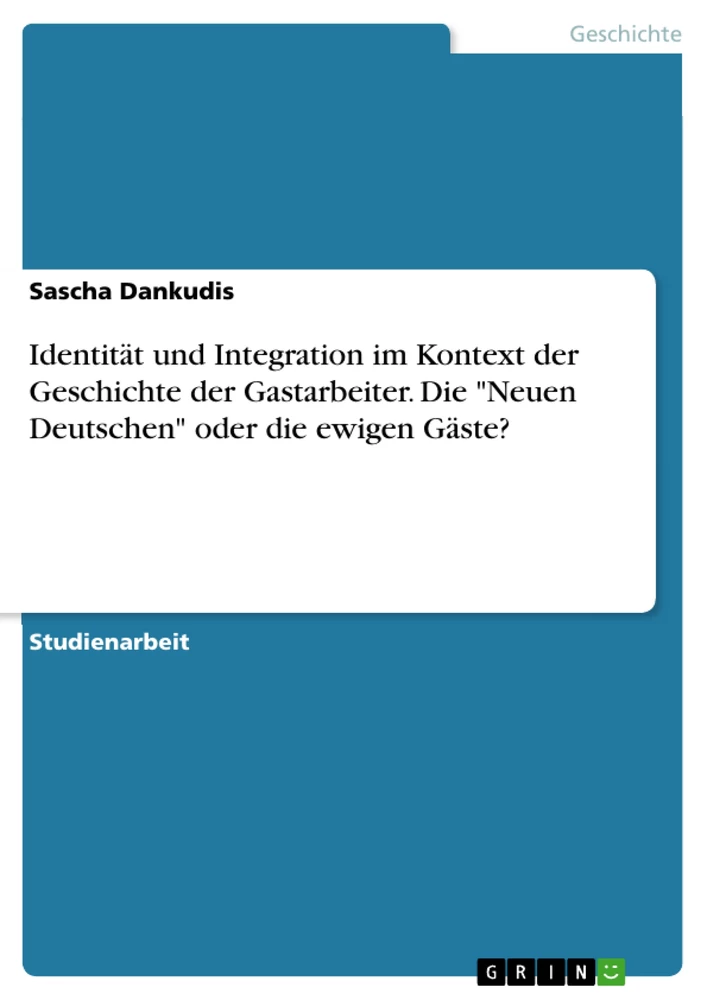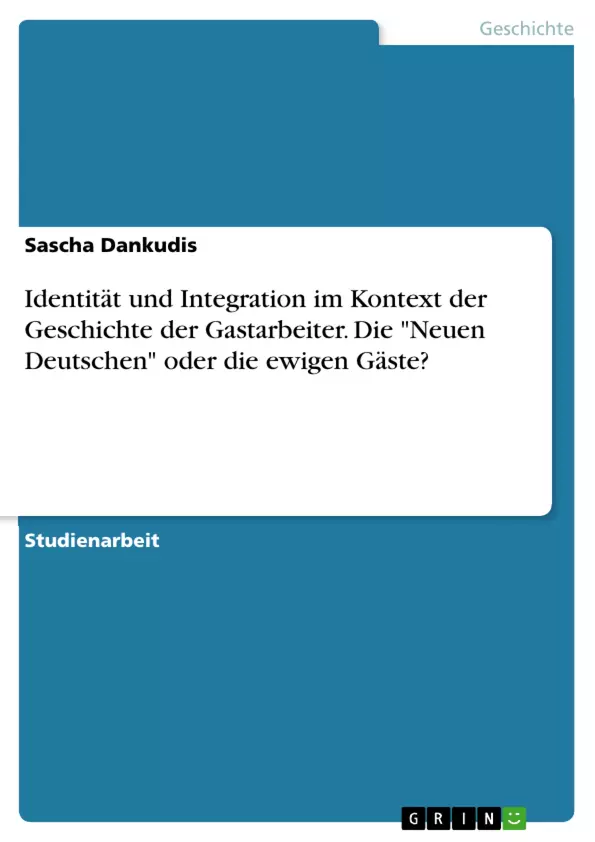Gegenstand dieser Arbeit soll es sein, Konzepte von kultureller Identität der „Gastarbeiter“ und ihrer Nachfahren im historischen Wandel zu untersuchen und das Spannungsverhältnis zu einer diffusen Forderung nach Integration der bundesdeutschen Öffentlichkeit zu beleuchten. Ich werde mich dabei vornehmlich auf die Gruppe der griechischen „Gastarbeiter“ und ihrer Familien konzentrieren. Die Darstellung der zweiten und dritten Generation soll hingegen ohne Einschränkung auf eine spezifische Gruppe erfolgen, da es hier vor allem darum geht, die gemeinsame Erfahrung der Stigmatisierung der Deutschen mit „Migrationshintergrund“ zu veranschaulichen. Methodisch werde ich mich zum einen auf die Befragungsergebnisse empirischer Studien stützen.
Das Phänomen der Arbeitsmigration in der BRD soll zunächst am Beispiel der Griechen hinsichtlich Motivlage zur Ausreise und der Akkulturation in Deutschland dargestellt werden. Dabei sollen auch die politischen und sozialen Aufnahmebedingungen in der BRD thematisiert werden. Vorab müssen die Begriffe „Identität“ und „Integration“ hinsichtlich ihrer Verwendungsweise im Text geklärt werden. Zunächst soll aber noch ein exemplarischer Blick auf die Forschung zur „Gastarbeiter-Geschichte“ im Rahmen der Fragestellung geworfen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Forschung
- Integration und Zugehörigkeit
- Die erste Generation der „Gastarbeiter“
- Ursachen und Motive der Auswanderung
- „Wirtschaftswunder“ und Anwerbeabkommen
- Integration und Identität der ersten Generation
- Identität und Integration in der zweiten und dritten Generation
- Die zweite Generation
- Die dritte Generation
- Resümee
- Quellen- und Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Konzepte von kultureller Identität der „Gastarbeiter“ und ihrer Nachfahren im historischen Wandel. Dabei wird das Spannungsverhältnis zu einer diffusen Forderung nach Integration der bundesdeutschen Öffentlichkeit beleuchtet. Die Arbeit fokussiert sich primär auf die Gruppe der griechischen „Gastarbeiter“ und ihrer Familien, während die Darstellung der zweiten und dritten Generation eine breitere Perspektive auf die Stigmatisierung von Deutschen mit „Migrationshintergrund“ einnimmt.
- Kulturelle Identität der „Gastarbeiter“ und ihrer Nachfahren
- Spannungsverhältnis zur Forderung nach Integration
- Motive zur Auswanderung griechischer „Gastarbeiter“
- Akkulturation in Deutschland
- Stigmatisierung von Deutschen mit „Migrationshintergrund“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der kulturellen und ethnischen Heterogenität in der Bundesrepublik Deutschland ein und beleuchtet die Bedeutung von Migration für die nationale Identität und Zugehörigkeit. Der Begriff „Integration“ wird im Kontext von Einwanderungsgesellschaften diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer Anpassungsleistung von allen sozialen Akteuren betont wird.
Kapitel 1 beleuchtet die Forschung zur bundesdeutschen Arbeitsmigration und skizziert die prominentesten Strömungen, die sich mit Themen der Migration in der Nachkriegszeit der BRD auseinandersetzten.
Kapitel 2 diskutiert die Ursachen und Motive der Auswanderung griechischer „Gastarbeiter“ und die politischen und sozialen Aufnahmebedingungen in der BRD. Die Integration und Identität der ersten Generation werden im Kontext des „Wirtschaftswunders“ und der Anwerbeabkommen analysiert.
Kapitel 3 untersucht die Entwicklung von Identität und Integration in der zweiten und dritten Generation von „Gastarbeitern“ und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen diese Generationen begegneten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten wie „Gastarbeiter“, „Integration“, „Identität“, „Migrationshintergrund“, „Akkulturation“, „nationale Identität“, „Zugehörigkeit“, „Stigmatisierung“ und „empirische Forschung“. Im Kontext der Forschung werden Themen wie „Gastarbeiterforschung“, „Ausländerforschung“ und „Migrationsgeschichte“ beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die sogenannten "Gastarbeiter"?
Es waren Arbeitsmigranten, die in den 1950er bis 1970er Jahren aufgrund von Anwerbeabkommen (z. B. mit Griechenland) zur Unterstützung des Wirtschaftswunders nach Deutschland kamen.
Was bedeutet "Akkulturation" im Kontext der ersten Generation?
Akkulturation beschreibt den Anpassungsprozess der Migranten an die deutsche Gesellschaft, oft geprägt durch das Spannungsfeld zwischen der Heimatkultur und dem neuen Umfeld.
Welche Herausforderungen hat die zweite und dritte Generation?
Diese Generationen kämpfen oft mit Stigmatisierung und der Frage nach ihrer Identität zwischen "neuen Deutschen" und der Wahrnehmung als "ewige Gäste".
Wie wird Integration in der Arbeit definiert?
Integration wird als wechselseitiger Prozess verstanden, der nicht nur eine Anpassung der Migranten, sondern auch eine Offenheit der Aufnahmegesellschaft erfordert.
Warum liegt der Fokus auf griechischen Gastarbeitern?
Griechische Migranten dienen in dieser Arbeit als exemplarisches Beispiel, um die Motive zur Auswanderung und die spezifischen Integrationsverläufe in der BRD zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Sascha Dankudis (Autor:in), 2019, Identität und Integration im Kontext der Geschichte der Gastarbeiter. Die "Neuen Deutschen" oder die ewigen Gäste?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/975124