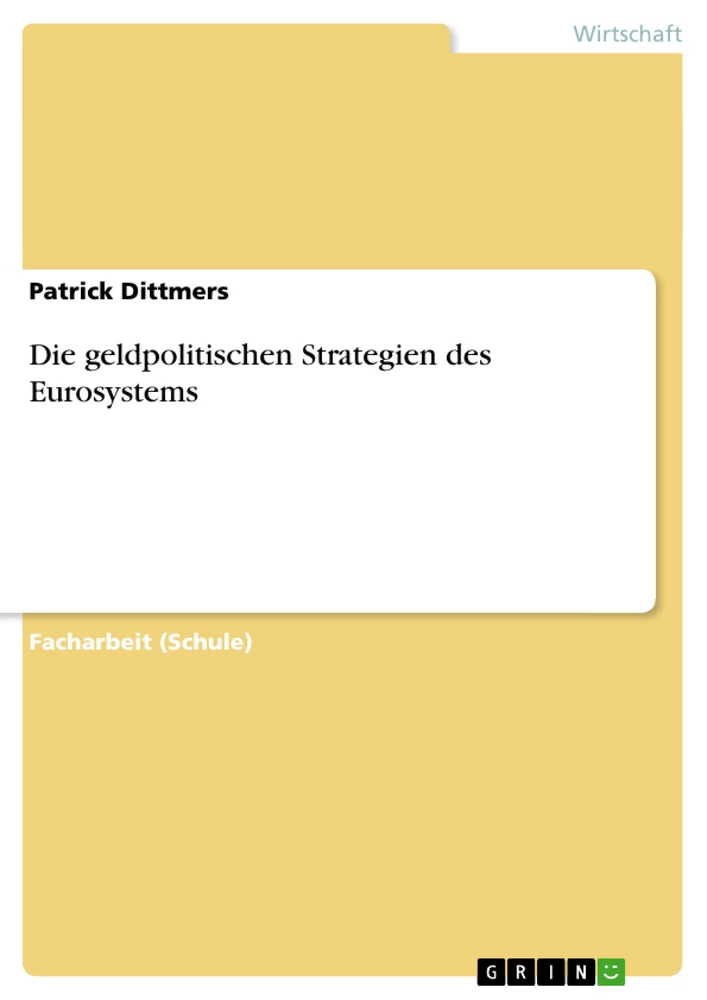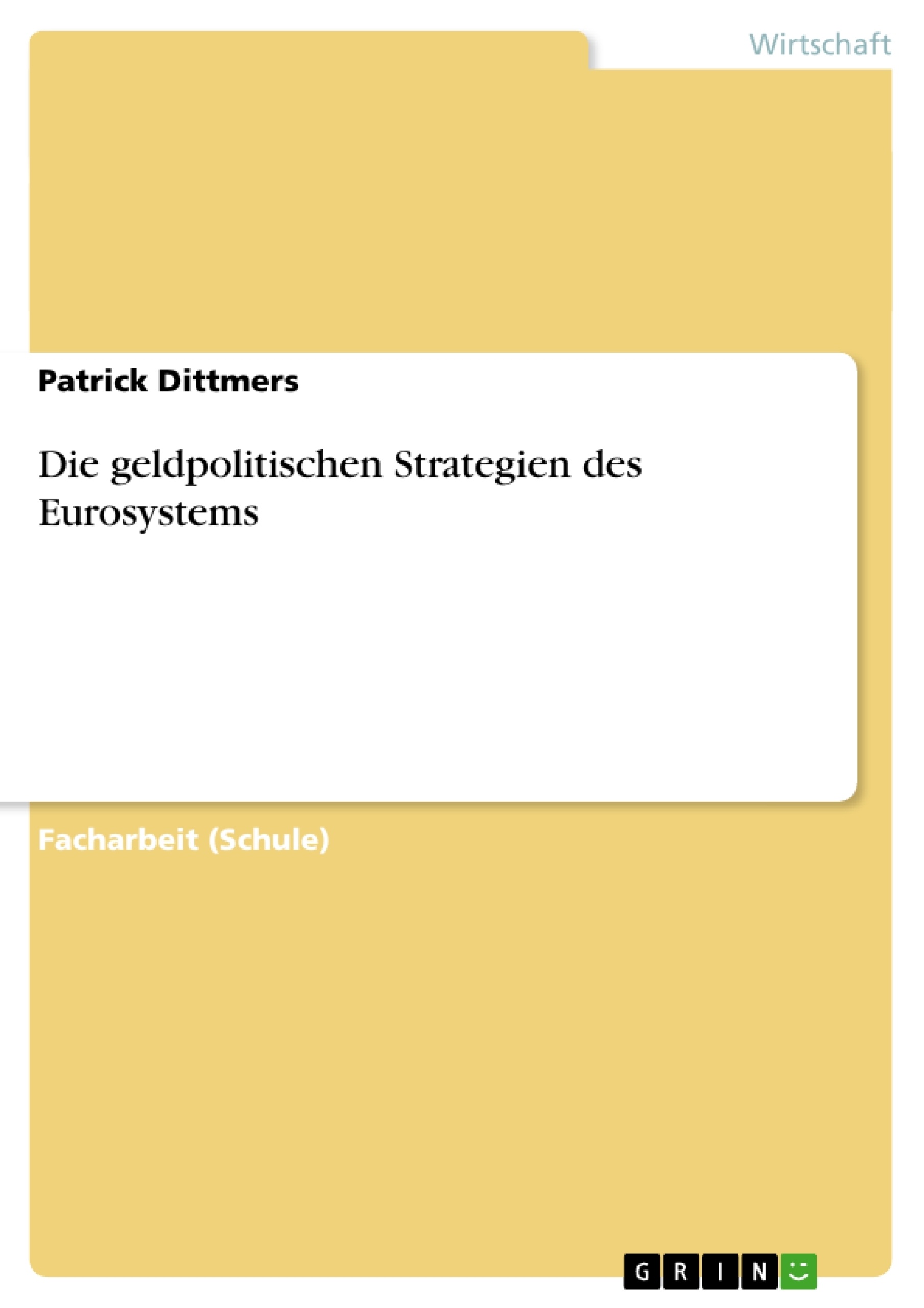Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Das Europäische Währungssystem
2. Die drei Stufen der Wirtschafts- und Währungsunion
3. Das Europäische System der Zentralbanken und die Europäische Zentralbank als Spitzeninstitut des ESZB geldpolitische Strategie
4. Die geldpolitischen Strategien
4.1 Veröffentlichung einer quantitativen Definition von Preisstabilität
4.2 Geldmengenziel
4.3 Direktes Inflationsziel
5. Die Geldpolitischen Instrumente ESZB
5.1 Offenmarktgeschäfte
5.2 Mindestreserven
5.3 Ständige Fazilitäten
6. Die Verfahrenstechniken
7. Schlusswort
8. Quellverzeichnis
0. Einleitung
Am 1. Januar 1999 ist die dritte und damit letzte Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) in Kraft getreten, so wie es im Vertrag von Maastricht vorgesehen war. An diesem Datum fiel somit der Startschuss für die einheitliche Währung in den 11 EUMitgliedsländer der EWWU. Die teilnehmenden Nationalstaaten gaben an diesem Stichtag die autonome Steuerung ihrer Währungspolitik auf und übertrugen diese Kompetenz an das Europäische System der Zentralbanken (ESZB).
Ziel dieser Arbeit ist es, die Aufgaben der EZB in der ESZB zu verdeutlichen. Dies schließt ein, das ich die Strategien, welche die Europäische Zentralbank verfolgen kann, erläutere und die einzelnen Instrumente, die die EZB zur Ausführung ihrer Aktivitäten gebraucht erklären werde.
Das Thema ist in sofern interessant, da es so aktuell ist und auch noch in die Zukunft reicht. Man kann fast nichts in alten Büchern zu diesem Thema finden. Man arbeitet also nur mit aktuellen Materialien.
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Arbeit einen größeren Einblick in die Europäische Wirtschafts- und Währungssituation ermögliche.
1. Das Europäische Währungssystem
Heute spricht man einfach nur vom Europäischen Währungssystem (EWS), es ist aber so, dass es eigentlich EWS II heißt. Das Europäische Währungssystem besteht seit 1979 Es wist ein regionales System fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse. Das EWS ist ein Währungskorb (European Currency Unit - ECU), in dem EU - Währungen mit einem festen Betrag enthalten sind. Dieser feste Betrag orientiert sich an der wirtschaftlichen Bedeutung des jeweiligen Landes innerhalb der EU. Seit 1991 gibt es die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, welche einen
Dreistufenplan vorsieht und welche das Ziel hatte eine gemeinsame Währung innerhalb der EU ab 1999 einzuführen.
Das EWS II wurde 1999 eingeführt. Dies war erforderlich, da man versuchen musste, die Währungsrelation so stabil wie möglich zu gestalten. Mit dem EWS II ist das Verhältnis des Euros zu den Währungen jener EU-Staaten geregelt, die zunächst nicht an der Europäischen Währungsunion EWU teilnehmen (Griechenland, Großbritannien, Dänemark, Schweden). Es ist, wie sein Vorgänger, ein System fester aber anpassungsfähiger Kurse. Dennoch soll es noch einige Schwächen des bisherigen EWS vermeiden. Dabei geht es vor allem um vier Punkte:
1. Die Währungen der Länder, die noch nicht in der EU Mitglied sind, sollen in einem festen Wechselkurs zum Euro stehen. Ihr Kurs darf aber nur innerhalb festgelegter Bandbreiten schwanken.
2. Bei der Aufrechterhaltung der festgelegten Kurse ist in erster Linie die Zentralbank des jeweiligen betroffenen EU- Landes zu Interventionen am Devisenmarkt verpflichtet. Sie muss dafür sorgen, dass der Wechselkurs ihrer Währung innerhalb der vereinbarten Bandbreite bleibt. Die Europäische Zentralbank (EZB) greift nur dann ein, wenn dies ohne Schaden für die Geldwertstabilität innerhalb der Währungsunion geschehen kann. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Länder der EWU nicht für die Fehler der außenstehenden EU- Länder aufkommen müssen.
3. Änderungen der Leitkurse sollen aus dem gleichen Grund nicht mehr wie bisher Angelegenheit der einzelnen Länder sein. Das Initiativrecht wird statt dessen bei der EZB liegen.
4. Wie bisher soll es für die verschiedenen Währungen unterschiedliche Bandbreiten geben. Je weiter das jeweilige EU- Land vom Stabilitätsziel entfernt ist, um so größer wird die Bandbreite sein, innerhalb der seine Währung um den Euro- Leitkurs schwanken darf.
2. Die drei Stufen der Wirtschafts- und Währungsunion
Am 7. Februar 1992 wurde in Maastricht von den Außen- und Finanzministern der EG der Vertrag über die Europäische Union (EU) unterzeichnet, welcher am 1. November 1993 in Kraft trat. Dieser Vertrag sah vor, das die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit in Europa vertieft werden müsste. So sollte die Europäische Gemeinschaft von einem gemeinsamen Markt zu einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) weiterentwickelt werden. Dies sollte in drei Stufen geschehen.
Während der ersten Stufe (1990-1994) sollten die noch bestehenden Hindernisse im innergemeinschaftlichen Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital
beseitigt werden. Gleichzeitig sollten die Mitgliedsstaaten ihre Wirtschaftspolitik verstärkt koordinieren und die dauerhafte wirtschaftliche Stabilität gewährleisten. Man hatte auch vor, alle EU- Währungen in den Wechselmechanismus des EWS einzubeziehen, doch dies konnte noch nicht verwirklicht werden.
Am 1. Januar 1994 begann die 2. Stufe. In der 2. Stufe wurde das Europäische Währungsinstitut (EWI)I in Frankfurt gegründet. In dieser Stufe haben die EU- Mitgliedsstaaten dafür zu sorgen, dass ihre Zentralbanken mit Beginn der 3. Stufe unabhängig sind. Außerdem wird in dieser Stufe die Zusammensetzung des ECU- Währungskorbs endgültig fixiert.
Während der ganzen Stufe wird die wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedsstaaten von der EG Kommission und dem Europäischen Währungsinstitut laufend beobachtet und beurteilt. Da die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in manchen Ländern noch so gut ist, liegt es auf der Hand, dass nicht alle EU- Mitgliedsstaaten sofort an der Währungsunion teilnehmen werden. Alle Länder ,die die Kriterien noch nicht erfüllen, können zu einem späteren Zeitpunkt beitreten.
Seit dem 1. Januar 1999 läuft die 3. Stufe und mit ihr die Zeit der Währungsunion. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wirtschafts- und Finanzminister mittels eines einstimmigen Beschlusses die Umrechnungskurse der europäischen Währung sowie zwischen den einzelnen Währungen, die an der Währungsunion teilnehmen, unwiderruflich festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es die Europäische Währung nur als Buchgeld. In dieser Stufe wird die Geldpolitik der Notenbanken, die Geld-, Devisen- und Kapitalmärkte, die öffentliche Verwaltung sowie die Preise aller Konsumgüter und Dienstleistungen auf europäische Währung umgestellt. Erst am Ende der Phase wird mit der Ausgabe des europäischen Bargeldes begonnen (2002). Hierfür muss aber Gewährleistet sein, dass alle an der Währungsunion teilnehmenden Staaten die gemeinsame Währung als offizielles Zahlungsmittel verwenden. Man sieht vor, das ab dem 1. Januar 2002 bis spätestens zum 1. Juli 2002 gleichzeitig nationales und europäisches Bargeld im Umlauf sind. Seit dem 1. Januar 1998 gibt es das Europäische Zentralbanksystem und die EZB. Sie werden sind für die Geldpolitik zuständig, wobei sie primär das Ziel der Geldwertstabilität verfolgen. II
3. Das Europäische System der Zentralbanken und
die Europäische Zentralbank als Spitzeninstitut des ESZB
Mit der Errichtung der Europäischen Zentralbank im Juni 1998 in Frankfurt wurde das Europäische Währungsinstitut (EWI) abgelöst. Die Europäische Zentralbank und mit ihr das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) bilden das Herzstück der Währungsunion. Das Europäische System der Zentralbanken ist nach dem deutschen Modell (Bundesbank und Landeszentralbanken) errichtet. Es besteht aus den nationalen Zentralbanken der EWU- Mitgliedsstaaten und der EZB.
Entscheidungsgremium ist der Rat der EZB. Ziel der EZB ist in erster Linie die Preisstabilität des Euros. Sie ist vollkommen unabhängig von Weisungen europäischer und nationaler Institute.
Die EZB ist das Spitzeninstitut des Europäische System der Zentralbanken. Die EZB allein ist für die Stabilität des Geldwertes verantwortlich, sie bestimmt die Geldpolitik innerhalb der gesamten Europäischen Währungsunion (EWU) und genehmigt die Ausgabe von Euro- Banknoten und Münzen.
Die nationalen Zentralbanken bilden die zweite Stufe des Zentralbanksystems. Die nationalen Zentralbanken sind vor allem dem Ziel verpflichtet, die Geldwertstabilität zu sichern. Auch die nationalen Zentralbanken unterliegen dabei keinerlei Weisungen von seiten der Regierung, von Institutionen der EU oder anderen Stellen. Um diese Punkte des Vertrages zu erfüllen, waren in einigen EU- Ländern Verfassungsänderungen erforderlich. Denn alle Länder haben sich verpflichtet, die Satzungen ihrer Zentralbanken mit den Bestimmungen des Maastrichter Vertrages in Übereinstimmung zu bringen.
Die nationalen Zentralbanken sind für die Ausführung der Beschlüsse der EZB zuständig. Sie können mit Genehmigung der EZB Banknoten ausgeben. Die Mitgliedstaaten haben das Recht, Münzen auszugeben. Den Wert der insgesamt umlaufenden Münzen, der Euro- Cents, bestimmt allein die EZB. Dadurch ist sichergestellt, dass die Regierungen auch über den Umweg der Münzprägung keine Möglichkeit haben, die umlaufende Geldmenge gegen den Willen der EZB zu erhöhen.
4. Die geldpolitischen Strategien
,,Unter Strategie wird ... ein bedingter Plan verstanden, der für jede erwartete Eventualität die Handlungsweise festlegt, für verschiedene mögliche Ergebnisse dieser Handlung wiederum eine bestimmt erneute Aktion vorsieht usw."1
Die EWI hatte fünf mögliche Strategien für das ESZB geprüft: Das Wechselkursziel, das Zinsziel, das nominale Einkommensziel, das Geldmengenziel und das direkte Inflationsziel.
Das Ansteuern eines Wechselkurszieles als Strategie wurde verworfen, da es aufgrund der Größe des Euro- Währungsraumes möglicherweise nicht mit dem Ziel der Preisstabilität zu vereinbaren ist. Da es schwierig ist, denjenigen Zinssatz zu bestimmen, bei dem Preisstabilität erreicht wird, wurde auch diese Strategie vom EWI nicht empfohlen.
Ein Ziel für das nominale Einkommen würde zwar einen eindeutigen Rahmen vorgeben und könnte mit dem Ziel der Preisniveaustabilität kompatibel sein, doch wäre es schwierig geworden, die nominalen Einkommen zu kontrollieren.
So hat das EWI zwei Strategien (Geldmengenziel und das direkte Inflationsziel) herausgearbeitet, die das ESZB verfolgen könnte. Dabei verwies die EWI darauf, dass die Anwendung der beiden Strategien in den verschiedenen Ländern zeigte, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die Elemente beider Strategien enthalten.
Die Geldmengenstrategie ist transparent für die Öffentlichkeit. Zudem sprach für diese Strategie, dass sie von der Bundesbank verfolgt wurde.
Da aber nicht sicher war, dass die Geldnachfrage auch zu Beginn der Stufe 3 die gewünschten Eigenschaften besaß, wurde damit gerechnet, dass die Glaubwürdigkeit des ESZB beeinträchtigt werden könnte, wenn diese Strategie nicht erfolgreich sein würde. Für das Verfolgen eines direkten Inflationszieles sprach, dass diese Strategie die Verantwortung des ESZB für das Erreichen der Preisniveaustabilität betont. Daher werden zunächst beide Strategien verfolgt werden, um sicherzugehen, dass das Hauptziel, die Preisstabilität, erreicht wird. Denn beide Strategien weisen viele Ähnlichkeiten in ihrer Handhabung auf. Die Instrumente, die benötigt werden, um die Strategien zu verfolgen, stehen dem ESZB zur Verfügung und werden im Kapitel 5 kurz erläutert.
Die beiden von der EWI vorgeschlagenen Strategien, das Geldmengenziel (Zwischenzielstrategie) und das direkte Inflationsziel (Endzielstrategie) werden schließlich von dem ESZB verfolgt.2
4.1 Veröffentlichung einer quantitativen Definition von Preisstabilität
Die Veröffentlichung einer quantitativen Definition von Preisstabilität dient zwei Zwecken. Erstens macht sie die Preisentwicklung Transparenz, zweitens gibt sie der Öffentlichkeit einen Maßstab zur Beurteilung des Erfolgs der einheitlichen Geldpolitik und stärkt damit die Verantwortlichkeit des Eurosystems.
Der EZB- Rat hat die Preisstabilität als Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro- Währungsgebiet von unter 2 % gegenüber dem Vorjahr definiert. Nach dieser Definition muss Preisstabilität mittelfristig beibehalten werden. Die 2 % geben eindeutig an, das die Inflationsrate darunter liegen muss. Die Verwendung für die Beurteilung des HVPI ist für die Öffentlichkeit leicht nachvollziehbar, weil das Preisniveau generell anhand der Entwicklung der Verbraucherpreise beurteilt wird.
Die Aussage, Preisstabilität muss mittelfristig beibehalten werden, spiegelt die Notwendigkeit einer zukunftsgerichteten Orientierung der Geldpolitik wider.
Da das Eurosystem für die kurzfristigen Schocks (z.B. Rohstoffpreisschwankungen) nicht verantwortlich gemacht werden kann, gewährleistet die mittelfristige Beurteilung des Erfolges der einheitlichen Geldpolitik eine echt und sinnvolle Rechenschaftslegung des Eurosystems. Die Definition von Preisstabilität im Eurosystem stimmt mit jener, die von den meisten nationalen Zentralbanken im Eurogebiet vor dem Übergang zur Währungsunion benutzt wurde, überein. Dies stellt ein wichtiges Element der Stetigkeit mit den erfolgreichen nationalen geldpolitischen Strategien dar.
4.2 Geldmengenziel
Diese Strategie, die von monetaristisch orientierten Theoretikern Ende der sechziger Jahre entwickelt wurde, basiert auf der Erkenntnis, dass die geldpolitischen Instrumente nur mit langen zeitlichen Verzögerungen (nach FriedmanIII) auf ihre Zielvariable, die Geldwertstabilität, einwirkt. Aus diesem Grund musste man, anstatt des Fernzieles der Preisstabilität, ein Zwischenziel auszuwählen, das früher reagiert und an dem die Instrumente ausgerichtet werden können.
Das Geldmengenkonzept reduziert ein sehr komplexes Entscheidungsproblem auf die einfache Gegenüberstellung von Geldmengenziel und tatsächlicher monetärer Entwicklung. Von den internationalen bedeutsamen Währungen wurde nur noch die D- Mark nach einem Geldmengenkonzept gesteuert. Nur die Bundesbank hielt an einem Geldmengenziel fest, die anderen Zentralbanken die ein solches Konzept verfolgten, wie die Federal Reserve und die Bank of England, sind nach Problemen zum direkten Inflationsziel übergegangen. Doch auch die deutsche Zentralbank hat nie eine so strikte Geldmengenstrategie verfolgt. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass sie ihren Zielkorridor in etwa der Hälfte der Fälle nicht erreicht hat. Sie konnte es sich aber aufgrund ihrer ansonsten sehr großen Glaubwürdigkeit leisten.
Für die EZB sieht es jedoch anders aus, sie muss sich Glaubwürdigkeit erst noch erarbeiten und es wird bezweifelt, dass diese mit einer solchen Strategie erreicht werden kann. Der Schwachpunkt dieses im Grunde so einfachen und einsichtigen Modells, liegt in den Voraussetzungen begründet, auf die sie aufbaut: ,,Grundvoraussetzung des Funktionierens ist eine stabile Geldnachfrage."3 Des weiteren muss das Zwischenziel verlässlich steuerbar sein.
In der Praxis war keine Notenbank in der Lage diese Strategie konsequent einzusetzen.
4.3 Direktes Inflationsziel
Auch dieses Verfahren beruht auf einem sehr einfachen Gedanken.
Die Zentralbanken verkünden anstelle des Geldmengenziels im Vorhinein einen jährlichen Zielwert ( oder Zielkorridor ) für die von ihr angestrebten Inflationsrate, der aber noch mit dem Ziel der Geldwertstabilität übereinstimmen muss.
Es wird also versucht, mit dem zur Verfügung stehenden Instrumenten, die Inflation direkt zu steuern. Diese Strategie hat aber auch Voraussetzungen wie zum Beispiel, dass die Inflationsprognosen auf denen die Bestimmungen des Zielkorridors aufgebaut sind , zuverlässig sein müssen.
Das Problem des Inflationszieles ist, dass wenn es zu einer Senkung des Geldwertes kommt, es durchaus anderthalb Jahre dauern könnte, bis sich die Inflationsrate wieder in die gewünschte Richtung bewegt.
Dennoch haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Zentralbanken das Inflationsziel vor Augen gesetzt, wie zum Beispiel die Zentralbank von England oder die von Finnland und Schweden.
Wie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
man sehen kann, ist in allen Ländern, die Preissteigerungsrate seit Einführung des Inflationszieles deutlich zurückgegangen.
Der Vorteil für eine Verfolgung der Strategie, direktes Inflationsziel, ist, dass die Endzielstrategie transparenter ist, im Gegensatz zur Zwischenzielstrategie, und somit das Problem des fehlenden Rufes der EZB besser zu lösen wäre. Denn gerade die Transparenz wird als besondere Verpflichtung der EZB in der Anfangsphase gesehen.
5. Die Geldpolitischen Instrumente des ESZB
Es lassen sich drei Gruppen von geldpolitischen Operationen des ESZB unterscheiden. Das ESZB führt Offenmarktgeschäfte durch, bietet ständige Fazilitäten an und kann verlangen, dass Kreditinstitute Mindestreserven auf Konten im ESZB haben.
5.1 Offenmarktgeschäfte
Sie sind geldpolitische Operationen der Zentralbank direkt "am Markt" bei denen sie Wertpapiere oder Devisen kauft oder verkauft. Bei Offenmarktgeschäften geht die Initiative ausschließlich von der EZB aus. Sie entscheidet über Zeitpunkt, Laufzeit und Umfang der Offenmarktgeschäfte. Offenmarktgeschäfte dienen der Steuerung der Liquidität und der Zinssätze am Markt.
Unterteilt man die Instrumente hinsichtlich ihrer Zielsetzung, so lassen sich vier Arten unterscheiden:
1. Hauptrefinanzierungsinstrument: Diese befristeten Transaktionen werden
regelmäßig wöchentlich von den nationalen Zentralbanken durchgeführt. Sie führen dem Geldmarkt Liquidität zu und nehmen eine Schlüsselrolle unter den Instrumenten der Offenmarktpolitik ein, da sie den größten Teil des Refinanzierungsvolumens des Finanzsektors zur Verfügung stellen.
2. Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte: Dies sind befristete Transaktionen, die
monatlich von den nationalen Zentralbanken in der Form von Standardtendern mit
dreimonatiger Laufzeit durchgeführt werden. Sie dienen der Zuführung von Liquidität.
3. Feinsteuerungsoperationen: Sie können von den nationalen Zentralbanken meist als Schnelltender oder bilaterale Geschäfte durchgeführt werden. Das Ziel ist, Auswirkungen unerwarteter Liquiditätsschwankungen auf die Zinssätze auszugleichen. Sie werden unregelmäßig durchgeführt und haben keine festgelegt Laufzeit, da sie unter Umständen kurzfristig eingesetzt werden müssen. Bei den Feinsteuerungsoperationen kann es sich sowohl um liquiditätszuführende als auch um liquiditätsabsorbierende Geschäfte handeln.
4. Strukturelle Operationen: Sie dienen der Anpassung der strukturellen Liquiditätsposition des Finanzsektors gegenüber dem ESZB.
5.2 Mindestreserven
Kreditinstitute in der Europäischen Währungsunion müssen Mindestreserven auf Konten der nationalen Zentralbanken halten. Mindestreserven sind verzinsliche Einlagen. Die Höhe dieser Mindestreserven richtet sich nach den vom EZB - Rat festgelegten Mindestreservesätzen. Die Mindestreserve ist ein Instrument der EZB zur Steuerung des Geldumlaufs.
,,Durch eine Erhöhung des Mindestreservesatzes kann die EZB Liquidität der jeweiligen
nationalen Zentralbanken abschöpfen und damit die Geldschöpfungsmöglichkeit verringern. Durch eine Senkung des Mindestreservesatzes kann die EZB Liquidität freigeben und damit zusätzlich Giralgeldschöpfung ermöglichen."4
Das Mindestreservesystem hat im wesentlichen die folgenden Funktionen:
1. die Stabilisierung der Geldmarktzinssätze
2. die Herbeiführung bzw. Vergrößerung einer strukturellen Liquiditätsknappheit
Bei Nichterfüllung der geforderten Reserven, ist die EZB befugt, Sanktionen zunächst finanzieller Art zu verhängen. Bei Fortdauer der Nichterfüllung kann den nationalen Zentralbanken der Zugang zu den Offenmarktgeschäften und Ständigen Fazilitäten verboten werden.
5.3 Ständige Fazilitäten
Die ständigen Fazilitäten dienen dazu, den Banken zum Beispiel bei kurzfristigen Geldengpässen auszuhelfen. Ständige Fazilitäten sind ,,Kreditmöglichkeiten, die bei Bedarf in Anspruch genommen werden können."5 Durch Anheben oder Senken der Fazilitäten (der Kredit- und Einlagenzinsen) kann die Zentralbank die Höhe von Tagesgeldzinsen beeinflussen. Die ständigen Fazilitäten können von den Geschäftspartnern des ESZB auf eigene Initiative in Anspruch genommen werden.
6. Die Verfahrenstechniken
Bei den Offenmarktgeschäften ist regelmäßig als Durchführungsverfahren der Standardtender erwähnt worden. Er dürfte das meistverwendete Verfahren der EZB zur Durchführung von Transaktionen werden. Dieses Verfahren hat auch schon die Bundesbank für ihre Offenmarktgeschäfte an.
Die Verfahren, der Zeitrahmen und der Kalender wurden soweit möglich an den Bedürfnissen der Marktteilnehmer ausgerichtet. Bei der überwiegenden Mehrheit von Offenmarktgeschäften, nämlich bei den Hauptrefinanzierungsoperationen, den längerfristigen Refinanzierungsgeschäften und möglicherweise bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen, wird das EZB sich sogenannter Standardtender bedienen. Diese Standardtender werden innerhalb von 24Stunden nach der Bekanntmachung des Tenders durchgeführt. Der Zeitrahmen sieht hierbei die Bekanntgabe der Zuteilungsergebnisse innerhalb von zwei Stunden nach Ablauf der Gebotsfrist für Finanzinstitutionen vor.
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bankfeiertage in den Mitgliedstaaten wird ein Kalender für regelmäßige ESZB - Tenderoperationen erstellt werden, der sicherstellt, dass alle Geschäftspartner des Währungsraumes jederzeit an den längerfristigen Refinanzierungsgeschäften des ESZB teilnehmen können.
Gegenstand des Verfahrens ist eine "Auktion". Die Geschäftspartner ersteigern die Liquidität, indem sie entweder einen bestimmten Betrag (Mengentender) oder einen Betrag und Zinssatz (Zinstender) bieten. Ein gleichartiges Verfahren ist der Schnelltender, allerdings wird dieser in wenigen Stunden durchgeführt. Das Tenderverfahren beginnt mit der Ausschreibung seitens der EZB, wesentliche Angaben sind dabei, um welche Transaktion es sich dabei handelt, und ob das Geschäft als Mengen- oder Zinstender durchgeführt werden soll. Danach bieten die Geschäftspartner. Bei einem Mengentender ist der Zinssatz zu dem zugeteilt wird bekannt, die Geschäftspartner können also lediglich einen Betrag bieten. Bei einem Zinstender gibt die EZB keinen Zinssatz bekannt, zu dem sie zuteilen will, die Geschäftspartner können bis zu zehn Gebote mit unterschiedlichen Beträgen und Zinssätzen abgeben.
Nachdem die Gebote von der EZB zusammengefasst worden sind erfolgt die Zuteilung und Bekanntgabe der Zuteilungsergebnisse. Dazu hat die EZB bereits im voraus intern die Summe der gesamten Zuteilung festgelegt. Bis zu diesem Betrag wird dem Markt Liquidität in Form von Zentralbankgeld zur Verfügung gestellt.
Übersteigt bei einem Mengentender der Bietungsbetrag den Zuteilungsbetrag so werden alle Gebote repariert. Das heißt, es wird eine Zuteilung bis zum gewünschten Gesamtbetrag dem jeweiligen Geschäftspartner zugeteilt.
Übersteigt bei einem Zinstender der Bietungsbetrag den Zuteilungsbetrag, werden lediglich die Gebote repariert, die zum marginalen Zinssatz abgegeben wurden. Das sind die Gebote, die die Summe der Zuteilung über den eigentlich gewollten Betrag hinausgehen ließen. Bei einem Zinstender können die Beträge entweder zu einem Einheitszins, dem marginalen Zinssatz, zugeteilt werden (holländisches Verfahren) oder zu dem jeweils gebotenen Zinssatz (amerikanisches Verfahren). Üblicherweise findet das amerikanische Verfahren Anwendung, damit keine zu hohen Zinssätze geboten werden.
Die nationalen Zentralbanken beginnen ihre Tagesabschlussarbeiten um 18.30Uhr EZB- Zeit.
Diese ESZB- Verfahren zur Tagesendabstimmung wurden so gestaltet, dass den Geschäftspartnern größtmögliche Flexibilität geboten werden kann.
7. Schlusswort
Die EZB wird sich zwischen zwei Strategien entscheiden müssen, entweder sie verfolgt das Geldmengenziel oder das direkte Inflationsziel. Wichtig bei der Entscheidung wird die Frage sein, welche Strategie Transparenter ist.
Jedenfalls ist das Europäische System der Zentralbanken mit einem groß angelegten und sehr flexiblen Handlungsrahmen ausgestattet, der es ermöglicht, auch auf unvorhergesehene Schwankungen flexibel zu reagieren.
Würde die EZB das Geldmengenziel verfolgen, würde sie schon etwas Glaubwürdigkeit von der Deutschen Bundesbank übernehmen, da diese das Geldmengenziel erfolgreich verfolgt hatte.
Im Gegensatz dazu steht, dass man auch mit dem direkten Inflationsziel schnell an das Ziel ,Preisstabilität, gelangt, wie es uns die Graphik im Kapitel 4.3 zeigt.
So bleibt die Frage, welche Strategie es sein wird, noch offen.
8. Quellverzeichnis
- Professor Dr. Peter Schaal: Geldtheorie und Geldpolitik. R. Oldenbourg Verlag GmbH, Oldenbourg 1992
- Dr. Walter Lippens: Im Kreislauf der Wirtschaft. Bank- Verlag Köln, Köln 1997
- Hubert Reip u.a.: Volkswirtschaftslehre in Problemen. Verlag Dr. Max Gehlen, Bad Homburg vor der Höhe 1994
- Peter Bofinger u.a.: Geldpolitik: Ziele, Institutionen, Strategien und Instrumente, Verlag Franz Vahlen GmbH, München 1996
- Europäische Zentralbank (EZB): Die Einheitliche Geldpolitik in Stufe 3, Frankfurt am Main September 1998
- EZB: Jahresbericht 1998, Frankfurt am Main 1999
- EZB: Monatsbericht Januar 1999, Frankfurt am Main 1999
- EZB: Monatsbericht Februar 2000, Frankfurt am Main 2000
- Deutsche Bank, Institut der deutschen Wirtschaft Köln 1997 (Graphik)
[...]
1 P. Bofinger, J. Reischle, A. Schächter, Geldpolitik- Ziele, Institutionen, Strategien und
Instrumente, 1996 München, Seite 286
2 vgl.: EZB, Jahresbericht 1998, Frankfurt am Main 1999, Seite 51/52
3 Peter Bofinger u.a.: Geldpolitik: Ziele, Institutionen, Strategien und Instrumente, München 1996, S. 249
4 Hubert Reip, Volkswirtschaftslehre in Problemen, Stuttgart 1994, Seite 273
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB). Es erläutert die Strategien, Instrumente und Verfahrenstechniken, die die EZB zur Erreichung ihrer Ziele einsetzt.
Was sind die Ziele der EZB laut diesem Dokument?
Das Hauptziel der EZB ist die Gewährleistung der Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet. Dies wird durch die Verfolgung geldpolitischer Strategien und den Einsatz verschiedener Instrumente erreicht.
Welche geldpolitischen Strategien werden im Dokument diskutiert?
Das Dokument diskutiert zwei Hauptstrategien: das Geldmengenziel (eine Zwischenzielstrategie) und das direkte Inflationsziel (eine Endzielstrategie). Die EZB verfolgt beide Strategien, um die Preisstabilität sicherzustellen.
Was bedeutet die quantitative Definition von Preisstabilität der EZB?
Die EZB definiert Preisstabilität als einen Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet von unter 2 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Definition dient als Maßstab zur Beurteilung des Erfolgs der Geldpolitik.
Welche geldpolitischen Instrumente stehen der EZB zur Verfügung?
Die EZB verfügt über drei Hauptinstrumente: Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und Mindestreserven.
Was sind Offenmarktgeschäfte?
Offenmarktgeschäfte sind Operationen der Zentralbank auf dem Markt, bei denen sie Wertpapiere oder Devisen kauft oder verkauft. Diese Geschäfte dienen der Steuerung der Liquidität und der Zinssätze.
Was sind ständige Fazilitäten?
Ständige Fazilitäten sind Kreditmöglichkeiten, die Banken bei Bedarf in Anspruch nehmen können. Sie helfen bei kurzfristigen Geldengpässen. Die Zinsen auf diese Fazilitäten beeinflussen die Tagesgeldzinssätze.
Was sind Mindestreserven?
Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet müssen Mindestreserven auf Konten bei den nationalen Zentralbanken halten. Diese Reserven sind verzinslich und dienen der Steuerung des Geldumlaufs.
Wie funktionieren die Verfahrenstechniken der EZB?
Die EZB verwendet Standardtender und Schnelltender als Durchführungsverfahren für ihre Offenmarktgeschäfte. Diese Verfahren beinhalten Auktionen, bei denen Geschäftspartner Liquidität ersteigern, indem sie Gebote abgeben.
Was ist das Europäische Währungssystem (EWS)?
Das Europäische Währungssystem (EWS II) ist ein regionales System fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse. Es regelt das Verhältnis des Euros zu den Währungen jener EU-Staaten, die nicht an der Europäischen Währungsunion teilnehmen.
Was waren die drei Stufen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)?
Die WWU wurde in drei Stufen umgesetzt:
- Beseitigung von Hindernissen im innergemeinschaftlichen Verkehr (1990-1994).
- Gründung des Europäischen Währungsinstituts (EWI) in Frankfurt (ab 1994).
- Einführung der einheitlichen Währung (ab 1999).
Was ist das Europäische System der Zentralbanken (ESZB)?
Das ESZB besteht aus den nationalen Zentralbanken der EWU-Mitgliedsstaaten und der EZB. Die EZB ist das Spitzeninstitut des ESZB und für die Geldwertstabilität verantwortlich.
Welche Rolle spielen die nationalen Zentralbanken im ESZB?
Die nationalen Zentralbanken sind für die Ausführung der Beschlüsse der EZB zuständig und können mit Genehmigung der EZB Banknoten ausgeben.
- Citar trabajo
- Patrick Dittmers (Autor), 2000, Die geldpolitischen Strategien des Eurosystems, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97542