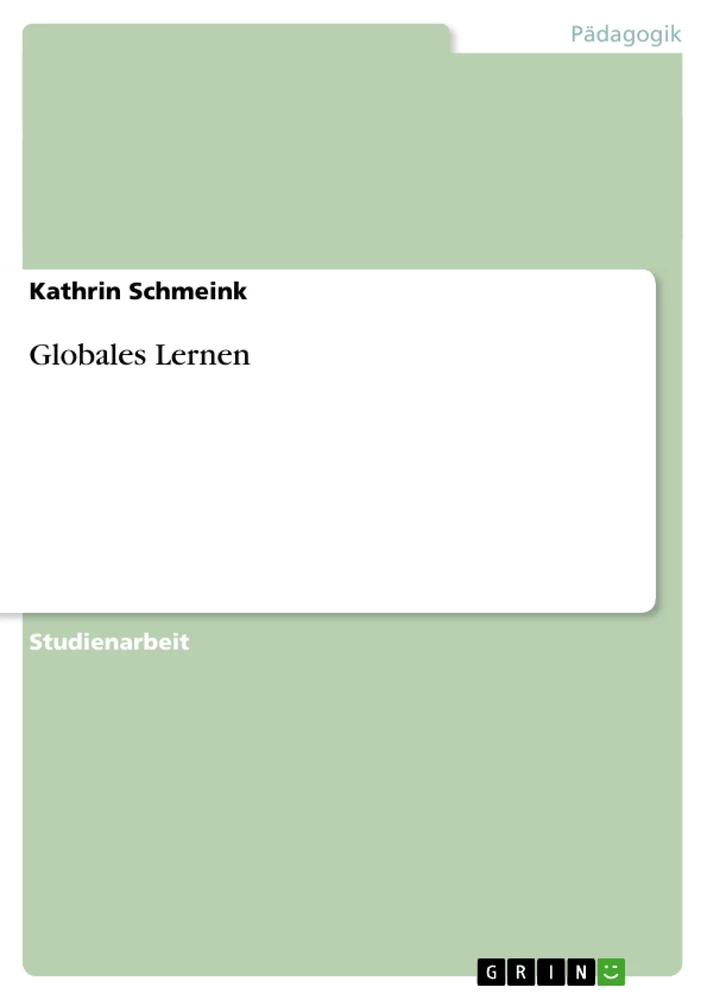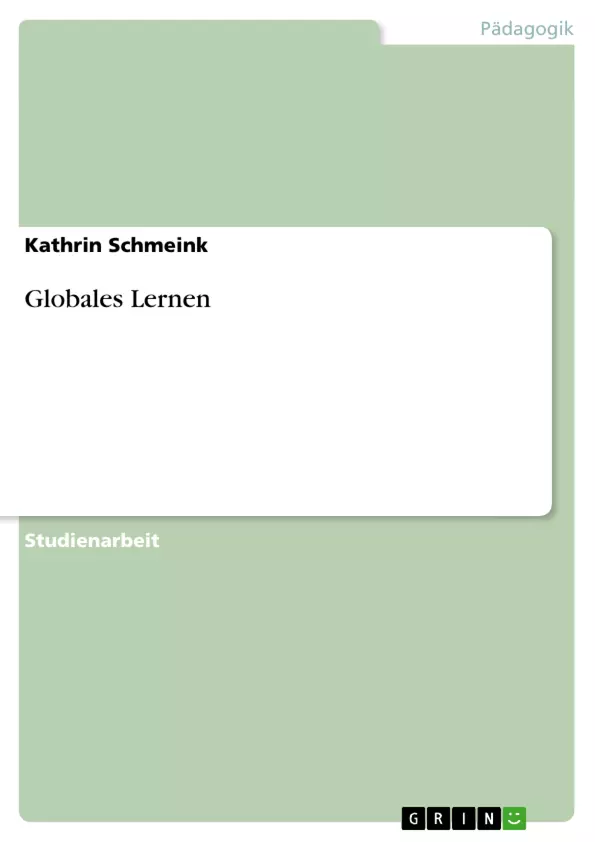Inhalt
1 Einleitung
2 Orientierungslinien und die Frage nach einer neuen Lernkultur
3 Erwartungen an die Pädagogik und ,,Globales Lernen" als Bildung
3.1 Erwartungen an die Pädagogik heute
3.2 Das Konzept kategorialer Bildung nach Klafki
3.3 Inklusives vs. exklusives Denken und die fünf Inklusionspaare Bühlers
4 Globales Lernen - eine Utopie?
5 Globales Lernen - Leitideen
5.1 Die erste Leitidee für globales Lernen
5.2 Die zweite Leitidee für globales Lernen
5.3 Die dritte Leitidee für globales Lernen
5.4 Die vierte Leitidee für globales Lernen
6 Der internationale Diskurs zu globalem Lernen
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Idee des globalen Lernens wird nach Ideen wie interkulturellem Lernen oder lebenslangem Lernen vor allem auch im Bereich der Erwachsenenbildung immer aktueller. Mehrere Autoren aus dem deutschsprachigen Raum haben sich in den letzten Jahren mit diesem Thema unter verschiedenen Aspekten befasst. So zum Beispiel Hans Bühler, der als interkultureller Schulpädagoge von einem Perspektivenwechsel hin zu globalem Lernen spricht1. Da Bühler sehr ausführlich versucht hat, globales Lernen darzustellen, soll sein 1996 verfasstes Buch ,,Perspektivenwechsel? : unterwegs zu ,,globalem Lernen"" den Leitfaden zu dieser Hausarbeit darstellen, auf dessen Basis ich versuchen werde, die Idee des globalen Lernens zu verdeutlichen. Weiterhin möchte ich versuchen, die elementare Bedeutung globalen Lernens im Bereich der Erwachsenenbildung herauszuarbeiten.
Vorwegnehmend sollte gesagt werden, dass es kein geschlossenes Konzept zu globalem Lernen gibt. Globales Lernen ist immer als offenes System zu verstehen: Globales Wissen soll zu einer zunehmenden Vernetzung der Welt und somit zur Verbesserung dieser beitragen.
Thomas Wizemann betrachtet Globales Lernen in seinem Artikel2 von den vier pädagogischen Lernfeldern ,,friedensbezogene Erwachsenenbildung", ,, entwicklungsbezogene Erwachsenenbildung", ,,ökologische Erwachsenenbildung" und ,,interkulturelle Erwachsenenbildung" aus und sieht globales Lernen als das Dachkonzept, das die zentralen Punkte dieser vier Richtungen miteinander zu vereinigen versucht. Insbesondere in der heutigen Zeit beschäftigen die Welt neuere, als global anzusehende Probleme - globale Herausforderungen:
So nimmt, vor allem in den Industriestaaten, der Verbrauch von Ressourcen stetig zu, ebenso wie die Umweltbelastungen.
Vor wenigen Wochen wurde die Bevölkerungszahl von sechs Milliarden auf der Erde überschritten und der Bevölkerungswachstum ist als exponentiell ansteigend zu sehen, was sich besonders in den Ländern des Südens auswirkt.
Ulrich Klemm spricht im Zusammenhang dieser Herausforderungen von ,,... globaler Komplexität, einem immer schneller werdenden Wandel von ökonomischer, sozialer und politischer Verfaßtheit und einem exponentiellen Wachstum an Wissen ..." 3. Dies alles sind große Herausforderungen auch an globales Lernen.
2 Orientierungslinien und die Frage nach einer neuen Lernkultur
Aufgrund der eben beschriebenen globalen Herausforderungen befasst sich Annette Scheunpflug, Wissenschaftliche Assistentin im Fachbereich Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, in ihrem 1996 zu diesem Thema erschienenen Artikel auch mit den pädagogischen Schlussfolgerungen, beispielsweise wie der Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität erlernt werden könnte, bzw. welche ,,Orientierungspflöcke" es für die Schule geben könnte4. Sie kommt dabei zu den folgenden fünf Ergebnissen:
a) ,,Problemorientierung":
Hier geht es um die richtige Auswahl des immer größer werdenden Wissens. Scheunpflug schlägt neben der Grundbildung die Begrenzung des Bildungskanons auf Problemfelder wie Umweltschutz, Ressourcenverbrauch, Bevölkerungswachstum, Krieg etc. vor.
b) ,,Abstraktes Lernen":
Das abstrakte Denken soll gefördert werden und mit handlungsorientierten Ansätzen verbunden werden. Die Pflicht der pädagogischen Reflexion wird nach Scheunpflug sein, ,,... als kognitive Erkenntnis sinnlicher Erfahrung vorauszulaufen. Sinnliche Erfahrung kann dann Mittel zum Zweck sein. Sie erfüllt ihren Wert für Erziehung erst durch die damit angestoßene Aufklärung und Reflexion."5
c) ,,Ein ü ben von Entscheidungsfreude und Methoden der Fragestellung":
Scheunpflug bezieht diese Forderung auf Ergebnisse der Kognitions-psychologie, die die Notwendigkeit des Fragestellens und der Entscheidungsfähigkeit für das Lernen beweisen.
d) ,,Aushalten von Unsicherheiten":
Während bisherige Konzepte von Bildung vor allem auf die Vermittlung von Sicherheit aus sind und Schulbücher durch Antworten diese Sicherheiten vermitteln, muss heute davon ausgegangen werden, dass aufgrund der überaus großen Wissensmengen Unwissenheit, Fremde und Ungewissheit vorherrschen, deren Umgang erlernt werden muss. Besonderen Wert legt Scheunpflug hier auf die didaktische Toleranz, die geübt werden muss.
e) ,,Kultivierung des Perspektivenwechsels":
Die Autorin beschreibt hier den ,,Verlust der Sicherheit der Beschreibung aus einer Perspektive..."6. Daher hält sie es für notwendig, mit den Jugendlichen Perspektivenwechsel einzuüben.
Überträgt man diese Orientierungslinien auf die Erwachsenenbildung, so stellt sich nach Klemm die Frage nach einer neuen Lernkultur, einer Lernkultur, die die folgenden drei Lernfelder gleichermaßen mit einschließt7:
- antizipatorisches Lernen: hierbei handelt es sich um ein vorausschauendes, innovationsorientiertes und kreativitätsförderndes Lernen.
- integratives Lernen: dies beinhaltet zum einen die Bemühung um die Verbindung von allgemeiner und berufsorientierter Weiterbildung, zum anderen die Verknüpfung von institutionellem und Alltagslernen.
- partizipatorisches Lernen: Klemm meint hier die Fähigkeit der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und ,,die Herstellung von Resonanz und Nachhaltigkeit individueller und kollektiver Erfahrungen (sowie Wissens) an die Wirklichkeit einer Weltgesellschaft."8
Außerdem führt Klemm noch die Notwendigkeit der Bereitstellung von Ermöglichungsorten für Bildung und Lernen im Sinne eines öffentlichen Auftrages an.
3 Erwartungen an die Pädagogik und ,,Globales Lernen" als Bildung
3.1 Erwartungen an die Pädagogik heute
Die Erwartungen an die Pädagogik sind in der heutigen Zeit, vor allem auch seitens der Nichtpädagogen, sehr hoch, weil ein Warten auf evolutionäre Sprünge nicht mehr genügend Zeit lässt, um drohendes Unheil abzuwehren.9 Die größte Gefahr für globales Lernen besteht laut Bühler darin, unter diesem hohen Erwartungsdruck ,,zu einem Erfüllungsgehilfen bei globalem Krisenmanagement zu werden".10
Globales Lernen will kritisch-konstruktiv sein. Es sollen Widersprüche erkannt werden, die sich aus der Situation eines jeden Menschen und dessen Recht auf ein gutes Leben ergeben:
Bühler erwähnt einen solchen Widerspruch11:
Es handelt sich um das Dilemma, das sich angesichts der Zukunftsaussichten des jungen Menschen heute ergibt: Einerseits hat er ein Recht auf größtmögliche Transparenz, also auch, was die negativen Seiten der Zukunft anbelangt, andererseits soll Schule auch Lust auf Zukunft machen, Zutrauen und Zuversicht vermitteln, was sich unter der Voraussetzung der Transparenz relativ schwierig gestalten könnte.
Ein derartiges Dilemma findet sich in allen Bereichen der Bildung.
3.2 Das Konzept kategorialer Bildung nach Klafki
In Anbetracht dieses für die Bildung immer geltenden Dilemmas hat Klafki 1991 sein Konzept kategorialer Bildung formuliert, in dem er drei Grundfähigkeiten unterscheidet12:
- die Fähigkeit zur Selbstbestimmung
- die Fähigkeit zur Mitbestimmung
- die Fähigkeit zur Solidarität
Diese drei elementaren Fähigkeiten wurden später von Bühler um fünf Inklusionspaare erweitert.
3.3 Inklusives vs. exklusives Denken und die fünf Inklusionspaare Bühlers
Bevor die Inklusionspaare Bühlers vorgestellt werden, soll zunächst das Begriffspaar ,,inklusives Denken" - ,,exklusives Denken" erklärt werden:
Inklusives Denken meint die Verknüpfung von ,,sowohl-als auch"-Inhalten, also die Fähigkeit, mehrere Alternativen nebeneinander zu betrachten ohne sie voreilig zu bewerten und gegenseitig auszuschließen. Demgegenüber steht das sogenannte ,,exklusive Denken", das auf ,,entweder-oder"-Verknüpfungen beruht. Jedoch kann exklusives Denken als Teil des inklusiven Denkens verstanden werden. Während inklusives Denken in der aktuellen Pädagogik oft als vernetztes Denken auftaucht13 und dem Bereich des Verstehens zugeordnet werden kann, ist exklusives Denken dem Bereich des Handelns zuzuordnen, denn wer handelt, der muss sich zunächst für eine unter mehreren Alternativen entscheiden: ,,entweder - oder". So wird verständlich, dass für globales Lernen das vernetzte Denken und somit das inklusive Denken unablässig sind.
Die fünf Inklusionspaare, die Bühler in seinem Buch vorschlägt, sind daher als vielfältig miteinander verknüpft zu verstehen:
a) Eindeutigkeit und Ambivalenz
b) Reduktion und Komplexität
c) Beschränktheit und Bescheidenheit
d) Borniertheit und Empathie
e) Egoismus und Parteilichkeit
Die ersten beiden Paare sind Merkmale der Beziehungen zwischen Individuen zu
,,Globalität", die anderen drei sind Spannungen, die sich daraus für die Individuen ergeben. Ich möchte die einzelnen Inklusionspaare nun kurz erläutern.
ad a) Eindeutigkeit und Ambivalenz
Im heutigen Schulsystem kommt es darauf an, immer mehr Wissen in immer kürzerer Zeit zu vermitteln. Hierfür sind Eindeutigkeit und Objektivität sehr förderlich. Dies kann aber nur so lange funktionieren, solange dem System Schule nur das bisher üblichere deterministische Paradigma unterlegt ist, nicht jedoch das holistische, das von einem ganzheitlichen Lernansatz ausgeht und durch globales Lernen gefördert wird. Es muss eine Balance zwischen Wissen und Gesetzmäßigkeiten zum einen und Ungewissem, Zufälligem und Unordnung zum anderen gefunden werden.14
ad b) Reduktion und Komplexit ä t
Das Leben der Menschen wird zunehmend komplizierter, insbesondere, so Bühler, da wir alle in Systemen leben und diese überleben umso leichter, je komplexer sie sind.15 Zum anderen ist jeder Mensch auf Reduktion von Komplexität aus, um die eigene Lage überhaupt bewältigen zu können. Didaktische Reduktion ist auch bei globalem Lernen notwendig, da nur so sehr komplexe Probleme, wie beipielsweise die ökologische Lage, zunächst einfach, dann aber mit der Zeit komplexer werdend erfasst werden können und nicht von einer unmittelbaren Einsicht ausgegangen werden kann. Es ist also sowohl Reduktion als auch Komplexität notwendig.
ad c) Beschr ä nktheit und Bescheidenheit
Beschränktheit und Bescheidenheit stellen ein Spannungsverhältnis dar. Es ist daher notwendig eine Balance zu finden, die zwischen einer bewussten Beschränkung, beipielsweise im Bereich des Konsumismus (also Bescheidenheit), und einer Entwicklung von alternativen Lebensstilen, die nicht Verzicht sondern neue Möglichkeiten bedeuten, liegt. Globales Lernen kann bedeutend zu dieser Balance beitragen, indem es für das Verstehen unterschiedlicher Lebensformen und Kulturen sorgt. Ein Beispiel hierfür wäre, dass reiche Menschen zu verstehen lernen, dass es auch in ärmeren Völkern sehr viel Zufriedenheit geben kann, die sich nicht durch Geld, sondern durch Lebensqualität auszeichnet.
ad d) Borniertheit und Empathie
Bühler geht hier16 besonders auf Fremdenfeindlichkeit ein, die auch in der heutigen Zeit noch vielerorts zu finden ist und das obwohl Migration eine der ältesten Grundtatsachen der Menschheit ist, die seit 4 Millionen Jahren existiert. Den wachsenden Fundamentalismus der Menschen sieht er begründet im Aushalten von Vieldeutigkeit und Komplexität in der heutigen Zeit und dem Versuch Angst und Ungewissheit innerhalb einer Kultur auszuhalten. Borniert ist nach Bühler nicht nur der Fremdenfeind selbst, ,,sondern auch derjenige, der sich über derlei Gewalttäter erhaben fühlt."17 Der Borniertheit gegenüber steht die Empathie, die nicht nur das Einfühlungsvermögen gegenüber Migranten einschließt, sondern auch das Verstehen derer, die aus ihrer Borniertheit heraus gewalttätig werden. Wiederum ist eine Balance notwendig, um jedem ein Recht auf eine offene Heimat zu gewährleisten.
ad e) Egoismus und Parteilichkeit
Beides, sowohl Egoismus als auch Parteilichkeit kann in sozialen Gruppen, aber auch in den meisten Individuen nebeneinander gefunden werden. Egoismus ist für die meisten Menschen notwendig, um sich ihr eigenes Überleben bzw. das einer sozialen Gruppe, gerade in kapitalistisch ausgerichteten Kulturen, zu sichern, Parteilichkeit im Sinne von Solidarität ebenso, da die soziale Gruppe andernfalls nicht funktionieren würde.
Die große Bedeutung der fünf hier vorgestellten Inklusionspaare wird deutlich, wenn man beachtet, dass sie in vielen der Richtzielen vorkommen, die zu den Leitideen für globales Lernen verfasst wurden. Diese werden im Kapitel 5 ,,Globales Lernen - Leitideen" ab Seite 13 ausführlich dargestellt.
4 Globales Lernen - eine Utopie?
Globales Lernen kann ohne utopisches Denken nicht auskommen, doch es darf nicht beim Denken bleiben. Lerninstitutionen sollen Orte der Begeisterung sein, also Orte, die die Lernenden dazu motivieren, die Welt, in der sie leben, nicht nur als Schicksal sondern auch als Aufgabe zu verstehen. Ein Problem stellt der meist vorhandene zu hohe Normalitätsdruck dar, der Utopien kaum noch zulässt.
Bühler verbindet die folgende konkrete Utopie mit globalem Lernen18:
- das Menschenbild: Der Mensch gilt weder als gut noch als böse, sondern er ist fähig zu beidem und offen für beides. Es wird aber eher das Gute erhofft.
- die Weltsicht: Der Mensch ist wichtiger Teil seiner Mitwelt. Er ist auf das Zusammenleben aller angewiesen.
- das Ziel: Ein gutes Leben für alle, anstatt Klarheit und Eindeutigkeit, die wenige für sich beanspruchen.
- Die Utopie ist in ihren Methoden gelassen. Es gibt keine totalen Konzepte, sondern nur behutsame, kleine Schritte. ,,Man kann sie erkennen am behutsamen Umgang mit sich und anderen, mit Ressourcen und mit Ideen. (...)
- Sie ist locker, spielerisch und kreativ nach innen und au ß en. Sie hat keine Angst vor dem Versagen, sondern vor dem Erstarren.
- Sie ist skeptisch gegen ü ber Patentl ö sungen, Sachzw ä ngen und Auslesen. Sie verweigert sich gegen ü ber der Maximierung nicht nur von Kapital, auch von Wissen und von Kontrolle."19
5 Globales Lernen - Leitideen
In diesem Kapitel möchte ich auf die vier Leitideen und die zugehörigen Richtziele eingehen, die das Schweizer Forum ,,Schule für eine Welt" im Jahr 1993 für globales Lernen verfasst und ausformuliert hat und somit einen großen Beitrag zum aktuellen Diskussionsstand leistete.20 Jede der vier Leitideen möchte ich anschließend kurz aus praktischer Sicht beleuchten.
Mit globalem Lernen ist hier einerseits gemeint, eine Einsicht in globale Zusammenhänge beim Lernenden entstehen zu lassen. Andererseits soll das aber nicht wie beim bisher üblichen Unterricht durch einseitig kognitive Instruktionen, sondern durch vielfältige und ganzheitliche Lernansätze geschehen.
,,Global denken, lokal handeln" gilt als der zentrale Slogan für globales Lernen, was besonders in der vierten Leitidee21 nochmals zum Ausdruck kommt.
In den folgenden Leitideen geht es um ganzheitliches Lernen, das eine globale Weltsicht, die Verknüpfung von globalem um lokalem, ein Denken in Zusammenhängen sowie Zusammenarbeit und Solidarität fördert. Außerdem habe ich versucht, jede der Leitideen kritisch zu beleuchten:
5.1 Die erste Leitidee für globales Lernen
Die erste Leitidee beschäftigt sich mit dem Thema Bildung, da Bildung die Einheit der menschlichen Gesellschaft, globale Zusammenhänge und die eigene Position und Teilhabe daran wahrzunehmen, fördert. Daher sollte der Bildungshorizont aller erweitert werden. Ein Richtziel dazu wäre, dass die Menschen erkennen, dass es verschiedene Traditionen und Weltbilder gibt, dass Menschen also das Weltsystem auf unterschiedliche Weise wahrnehmen. Weiterhin ist die Beschäftigung mit Fragen der Umwelt, also dem Menschen als Teil der Umwelt von Bedeutung. Das dritte Richtziel wäre, dass die Menschen erkennen, dass sie alle Mitglied einer einzigen Gattung mit vielen gleichen Grundbedürfnissen sind. Nicht zuletzt sollten die Menschen wahrnehmen, auf welche Weise einzelne und Gruppen im gesellschaftlichen und kulturellen System mitwirken.
Um diese Richtziele zu verwirklichen, ist es meiner Ansicht nach zunächst einmal notwendig, die Struktur der Bildung in weiten Teilen zu verändern. Zu allererst müsste Bildung wohl überall als Wert erkannt bzw. anerkannt werden. Alle Menschen sollten freien Zugang zu allen Bildungsmedien haben, also z.B. zu Bibliotheken, die sonst bestimmten Gruppen vorbehalten bleiben, oder zum Internet, auch müsste die Ausstattung flächendeckender gestaltet werden. Außerdem sollte es keine Wissenshierarchien zwischen den verschiedenen Ländern geben, sondern echtes globales, interkulturelles Lernen sollte im Vordergrund stehen.
5.2 Die zweite Leitidee für globales Lernen
Die zweite Leitidee zu globalem Lernen beinhaltet die Reflexion der eigenen Identität und die Verbesserung von Kommunikation. So wird im Menschen die Fähigkeit, die Welt auch mit anderen Augen zu sehen und auf Basis unterschiedlicher Betrachtungsweisen innerhalb der globalen Gesellschaft Urteile zu bilden, durch Bildung gefördert.
Das erste Richtziel zu dieser Leitidee beschäftigt sich mit der Chancengleichheit: Jeder sollte wahrnehmen, dass es verschiedene Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die wichtigsten Weltprobleme gibt, die für Individuen, Gemeinschaften und Nationen unterschiedlich groß sind. Weiterhin sollten die Lernenden sich Informationen beschaffen und diese verarbeiten, um sich eigenständige Urteile zu globalen Fragen bilden zu können. Außerdem sollten die Menschen erkennen, dass das bereits bestehende menschliche Erfahrungspotential auch für sie selbst relevant und für Gegenwart und Zukunft hilfreich sein kann. Alternative Zukunftsmodelle sollten von den Lernenden analysiert, bewertet und neu erschaffen werden, sowie Meinungen zu unterschiedlichen Themen und Problemen analysiert werden.
Im praktischen Bereich bedarf es zur Verwirklichung dieser Richtziele meiner Meinung nach der Förderung von Kommunikation und Toleranz im Sinne eines lebenslangen Lernens. Auch Selbstbewußtseins- und Rhetorik-Training, sowie soziale Kompetenz und die Reflexion von Medien spielen hier eine wichtige Rolle. Dies alles sind Gebiete, in denen vor allem die Erwachsenenbildung einen großen Beitrag leisten kann.
5.3 Die dritte Leitidee für globales Lernen
Das Schweizer Forum betitelt die dritte Leitidee mit der Überschrift ,,Lebensstil überdenken". Eigene Entscheidungen, eigenes Handeln oder auch Nichthandeln im Hinblick auf eine globale Gesellschaft sollten getroffen werden können, soziale sowie ökologische Folgen des Handelns und die Auswirkungen für eine zukünftige Entwicklung beurteilt werden können. Jeder Lernende sollte also seinen persönlichen Lebensstil reflektieren und gegebenenfalls verändern, wobei auch die Interessen anderer und Langzeitfolgen in Betracht gezogen werden.
Meiner Ansicht nach muß hierzu zunächst ein Bewusstsein um Verantwortung im einzelnen Individuum geweckt werden, das durch Bildung natürlich gefördert werden kann. Praktisch beleuchtet beinhaltet diese Leitidee das Schonen von Ressourcen ebenso wie die Toleranz und Akzeptanz fremder Kulturen bis hin zum sogenannten ,,sanften" Reisen. Ein ganzheitliches Denken in jedem Einzelnen ist also eine entscheidende Grundvoraussetzung, die dauerhaft gefördert werden muss.
5.4 Die vierte Leitidee für globales Lernen
Leitidee vier befasst sich mit der Verbindung von lokal und global und der handelnden Gestaltung des Lebens. Jeder einzelne sollte auf der Grundlage von Erfahrungen im Bereich des lokalen Handelns und in Zusammenarbeit mit anderen dazu beitragen, auch globale Herausforderungen zu bewältigen.
Jeder Mensch sollte aufgrund seiner eigenen Entscheidungen bezüglich seines persönlichen Lebensstils22, seiner Berufswahl etc. sowie des kulturellen, sozialen und politischen Engagements, also durch soziale und politische Tätigkeiten, Einfluss ausüben. Der Mensch sollte sich als ein Mitglied der globalen Gesellschaft begreifen.
Es muss also meiner Meinung nach bereits auf kleinster lokaler Ebene ein Gemeinschaftssinn geschaffen werden, der sich jedoch größeren Ebenen nicht verschließt - Toleranz steht also wieder im Mittelpunkt. Jeder sollte hier die Möglichkeit haben, seine persönlichen Erfahrungen mit einzubringen, sei es in Arbeitsgruppen, sozialen oder politischen Vereinigungen. Nur so kann Einfluß genommen werden, sowohl im Bereich der Umwelt oder des Friedens als auch im Bereich der Menschenrechte.
6 Der internationale Diskurs zu globalem Lernen
Globales Lernen muss auch im internationalen Diskurs betrachtet werden, da es zum einen von einer weltweiten Verwirklichung abhängt und zum anderen auf dieselbe abzielt. Zur Erinnerung hier nochmals der Leitsatz zu globalem Lernen: Global denken, lokal handeln.
An dieser stelle soll auf die beiden UN-Organisationen UNESCO und UNICEF eingegangen werden, ,,die sich seit langer Zeit und vielfältig um Erziehung für eine heraufziehende Weltgesellschaft kümmern ..."23. Bühler beschreibt in diesem Zusammenhang seinen Eindruck, es würde an theoretischen Konzepten und einem weitgehenden Konsens auf UNEbene nicht mangeln, sondern es seinen die verschiedenen ,,Aktionen, die von der gemeinsamen Überzeugung getragen sind, daß Globalität die menschenwürdigste Perspektive für das Überleben der gesamten Menschheit darstellt."24
Bei der UNESCO stellt ,,Internationale Erziehung" den Oberbegriff für die verschiedenen Teilbereiche globalen Lernens dar. ,,Internationale Erziehung" wird ausdifferenziert in Friedenserziehung, Menschenrechte und Demokratie, internationale Verständigung und Toleranz. Zur Durchsetzung aller konkreten Ziele, die diesem allgemeinen Ziel zugeordnet sind, wie z.B. der Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen oder der Fähigkeit, Konflikte ohne Gewalt zu lösen, wurden eine Vielzahl von Strategien vorgeschlagen. Solche sind z.B. ganzheitliche Unterrichtsmethoden, die Überarbeitung von Unterrichtsmaterialien, um diese von diskriminierenden Stereotypen zu befreien, die Öffnung und Deregulierung der Schulen, die Intensivierung der LehrerInnenaus- und -fortbildung, Aktionen zum Schutze besonders gefährdeter Gruppen und eine regionale und internationale Vernetzung, um nur einige wichtige zu nennen.
Um diesen Zielvorstellungen näher zu kommen, hat die UNESO zum einen ,,normative Dokumente", die als moralisch verpflichtend gelten, und zum anderen Materialien entwickelt. Außerdem sind seit dem Jahr 1954 über 3000 UNESCO-Schulen in insgesamt 123 Staaten entstanden und die UNESCO verfügt weiterhin über ein permanentes Berichts- und Evaluierungssystem.
Die UNICEF, das Kinderhilfswerk der UN hat ein Konzept zu globalem Lernen mit dem Namen ,,Bildung zur Entwicklung" erstellt. Das Rahmenkonzept besteht aus sechs Basiselementen, die durch die drei Dimensionen Raum, Zeit und Ganzheit miteinander verbunden sind25:
- Weltweite wechselseitige Abh ä ngigkeit: Es muss das Verständnis für die vielfältige Abhängigkeit der Weltbevölkerung um zu überleben und sich weiterzuentwickeln, erlernt werden.
- Weltweite Zusammenarbeit: Nur durch Kooperation im Alltag kann sich in der Welt etwas verändern.
- Weltbilder und Wahrnehmung: Diese müssen relativiert werden, um sich an der Vielfalt der Lebens zu erfreuen, aber auch um Rassismen rechtzeitig zu erkennen.
- Zukunftsvisionen: Sie sind ein wichtiger Teil der menschlichen Entwicklung und bringen kreative Veränderungsanstöße
- Soziale Gerechtigkeit: Sie muss erkannt werden zum einen ,,durch die vielseitigen Möglichkeiten der Mißachtung ... und Verwirklichung der Menschen rechte mittels wirtschaftlicher, sozialer, politischer und auch kultureller Faktoren."26
- Konflikt/Konfliktl ö sung: sie müssen bereits in ihren Ursachen erkannt werden und es muss gelernt werden, wie auf allen Ebenen für den Frieden gearbeitet und zu einer Lösung von Konflikten beigetragen werden kann.
Auch die UNICEF legt den Schwerpunkt ihrer Strategien auf die LehrerInnenfortbildung, die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien spielt hier eine geringere Rolle.
UNICEF und UNESCO stimmen in großen Teilen ihrer Konzepte zu globalem Lernen miteinander überein, jedoch gibt es auch einige gravierende Unterschiede. So liegt die Hauptaufgabe der UNESCO eher im Bereich des politischen Lobbying auf Regierungsebenen und ihr Konzept kann in der Schulpraxis, außer in den UNESCO-Schulen selbst, kaum vorgefunden werden. Die UNICEF hingegen hat viel konkretere Vorstellungen von globalem Lernen im Unterricht, jedoch sind ihre Mittel viel zu beschränkt, um größere Aktionen ihrerseits erwarten zu können.
Dennoch wird deutlich, dass globales Lernen eine sehr hohe Priorität in den dafür zuständigen Weltorganisationen hat und heutzutage wichtiger ist denn je.
Globales Lernen muss über die Umweltfrage hinausgehend eine Art WeltbürgerInnenkunde in die Schulen einziehen lassen. Doch dies allein darf nicht ausreichen. Neue Lehr- und Lernmethoden sind notwendig, die sich dem holistischen Paradigma und dem inklusiven Denken, wie es Bühler beschrieben hat, öffnen. Globales Lernen befindet sich in einem Entwicklungsprozess und wie bereits zu Beginn dieser Hausarbeit erwähnt gibt es kein geschlossenes Konzept zu globalem Lernen, sondern globales Lernen ist als offenes System zu verstehen, zu dessen Umsetzung wir alle, jeder einzelne von uns, beitragen sollten, sei es nur auf kleinster lokaler Ebene.
7 Literaturverzeichnis
Bühler, H.: Perspektivenwechsel? : unterwegs zu ,,globalem Lernen", Frankfurt am Main, 1996
Klemm U.: Globales Lernen in der Erwachsenenbildung. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (ZEP), 21. Jahrgang, Heft 3, September 1998
Klafki, W.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik, Weinheim, 1991
Scheunpflug, A.: Die Entwicklung zur globalen Weltgesellschaft als Herausforderung für das menschliche Lernen. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (ZEP), 19. Jahrgang, Heft 1, März 1996
Wizemann, T.: Globales Erwachsenen-Lernen. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (ZEP), 22. Jahrgang, Heft 3, September 1999
Sekundärliteratur
Datta, A.: Wozu Bildung im Zeitalter der Globalisierung. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (ZEP), 22. Jahrgang, Heft 2, Juni 1999
Schreiber, J.-R.: Globales Lernen für eine zukunftsfähige Entwicklung. Plädoyer für ein Unterrichtsprinzip. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (ZEP), 19. Jahrgang, Heft 1, März 1996
Globales Lernen Kathrin Schmeink
[...]
1 vgl. Bühler, 1996
2 Wizemann, 1999
3 Klemm, 1998, S. 19
4 vgl. Scheunpflug, 1996, S. 12 - 14
5 Scheunpflug, 1996, S. 13
6 Scheunpflug, 1996, S. 14
7 vgl. Klemm, 1998, S. 19
8 Klemm, 1998, S. 19
9 vgl. Bühler, 1996, S. 149
10 Bühler, 1996, S. 150
11 Bühler, 1996. S. 150
12 Bühler, 1996, S. 150
13 vgl. hierzu auch Bühler, 1996, S. 40
14 vgl. Bühler, 1996, S. 155
15 vgl. Bühler, 1996, S. 155/156
16 Bühler, 1996, S. 160/161
17 Bühler,1996, S.161
18 vgl. Bühler 1996, S. 173
19 Bühler, 1996, S. 174
20 Das gesamte Kapitel ,,5 Globales Lernen - Leitideen" bezieht sich auf: Bühler, 1996, S. 192-195
21 vgl. S. 15
22 vgl. ,,Die dritte Leitidee für globales Lernen" auf Seite 14
23 Bühler, 1996, S. 201
24 Bühler, 1996, S. 203
25 übernommen aus: Bühler, 1996, S. 209 ff.
Häufig gestellte Fragen zu "Globales Lernen"
Was ist das Hauptthema des Textes "Globales Lernen"?
Der Text "Globales Lernen" behandelt die Idee des globalen Lernens als Konzept in der Erwachsenenbildung und seine Bedeutung angesichts globaler Herausforderungen wie Ressourcenverbrauch, Bevölkerungswachstum und zunehmender Komplexität der Welt.
Welche "Orientierungslinien" werden im Text für eine neue Lernkultur genannt?
Die Orientierungslinien umfassen Problemorientierung, abstraktes Lernen, das Einüben von Entscheidungsfreude und Methoden der Fragestellung, das Aushalten von Unsicherheiten und die Kultivierung des Perspektivenwechsels.
Welche drei Lernfelder sind laut Klemm für eine neue Lernkultur wichtig?
Klemm nennt antizipatorisches Lernen, integratives Lernen und partizipatorisches Lernen als gleichermaßen wichtige Lernfelder.
Was sind die drei Grundfähigkeiten im Konzept kategorialer Bildung nach Klafki?
Klafki unterscheidet die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, die Fähigkeit zur Mitbestimmung und die Fähigkeit zur Solidarität.
Was sind die fünf Inklusionspaare Bühlers und was bedeuten sie?
Die fünf Inklusionspaare sind:
a) Eindeutigkeit und Ambivalenz
b) Reduktion und Komplexität
c) Beschränktheit und Bescheidenheit
d) Borniertheit und Empathie
e) Egoismus und Parteilichkeit
Sie beschreiben Spannungsfelder, die bei der Auseinandersetzung mit globalen Zusammenhängen entstehen und die es auszubalancieren gilt.
Welche "konkrete Utopie" verbindet Bühler mit globalem Lernen?
Bühler verbindet damit ein Menschenbild, das den Menschen weder als gut noch als böse sieht, eine Weltsicht, die den Menschen als wichtigen Teil seiner Mitwelt begreift, und das Ziel, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, sowie Methoden, die gelassen, spielerisch und kreativ sind und sich gegen Patentlösungen und Maximierung verweigern.
Was sind die vier Leitideen für globales Lernen des Schweizer Forums "Schule für eine Welt"?
Die vier Leitideen sind: Bildung zur Wahrnehmung globaler Zusammenhänge, Reflexion der eigenen Identität und Verbesserung von Kommunikation, Überdenken des eigenen Lebensstils und die Verbindung von lokalem und globalem Handeln.
Welche Rolle spielen UNESCO und UNICEF im internationalen Diskurs zu globalem Lernen?
UNESCO und UNICEF engagieren sich für Erziehung für eine Weltgesellschaft. Die UNESCO setzt auf "Internationale Erziehung" mit Schwerpunkten auf Friedenserziehung, Menschenrechte und Demokratie. UNICEF hat ein Konzept namens "Bildung zur Entwicklung" mit sechs Basiselementen entwickelt.
Welche Kritik wird an den Konzepten von UNESCO und UNICEF geübt?
Es wird kritisiert, dass das Konzept der UNESCO in der Schulpraxis kaum vorkommt, während die Mittel von UNICEF begrenzt sind.
- Citation du texte
- Kathrin Schmeink (Auteur), 2000, Globales Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97580