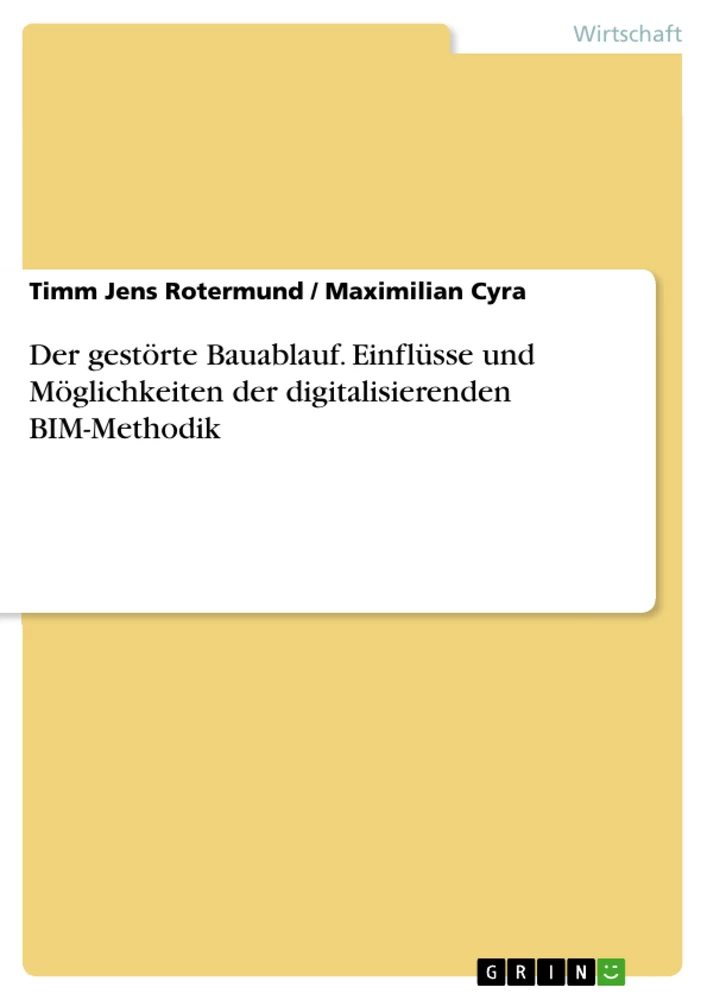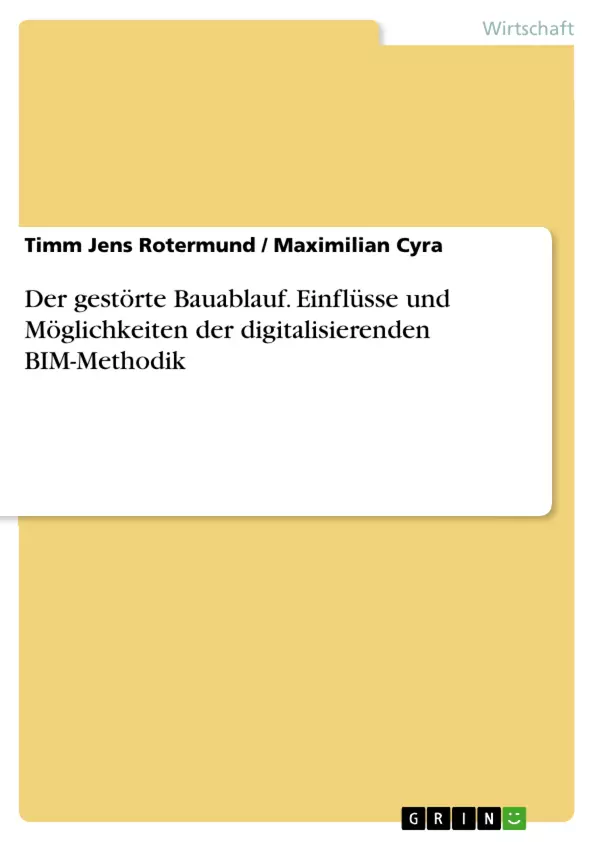Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung eines gestörten Bauablaufs. Zunächst werden hierfür Störungen im Bauablauf erläutert. Anschließend wird auf die Bauzeitverlängerung eingegangen und verschiedene Darstellungsmöglichkeiten dargelegt. Hier steht insbesondere die Organisation und Terminsteuerung sowie die Stufen der Ablaufplanung im Fokus. Danach wird ein Netzplan erarbeitet.
Im nächsten Kapitel werden die Mehrkosten behandelt. Hier wird auf die baubetrieblichen Methoden, die Verfahren der Kostenplanung sowie auf die Ansprüche des Auftragnehmers und Auftraggebers eingegangen. In Kapitel 4 werden die Darstellungsmöglichkeiten eines gestörten Bauablaufs diskutiert. Im Anschluss werden die Einflüsse und Möglichkeiten der digitalisierten BIM-Methodik dargestellt. Abschließend wird der aktuelle Stand der Forschung, konkret das digitale Bauen in Deutschland, dargelegt.
Der Bauablauf ist ein hochgradig komplexes Unterfangen, welches nicht selten fehlerhaft vonstattengeht. Dabei ist es egal, wie oder warum eine Störung im Bauablauf vorliegt. Eine Störung ist immer mit Folgen verbunden, die im Rahmen von Kosten, Zeit oder gar Stillstand beziehungsweise Abbruch eines Unterfangens auftreten können.
Inhaltsverzeichnis
- Störungen im Bauablauf
- Kausalzusammenhang
- Kausalitätsnachweis
- Art der Störung
- Unterscheidung der verschiedenen Bauleiter
- Der Auftragnehmer als Verursacher
- Der Auftraggeber als Verursacher
- Bauzeitverlängerung und Darstellungsmöglichkeiten
- Organisation und Terminsteuerung
- Stufen der Ablaufplanung
- Der Netzplan
- Pufferzeiten
- Kritischer Weg (CPM)
- Störungsmodifizierter Ablauf (Soll)
- Mehrkosten
- Baubetriebliche Methoden
- Verfahren der Kostenplanung
- Ansprüche des Auftragnehmers
- Bauzeitverlängerung
- Schadensersatz
- Entschädigung
- Vorläufige Abrechnung
- Ansprüche des Auftraggebers
- Schadensersatz
- Kündigung
- Darstellungsmöglichkeiten eines gestörten Bauablaufs
- Vorstellung von Methoden des Projektmanagements
- Netzplantechnik
- Function Modeling Method IDEFO
- Business Process Model Notation (BPMN)
- Begriffe und Definitionen
- Einflüsse und Möglichkeiten der digitalisierenden BIM-Methodik
- Begrifflichkeiten und Definitionen
- Building Information Modeling (BIM)
- Modellierung
- Vom 2D-Modell bis hin zur 4D- und 5D-Modellierung
- 2D-Modell 3D-Modell
- BIM 4D-Modell
- BIM 5D-Modell
- Nutzer und Rollen
- Nutzer Anwender
- Rollen
- Industry Foundation Classes (IFC)
- Automatische Kollisionskontrolle
- Building Information Modeling in der Praxis
- BIM im Planungsprozess
- BIM in der Bauausführung
- Prozessoptierungen durch dynamischen Datenpool
- Reibungslose Zusammenarbeit der Projektbeteiligten
- Datenqualität und Kontrollmechanismen
- Prozessmodellierung
- Einbindung von Projektmanagementmethoden
- Richtlinien und Leitfäden
- Anwendung der Netzplantechnik in der BIM-Methodik
- Anwendung der Function Modeling Method - IDEF0 und Business Process Model and Notation (BPMN)
- Profit der BIM-Methodik
- Fallstudie: Mehrkosten durch mangelnde Interoperabilität
- Stand der Einführung
- Stand der Einführung in Deutschland
- In drei Stufen zum digitalen Bauen
- Pflichten für Verkehrsinfrastruktur-Projekte
- Pflichten für Projekte im Hochbau
- Stand der Einführung international
- Building Information Modeling unter kritischer Betrachtung
- Warum überhaupt digitalisieren?
- Mehrkosten durch Anwendung der BIM-Methodik im Projekt
- Erfahrungsberichte von BIM-Anwendern
- Kritische Betrachtung eines Gutachterteams
- BIM - eine variierende Methodik
- Stand der Forschung
- Digitales Bauen in Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit den komplexen Herausforderungen, die ein gestörter Bauablauf mit sich bringt. Sie analysiert die Ursachen, Auswirkungen und Lösungsansätze für Störungen im Bauablauf. Darüber hinaus untersucht sie die Möglichkeiten der digitalen BIM-Methodik zur Optimierung von Bauprozessen und zur Vermeidung von Störungen.
- Kausalzusammenhang und Nachweis von Störungen im Bauablauf
- Untersuchung der verschiedenen Arten von Störungen und deren Folgen
- Analyse der rechtlichen Ansprüche von Auftragnehmer und Auftraggeber im Falle von Störungen
- Darstellungsmöglichkeiten eines gestörten Bauablaufs mithilfe von Projektmanagementmethoden
- Einfluss und Möglichkeiten der digitalisierenden BIM-Methodik im Bauprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel untersucht den Kausalzusammenhang und die Ermittlung der Verantwortlichkeit für Störungen im Bauablauf. Es werden verschiedene Arten von Störungen und deren Auswirkungen auf den Bauprozess betrachtet.
- Kapitel zwei befasst sich mit der Bauzeitverlängerung und den Möglichkeiten zur Darstellung eines gestörten Bauablaufs. Es werden die relevanten Methoden des Projektmanagements vorgestellt, wie z.B. die Netzplantechnik.
- Kapitel drei analysiert die Mehrkosten, die aus einem gestörten Bauablauf resultieren. Es werden die rechtlichen Ansprüche von Auftragnehmer und Auftraggeber im Falle von Störungen dargelegt.
- Das vierte Kapitel beleuchtet die Darstellungsmöglichkeiten eines gestörten Bauablaufs mithilfe von verschiedenen Methoden des Projektmanagements, wie z.B. der Netzplantechnik und der Function Modeling Method IDEFO.
- Kapitel fünf befasst sich mit den Einflüssen und Möglichkeiten der digitalisierenden BIM-Methodik im Bauprozess. Es werden die Begrifflichkeiten und Definitionen von BIM sowie die verschiedenen Anwendungsgebiete von BIM im Bauwesen dargestellt.
Schlüsselwörter
Störungen im Bauablauf, Kausalzusammenhang, Kausalitätsnachweis, Bauzeitverlängerung, Mehrkosten, Projektmanagement, Netzplantechnik, BIM, Building Information Modeling, Digitalisierung, Bauprozess, Interoperabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem gestörten Bauablauf?
Eine Störung liegt vor, wenn der tatsächliche Bauablauf (Ist) von der ursprünglichen Planung (Soll) abweicht, was zu Bauzeitverlängerungen und Mehrkosten führt.
Wie hilft BIM (Building Information Modeling) bei Baustörungen?
BIM ermöglicht durch 4D- und 5D-Modellierung eine präzisere Planung von Zeit und Kosten sowie eine automatische Kollisionskontrolle, wodurch Störungen frühzeitig vermieden werden können.
Was ist der "Kritische Weg" (CPM) in der Bauplanung?
Der kritische Weg umfasst die Abfolge von Vorgängen, bei denen keine Pufferzeiten existieren; jede Verzögerung hier führt direkt zu einer Verlängerung der Gesamtbauzeit.
Welche Ansprüche hat ein Auftragnehmer bei Bauverzögerungen?
Er kann Ansprüche auf Bauzeitverlängerung, Schadensersatz oder Entschädigung geltend machen, sofern der Auftraggeber die Störung zu vertreten hat.
Was ist der Unterschied zwischen 3D-, 4D- und 5D-BIM?
3D bezieht sich auf das geometrische Modell, 4D ergänzt die Zeitkomponente (Terminplanung) und 5D integriert zusätzlich die Kostenplanung in das Modell.
- Quote paper
- Timm Jens Rotermund (Author), Maximilian Cyra (Author), 2019, Der gestörte Bauablauf. Einflüsse und Möglichkeiten der digitalisierenden BIM-Methodik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/976538