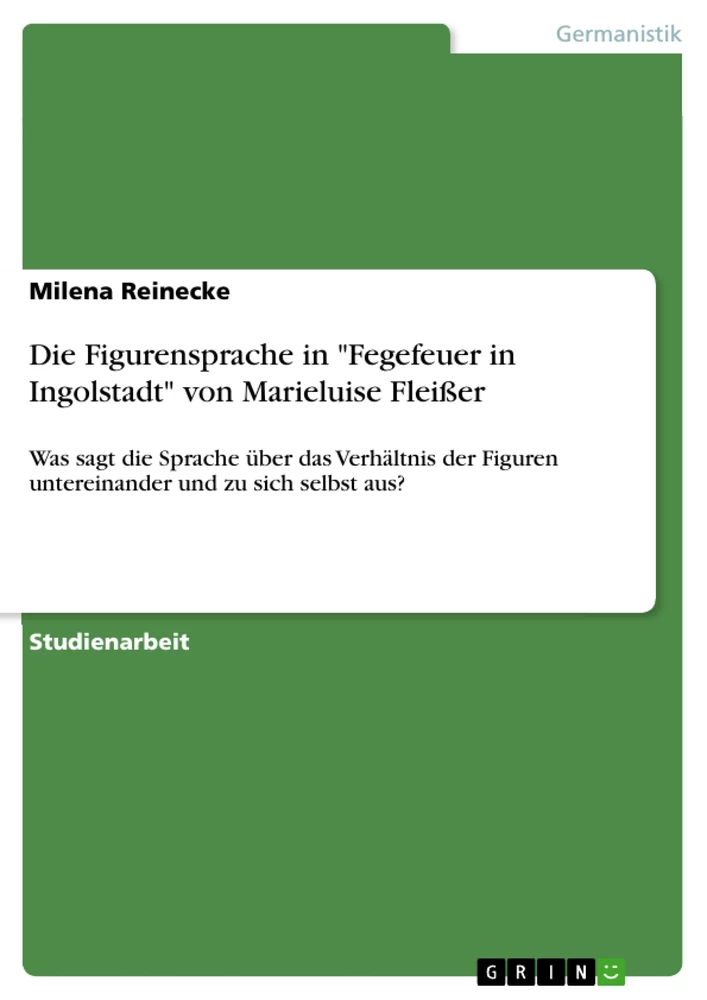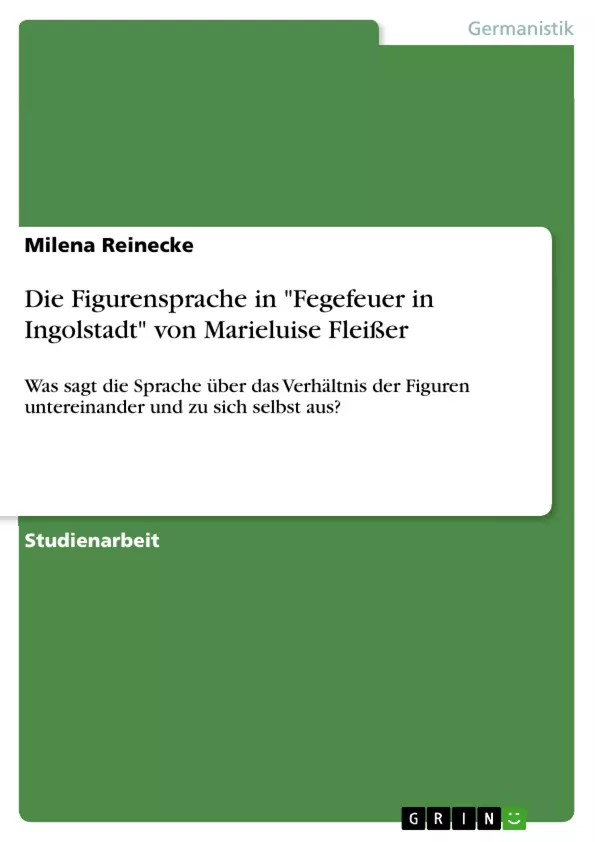In meiner Arbeit werde ich zunächst den Inhalt von „Fegefeuer in Ingolstadt“ von Marieluise Fleißer wiedergeben, um mich dann der Sprache zu widmen. Zunächst werde die Vermutung widerlegen, dass Fleißer auf ein repräsentatives Abbild der Umgangssprache abzielt. Im Anschluss werde ich herausarbeiten, worin die stilistischen Auffälligkeiten in der Figurensprache bestehen und welche Aussagen sich daraus über die Figurenkonstellation in „Fegefeuer in Ingolstadt“ ableiten lassen. Danach werde ich die Rolle der Religion hinsichtlich Sprache und Identität der Jugendlichen darstellen und zum Schluss eine zusammenfassende Deutung formulieren. In meinen Untersuchungen werde ich mich überwiegend auf das Gespräch zwischen Olga, Clementine und Berotter konzentrieren, welches hinsichtlich der Kommunikation als Essenz des ganzen Dramas zu lesen ist.
Marieluise Fleißers 1924 veröffentlichtes Erstlingswerk „Fegefeuer in Ingolstadt“ ist ein expressionistisches Drama über das räumlich und geistig beengte Leben eines Rudels Gymnasiasten im Ingolstadt der 1920er Jahre. Einerseits von den Werken Brechts und den Äußerungen Feuchtwangers, andererseits von ihrer eigenen katholischen Klostererziehung geprägt, stellt Fleißers Sprachstil in „Fegefeuer in Ingolstadt“ eine ungewöhnliche Mischung aus bayrischer Mundart und Katechismusdiktion dar. Ferner ziehen sich syntaktische Fehler durch die Figurensprache, Konjunktionen werden fehlverwendet und sinnentfremdet. Jene Beispiele für die stilistischen Eigenheiten werfen die Frage nach der Intention der Autorin auf. Strebt Marieluise Fleißer nach einer authentischen Momentaufnahme der Umgangssprache zum Zweck einer naturalistischen Milieustudie oder lassen sich die auffälligen Elemente ihrer Kunstsprache zu Deutungshypothesen über die Verhältnisse innerhalb der Gruppe Jugendlicher abstrahieren, die den Mittelpunkt des Dramas bildet?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung ins Fegefeuer
- Inhalt des Stücks
- Authentizität der Figurensprache
- Kommunikation in der ersten Szene
- Einfluss der Religion auf die Sprache
- Deutung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Sprache der Figuren in Marieluise Fleißers „Fegefeuer in Ingolstadt“ und untersucht, wie diese ihr Verhältnis zueinander und zu sich selbst widerspiegelt. Sie betrachtet die sprachlichen Eigenheiten des Dramas und analysiert, ob es sich um eine authentische Momentaufnahme der Umgangssprache oder um eine bewusst gewählte Kunstsprache handelt.
- Analyse der sprachlichen Eigenheiten der Figuren
- Untersuchung der Intention Fleißers: Authentizität oder Kunstsprache?
- Bedeutung der Sprache für die Darstellung der Figurenkonstellation
- Einfluss der Religion auf die Sprache und die Identität der Jugendlichen
- Deutung der sprachlichen Besonderheiten im Hinblick auf das Verhältnis der Figuren untereinander und zu sich selbst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Stück „Fegefeuer in Ingolstadt“ und die Thematik der Arbeit ein. Sie stellt die zentralen Figuren und die Handlung des Dramas kurz vor. Im Anschluss wird die Frage nach der Authentizität der Figurensprache thematisiert. Es wird analysiert, ob Fleißer eine realistische Darstellung der Umgangssprache oder eine Kunstsprache anstrebt. Im Folgenden werden die sprachlichen Besonderheiten der Figuren untersucht, insbesondere der Einfluss der Religion auf die Sprache. Abschließend wird eine zusammenfassende Deutung der sprachlichen Eigenheiten im Hinblick auf das Verhältnis der Figuren untereinander und zu sich selbst formuliert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der Figurensprache in Marieluise Fleißers „Fegefeuer in Ingolstadt“. Sie analysiert sprachliche Besonderheiten, insbesondere den Einfluss des bairischen Dialekts und der religiösen Sprache auf die Figuren. Die zentralen Themen sind Authentizität der Sprache, Kunstsprache, Figurenkonstellation, Kommunikation, Identität und Religion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Sprache in „Fegefeuer in Ingolstadt“?
Marieluise Fleißer verwendet eine ungewöhnliche Kunstsprache, die eine Mischung aus bayrischer Mundart, Katechismusdiktion und bewussten syntaktischen Fehlern darstellt.
Wollte Fleißer die Umgangssprache realistisch abbilden?
Nein, die Arbeit zeigt, dass Fleißer nicht nach einem rein naturalistischen Abbild strebt, sondern die Sprache stilisiert, um die geistige Beengtheit und die Konflikte der Jugendlichen auszudrücken.
Welchen Einfluss hat die Religion auf die Figurensprache?
Die religiöse Erziehung spiegelt sich in einer „Katechismusdiktion“ wider, die die Identität der Jugendlichen prägt und oft im Kontrast zu ihren tatsächlichen Gefühlen und Handlungen steht.
Worum geht es in dem Drama „Fegefeuer in Ingolstadt“?
Es ist ein expressionistisches Stück über das räumlich und geistig beengte Leben einer Gruppe von Gymnasiasten im Ingolstadt der 1920er Jahre.
Welche Rolle spielen syntaktische Fehler im Text?
Die Fehler und sinnentfremdeten Konjunktionen dienen dazu, die gestörte Kommunikation und die Unfähigkeit der Figuren, sich wirklich auszudrücken, zu verdeutlichen.
- Citar trabajo
- Milena Reinecke (Autor), 2020, Die Figurensprache in "Fegefeuer in Ingolstadt" von Marieluise Fleißer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/976999