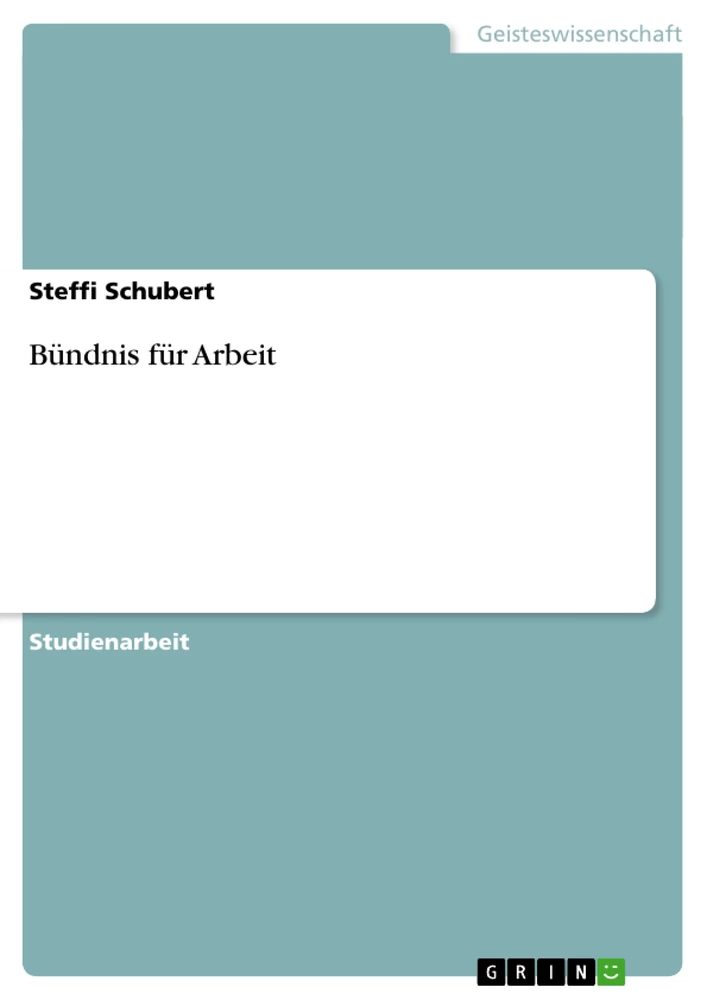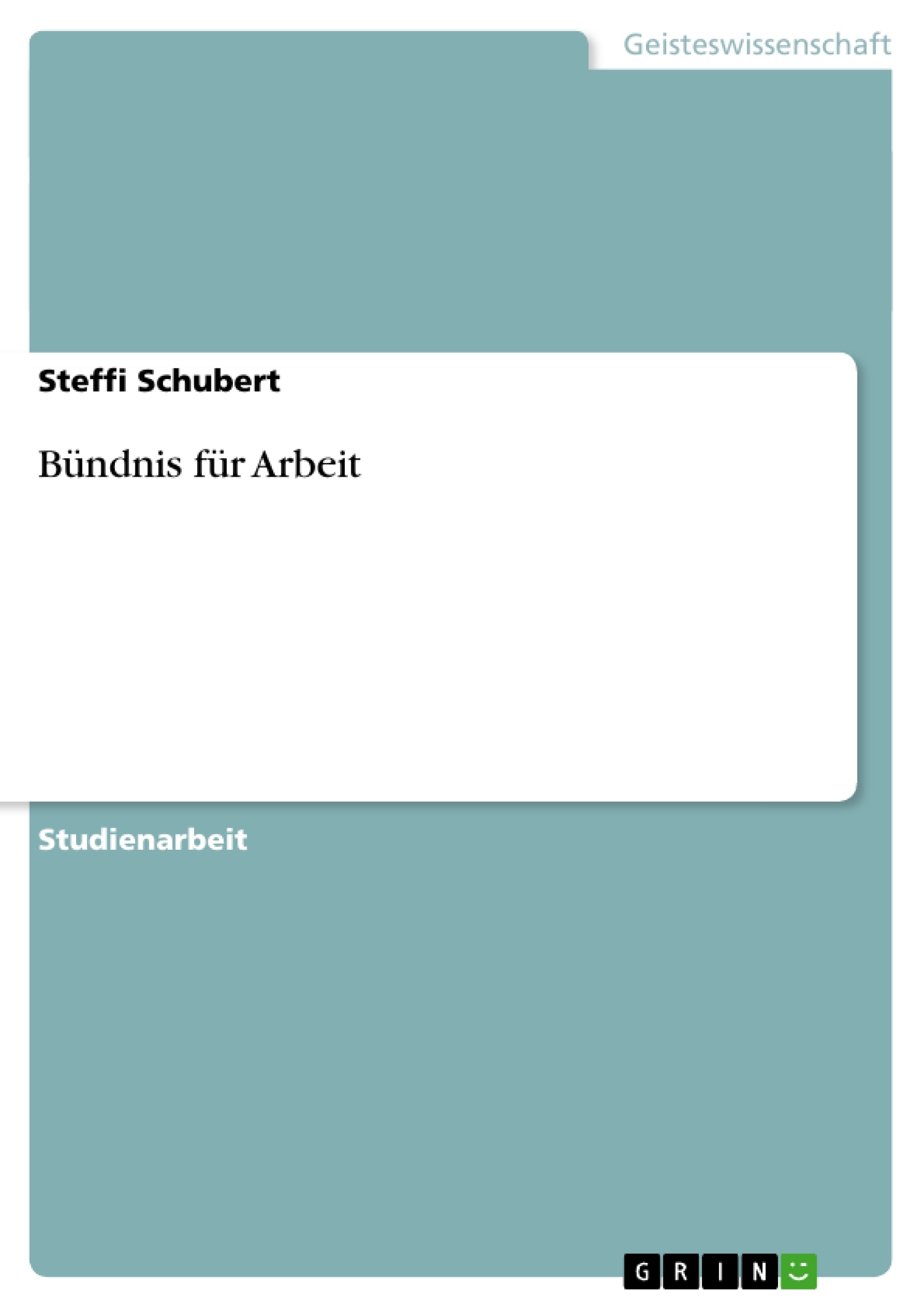Inhalt
1. Einleitung
2. Konzept zur Verwirklichung
3. Für wen bringt das Bündnis einen Nutzen
3.1. Wie sieht die Verteilung und Finanzierung für die Arbeitgeber aus
3.2. Die Notwendigkeit für die Bundesregierung
4.Ost kontra West
5. Meinungen
6. Absage an einen Vorschlag
1. Einleitung
„ ... Kolleginnen und Kollegen ..., ich schlage der Bundesregierung sowie den Unternehmern und ihren Verbänden ein Abkommen auf Gegenseitigkeit zur Schaffung von Arbeitsplätzen vor, ein „Bündnis für Arbeit“.“1
Dies waren die entscheidenden Worte, die Klaus Zwickel, 1. Vorsitzender der IG Metall, auf dem 18. ordentlichen Gewerkschaftstag im November 1995 an die Zuhörer sand. Nachdem die Arbeitslosigkeit im Oktober´95 3525842 Menschen betraf, ließ sich ein solcher Vorschlag nicht vermeiden. Nicht nur die Betriebe, sondern auch die Regierung, mit ihrer Arbeitsmarktpolitik sowie die Gewerkschaften, mit ihrer Tarifpolitik, sollen mit diesem Bündnis etwas gegen den Anstieg der Arbeitslosenzahlen, die im Januar´96 4158960 betrugen, unternehmen (siehe Grafik 1).
DATEN ÜBER DEN ARBEITSMARKT
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bundesanstalt für Arbeit Grafik1 Unterabteilung Statistik
2. Konzept zur Verwirklichung
Auf dem 18. Gewerkschaftstag war dieses Bündnis noch eine Vorstellung, die den Tarifpartner und der Regierung erstmal nahe gebracht werden mußte. Das Bündnis für Arbeit sollte eine Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Bundesregierung werden. In der Hoffnung, daß alle Gewerkschaften die IG Metall Vorschläge annehmen, stellte sie ein Konzept auf.
Die IG Metall wollte sich darauf verpflichten:
- sich beim Tarifabschluß 1997 nur an der Preissteigerungsrate zu orientieren
- befristete Einarbeitungsabschläge zu akzeptieren, wenn Langzeitarbeitslose eingestellt werden
Im Gegenzug dazu sollte die Bundesregierung folgende Zugeständnisse machen:
- Verzicht auf Kürzung des Arbeitslosengeldes und der Arbeitslosenhilfe
- die Kriterien für den Sozialhilfebezug nicht zu verschlechtern
- Gewährleistung, daß das Ausbildungsplatzangebot der Nachfrage entspricht
- Betriebe zu einer Ausbildungsplatzabgabe zu verpflichten, wenn sie nur wenig bzw. gar nicht ausbilden
Auch die Metallarbeitgeber sollten sich mit einem Bestandteil am Bündnis beteiligen: ( ab 1997 für 3 Jahre)
- Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen
- 300000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen (jährlich 100000)
- 30000 Langzeitarbeitslose einstellen (jährlich 10000) jedes Jahr 5 % mehr Ausbildungsplätze anbieten
3. Für wen bringt das Bündnis einen Nutzen ?
Von dem Bündnis, wie es die IG Metall verwirklichen will, würde fast jeder profitieren:
1. Arbeitgeber, weil die IG Metall ihnen einen Teil der Lohnerhöhung lassen würde, die sie erarbeitet hatten
2. Arbeitnehmer, weil Arbeitsplätze sicherer werden würden, durch den Wegfall betriebsbedingter Kündigungen
3. Arbeitslose, weil ihre Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz steigen würden
4. Jugendliche, weil das Bündnis Ausbildungsplätze garantieren würde
5. Bund, Länder, Gemeinden , weil sie durch das Bündnis Milliarden sparen würden Die Bundesregierung bzw. der Finanzhaushalt würde 1996 DM 4,5 Milliarden einsparen, 1997 bereits DM 9 Milliarden und 1998 sogar DM 13,5 Milliarden. Dies passiert dadurch, daß sie mehr Sozialbeiträge einnehmen würden sowie Steuern. Außerdem sparen sie an Sozialausgaben sowie an Arbeitslosengeldern und Arbeitslosehilfegeldern (Grafik 2 - 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 4
3.1. Wie sieht die Verteilung und Finanzierung für die Arbeitgeber aus ?
Allerdings hätten die Arbeitgeber 1996 einen Mehraufwa nd von ca. 7%, der sich wie folgt aufteilt:
- ca. 3% entfallen auf das Bündnis für Arbeit - durch neue Arbeitsplätze entstehen auch mehr Lohnkosten
- ca. 1% entfällt auf die 35-Stunden Woche - denn durch die Einführung der 35-Stunden Woche in Westdeutschland entstanden auch Mehrkosten für Neueinstellungen · ca. 3% entfallen noch auf die Tariflohnerhöhung, die eine Kostenbelastung ab dem 1.1.1996 vorsah
Dem gegenüber stünde jedoch 1997 ein Verteilungsspielraum von 8%. · 1,5% verteilen sich auf die Preiserhöhungen der Metallbranche · 6,5% entfallen auf den Produktivitätszuwachs der Metallbranche
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 5
Aus dem Schaubild (Grafik 5) ist ersichtlich, daß die IG Metall bereits 1996 110000 neue Arbeitsplätze aufgrund des zu erwartenden hohen Produktivitätszuwachses in der Metallverarbeitung ohne Abstriche von der vereinbarten Lohnerhöhung finanzieren könnte. Um diese Arbeitsplätze zu schaffen, könnten die Unternehmer die Arbeit umverteilen durch zwingenden Freizeitausgleich für Mehrarbeit, mehr Teilzeitarbeit und mehr Qualifizierungen. Dies ist nötig, wenn man den Vergleich zwischen den Beschäftigten in der Metallbranche und den Pro Kopf Überstunden anstellt. Die Beschäftigungszahlen sinken, während die Überstunden ständig ansteigen (Grafik 6, 7).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 7
Es wäre aber auch möglich, daß die Unternehmen den gesparten Teil der Lohnerhöhung direkt für Investitionen in neue Arbeitsplätze nutzen oder zur Preissenkung. Diese Preissenkung müßte, vorstellbarer Weise, zu mehr Absatz führen (Produktivitätszuwachs) und das wiederum zu Mehrarbeit. Aufgrund der Umverteilung würden dadurch ebenfalls Arbeitsplätze entstehen.
3.2. Die Notwendigkeit für die Bundesregierung
Auf der anderen Seite steht die Bundesregierung, die eigentlich das größte Interesse an dem Bündnis für Arbeit haben müßte, denn die eingesparten DM 13,5 Milliarden werden dringend gebraucht.
SO TEUER IST ARBEITSLOSIGKEIT - 139,7 Milliarden Gesamtkosten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Arbeitsminister Blüm lobte demzufolge auf dem 18. Gewerkschaftstag auch den Vorschlag,
allerdings ließ er nicht durchblicken, ob sich die Bundesregierung beteiligen will. Blüm hat noch einige Kürzungen vorgesehen, so zum Beispiel die Arbeitslosenhilfe. Da blockt aber die IG Metall ab. „Wird die Arbeitslosenhilfe gekürzt, gibt es kein „Bündnis für Arbeit“!“2 Die Bundesregierung hat die Wahl : entweder das Bündnis und 13,5 Milliarden mehr in den Kassen, oder die Kürzung der Arbeitslosenhilfe, die allerdings nur einen Bruchteil der 13,5 Milliarden sparen würde, nämlich gerademal DM 300 Millionen. Wenn statt der Arbeitslosenhilfe nun aber sie Lohnfortzahlung gekürzt wird, wie es einige CDU- Politiker in Erwägung ziehen, dann ist das Bündnis für Arbeit genauso abgeschlossen ohne etwas erreicht zu haben. Es ist also kein Vorschlag, den die IG Metall der Bundesregierung unterbreitete, sondern ein „Befehl“!
4. Ost kontra West
Das Bündnisangebot würde sich allerdings im Augenblick nur in Westdeutschland durchsetzen lassen, da im Osten gesonderte Probleme existieren, die es erst zu meistern gilt.
1. Die Tarifverträge laufen später als im Westen (Ende´96) aus
2. bis jetzt existiert noch keine 35-Stunden Woche
3. Anpassung der Gehälter und Löhne erst Mitte 1996
4. es fehlen regionale und industriepolitische Strukturkonzepte
Es bestehen also andere Vorbedingungen für ein Bündnis, jedoch die gleichen Ziele.
Die IG Metall Vorschläge lassen sich fast alle auf die ostdeutsche Metallverarbeitung übertragen.
Forderungen an die Bundesregierung:
- Verzicht auf Kürzung der Arbeitslosengelder und Verzicht auf Verschlechterung der Sozialhilfebedingungen
- Einführung Arbeitsplatzabgabe (Lastenausgleich)
Forderungen an Metallarbeitgeber:
- Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen · 5% mehr Ausbildungsplätze pro Jahr · Freizeitausgleich für Mehrarbeit
Gegenleistungen der IG Metall:
- ostdeutsche Entgeldtarifverträge , die ab1.7.96 auf 100% des Westniveaus angehoben werden, können zwar erst zum 30.6.1997 gekündigt werden
- aber Höhe und Laufzeit der Tarifverträge werden automatisch an Vereinbarungen der westdeutschen Metallindustrie während des 1. Halbjahres 1997 angepaßt Nicht direkt übernehmen läßt sich die Beschäftigungsforderung. Man kann aufgrund der noch geschätzten 380000 Arbeitnehmer/innen im ostdeutschen Metallgewerbe nicht mit soviel Arbeitsplatzforderungen auftreten, wie in Westdeutschland. Angesichts der Übernahme der 3% Klausel ergibt sich eine Forderung nach 10000 Arbeitsplätzen und einer zusätzlichen Einstellung von 1000 Langzeitarbeitslosen pro Jahr.
Die Revision der Tarifverträge lehnt die IG Metall aufgrund der Durchführung des Bündnisses strikt ab.
Dies gilt für die 100% Anpassung zum 1.7.1996 genauso, wie für die Einführung der 38- Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich ab 1.10.1996. Vorgeschlagen wird allerdings eine Modifikation der beschäftigungspolitischen Komponente mit dem Ziel, in der ostdeutschen Metallverarbeitung:
- die zusätzlichen Beschäftigungseffekte zugunsten der Metallbelegschaften zu erhöhen · die zusätzlichen Kostenlasten der Metallbetriebe aber zu vermindern Beide Ziele sind dadurch erreichbar, daß in der ostdeutschen Metallbranche die Einführung der 35-Stunden Woche auf den 1.1.´97 vorgezogen wird und die Finanzierung der 35- Stunden Woche gleichmäßig aufgeteilt und auf eine solidarische Basis gestellt wird.
(1 Stunde) wird von den Arbeitnehmern durch Verzicht auf den Lohnausgleich übernommen
(1 Stunde) wird von den Metallunternehmern übernommen
(1 Stunde) wird von der Bundesanstalt für Arbeit durch befristete Lohnzuschüsse übernommen
Dies wären Mehrausgaben von DM 500 Millionen. Dem stehen Einsparungen von DM 1 Milliarden durch die Verminderung der Arbeitslosenzahlen im Verlauf von 3 Jahren um 33000 gegenüber. Das wäre ein Plus von DM 500 Millionen, also ein lukratives Angebot.
Gleichzeitig darf der aktive Arbeitsmarkt im Osten nicht reduziert werden.
Mindestens 10000 Arbeitsplätze sollen mit dem Einsatz von Maßnahmen nach §249h entstehen.
Beschäftigungsfelder für §249h - Maßnahmen in Betrieben · Auf- und Ausbau betrieblicher Aus- und Weiterbildung · Übernahme von ökologischen Arbeitsaufgaben · Verbesserungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
Die daraus entstehenden Gesamtkosten für 10000 Arbeitsplätze werden wie folgt verteilt:
1. produktiver Lohnkostenzuschuß der Bundesanstalt für Arbeit( ca. DM 230 Mio.)
2. Land 30% (ca. DM 72,5 Mio. für alle ostdeutschen Länder insgesamt) Bund 30% (ca. DM 72,5 Mio.)
Betriebe 40% (ca. DM 97 Mio.)
Diese Regelung wäre für die Bundesanstalt für Arbeit kostenneutral, da sich die entstehenden Kosten (produktiver Lohnkostenzuschuß) lediglich auf die Kosten, die durchschnittlich pro Arbeitslosen anfallen, belaufen.
Die Situation in Ostdeutschland ist aber viel komplizierter, als in Westdeutschland.
Hier schließen immer noch Betriebe in den Branchen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik, während die Automobilbranche boumt und deren Umsätze mit der Weltspitze konkurrieren.
Mit anderen Worten, die Metallindustrie ist hier im Osten besonders stark betroffen und vom aussterben bedroht.
Sieht man sich z.B. die Situation der „Metall - Stadt“ Leipzig an, dann ließe sich das Bündnis überhaupt nicht realisieren. Hier müssen erst neue Arbeitsgrundlagen geschaffen werden, bevor man von Einstellungen sprechen kann. Und so sieht es nicht nur in Leipzig aus. Bevor in Ostdeutschland „blühende“ Landschaften entstehen können, muß vorher in die Entstehung von Betrieben investiert werden, was wiederum viele Firmen abschreckt, da diese die Investitionen nicht unverzüglich wiedergewinnen können. Andererseits, wenn Firmen das Risiko eingehen, ist immer noch nicht gesichert, ob die Angestellten und Arbeiter nach Tarif bezahlt werden, da keine Firma verpflichtet ist in die Arbeitgeberverbände einzutreten. Demzufolge ist es unwahrscheinlich, daß das Bündnis für Arbeit ein umfassender Erfolg wird.
5. Meinungen
Aber nicht nur die Betroffenen stehen dem Vorschlag mit Zweifeln gegenüber, sondern auch Presse, Regierung und sogar Mitglieder der IG Metall.
Ingrid Kurz - Scherf, Dozentin für Politikwissenschaften und Ökonomie in Marburg:
„Der ... unterbreitete Vorschlag ist seinem konkreten Inhalt nach schlichter Unsinn und tatsächlich glaubt niemand im Ernst daran, daß die Unternehmen der Metallindustrie im laufenden Jahr 100000 Arbeitsplätze schaffen, obwohl alle Prognosen mit einem weiteren und eher noch rasanteren Personalabbau rechnen und es glaubt auch niemand im Ernst daran, daß die Metallunternehmer zusätzlich 10000 Langzeitarbeitslose einstellen, wenn’s ihnen die Gewerkschaften nur ein bißchen billiger machen.“3
Frank Teichmüller, Hamburger Bezirksleiter der IG Metall:
„Wir sind solidarisch mit den Arbeitslosen.“ Außerdem gab er zu bedenken, „daß wir als IG Metall für die Langzeitarbeitslosen kein Programm haben.“4
Anhand der Politik, die die Bundesregierung im Augenblick durchführt, kann man sehen, wie sehr sie an dem Bündnis für Arbeit interessiert ist. Am 25.08.1996 konnte man deutlich in der Tagesschau vernehmen, daß die Bundesregierung weiterhin an den Kürzungen der Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall festhält. Noch zu Beginn der Bündnisverhandlungen sagte Bundeskanzler Helmut Kohl: „Wir werden das Angebot Zwickels annehmen und über seinen Vorschlag ohne Tabus sprechen.“5 Theoretisch läßt sich vieles vereinbaren, aber praktisch ist nicht alles Gold, was glänzt. So freut sich die IG Metall schon darüber, wenn ein Arbeitsplatz, zwölf oder eintausend Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Augenblick gilt lediglich „... VW mit dem Angebot von 1000 neuen Arbeitsplätzen als Vorbild für die Machbarkeit einer vernünftigen Beschäftigungspolitik.“6
6. Absage an einen Vorschlag
„Die Metallarbeitgeber in den westdeutschen Tarifgebieten haben sich zwischenzeitlich entschieden, die von uns verlangten Vorleistungen zu einem „Bündnis für Arbeit“ zu verweigern. Wir werden daraus unsere Schlußfolgerungen für die nächste Tarifauseinandersetzung ziehen.“ 7
In diesem Schreiben vom 25.07.96 an alle Verwaltungsstellen der IG Metall in den ostdeutschen Tarifbezirken, hieß selbst Klaus Zwickel das gesamtdeutsche Bündnis für Arbeit als gescheitert.
Es ist deutlich zu erkennen, daß die IG Metall sich jetzt mit Rachedrohungen gegen diese Absage wehren will. Ob die ostdeutschen Metallarbeitgeber weiterhin mit Hilfe der Metallgewerkschaft nach Lösungen für die dringlich gewordenen Beschäftigungsprobleme suchen wird, läßt sich noch nicht abschließend beurteilen. Jetzt ist erst einmal die erste Prüfung des Bündnis für Arbeit Anfang 1997 abzuwarten. Darin soll erstmals die Resonanz und Beteiligung am Bündnis offen auf den Tisch gelegt werden. Jetzt wo sich die westdeutschen Metallarbeitgeber auf Konfrontationskurs mit der IG Metall befinden, tritt die Bundesregierung wieder ins Rampenlicht. Dr. Helmut Kohl, Bundeskanzler, sagte Anfang September 1996 in einem Fernsehinterview: „Bis Ende 1996 werden fast alle Ausbildungsplatzsuchenden eine Lehrstelle zur Verfügung gestellt bekommen.“ Wie das erreicht werden soll, ist noch fraglich. Angesprochen wurde jedoch die von der IG Metall geforderte Ausbildungsplatzabgabe für Betriebe, die wenig oder gar nicht ausbilden.
Dieser Versuch wird wahrscheinlich zu spät kommen, da bereits die Schulabgänger von 1997 mit in Augenschein gefaßt werden müssen. Von jeglichen Presseseiten (Focus, Spiegel, Die Zeit, Die Welt,... ) ist die Absage an das Bündnis für Arbeit zu vernehmen, obwohl die IG Metall (zumindest für den Osten Deutschlands) noch daran glaubt. Jedoch alleine können eine Gewerkschaft oder auch ein Dachverband diesen Vorschlag vom November 1995 nicht realisieren. Sie stehen alleine da, obwohl am Anfang noch alle jubelten. Solange sich Arbeitgeberverbände noch quer stellen und sich nicht mit 2% Lohnerhöhung zufrieden stellen, wird sich nie etwas an der Arbeitsmarktsituation ändern, denn mehr als Vorschläge können Gewerkschaften nicht machen. Sie brauchen die Unterstützung der Arbeitgeber.
Doch die ist in dieser Zeit noch nicht oder nicht mehr gegeben.
Literaturverzeichnis
1.) Klaus Zwickel: Bündnis für Arbeit ; Diskussion auf dem 18. Gewerkschaftstag der IG Metall 1.11.195 Berlin
2.) Bündnis für Arbeit : IG Metall-Vorstand Abteilung Werbung Frankfurt/Main 1995/96
3.) Ingrid Kurz-Scherf: Bündnis für Arbeit ein altes Lied erklingt neu? in: Frankfurter Rundschau , 24.02.96
4.) Frank Teichmüller : Ansprache 18. Gewerkschaftstag der IG Metall in Berlin 1.11.1995 ... ebenfalls in Frankfurter Rundschau 24.02.96 zitiert durch I. Kurz-Scherf
5.) Hans Mundorf : Die Heilpraktiker: in Handelsblatt, 17.01.96
Häufig gestellte Fragen zum "Bündnis für Arbeit"
Was ist das "Bündnis für Arbeit"?
Das "Bündnis für Arbeit" war ein Vorschlag von Klaus Zwickel, dem damaligen Vorsitzenden der IG Metall, im November 1995. Es zielte darauf ab, durch ein Abkommen zwischen der Bundesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften, die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu bekämpfen.
Wer sollte an dem Bündnis teilnehmen?
Die drei Hauptakteure des Bündnisses sollten die Gewerkschaften (insbesondere die IG Metall), die Arbeitgeberverbände und die Bundesregierung sein.
Welche Zugeständnisse sollte die IG Metall machen?
Die IG Metall war bereit, sich bei Tarifabschlüssen (ab 1997) an der Preissteigerungsrate zu orientieren und befristete Einarbeitungsabschläge für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen zu akzeptieren.
Was wurde von der Bundesregierung erwartet?
Die Bundesregierung sollte auf Kürzungen des Arbeitslosengeldes und der Arbeitslosenhilfe verzichten, die Kriterien für den Sozialhilfebezug nicht verschlechtern, eine ausreichende Anzahl von Ausbildungsplätzen gewährleisten und Betriebe zu einer Ausbildungsplatzabgabe verpflichten, wenn sie wenig oder gar nicht ausbilden.
Welche Beiträge wurden von den Arbeitgebern erwartet?
Die Metallarbeitgeber sollten für drei Jahre (ab 1997) auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, jährlich 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, jährlich 10.000 Langzeitarbeitslose einstellen und jährlich 5% mehr Ausbildungsplätze anbieten.
Wer würde von dem Bündnis profitieren?
Laut IG Metall würden fast alle profitieren: Arbeitgeber (durch geringere Lohnkosten), Arbeitnehmer (durch sichere Arbeitsplätze), Arbeitslose (durch höhere Jobchancen), Jugendliche (durch garantierte Ausbildungsplätze) und Bund/Länder/Gemeinden (durch Einsparungen bei Sozialleistungen).
Wie hoch wären die finanziellen Einsparungen für den Staat?
Die Bundesregierung bzw. der Finanzhaushalt hätte laut Berechnungen der IG Metall 1996 DM 4,5 Milliarden, 1997 bereits DM 9 Milliarden und 1998 sogar DM 13,5 Milliarden einsparen können.
Wie sah die Kostenverteilung für die Arbeitgeber aus?
Die Arbeitgeber hätten 1996 einen Mehraufwand von ca. 7% gehabt, der sich aus den Kosten für neue Arbeitsplätze, die Einführung der 35-Stunden-Woche und die Tariflohnerhöhung zusammensetzte. Demgegenüber stand aber ein Verteilungsspielraum von 8% im Jahr 1997.
Warum war das Bündnis für die Bundesregierung wichtig?
Die Bundesregierung hatte ein großes Interesse an dem Bündnis, da die eingesparten DM 13,5 Milliarden dringend benötigt wurden, um die Kosten der Arbeitslosigkeit zu senken.
Welche Besonderheiten galten für Ostdeutschland?
In Ostdeutschland gab es gesonderte Probleme, wie später auslaufende Tarifverträge, das Fehlen der 35-Stunden-Woche, die Gehaltsanpassung erst Mitte 1996 und das Fehlen regionaler und industriepolitischer Strukturkonzepte. Trotzdem sollten die Ziele und ein Großteil der IG Metall-Vorschläge auch dort umgesetzt werden.
Was waren die wichtigsten Forderungen für Ostdeutschland?
Für Ostdeutschland wurden ähnliche Forderungen an Bundesregierung und Arbeitgeber gestellt wie im Westen (keine Kürzungen der Sozialleistungen, Ausbildungsplatzabgabe, Kündigungsverzicht, mehr Ausbildungsplätze). Die IG Metall war bereit, ostdeutsche Entgelt-Tarifverträge an westdeutsche Vereinbarungen anzupassen.
Wie wurde die Einführung der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland geplant?
Vorgeschlagen wurde eine vorgezogene Einführung der 35-Stunden-Woche zum 1.1.1997 mit einer solidarischen Finanzierung: 1 Stunde Lohnausgleichverzicht der Arbeitnehmer, 1 Stunde Übernahme durch die Metallunternehmer, 1 Stunde Lohnzuschüsse durch die Bundesanstalt für Arbeit.
Wie waren die Meinungen zu dem Bündnis?
Es gab skeptische Stimmen von verschiedenen Seiten, darunter Presse, Regierung und sogar Mitglieder der IG Metall. Einige bezweifelten die Umsetzbarkeit der Pläne und warfen der IG Metall vor, kein ausreichendes Programm für Langzeitarbeitslose zu haben.
Warum scheiterte das "Bündnis für Arbeit"?
Die Metallarbeitgeber in den westdeutschen Tarifgebieten lehnten die von der IG Metall geforderten Vorleistungen ab, was Klaus Zwickel im Juli 1996 dazu veranlasste, das gesamtdeutsche Bündnis für Arbeit als gescheitert zu erklären.
- Quote paper
- Steffi Schubert (Author), 1996, Bündnis für Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97788