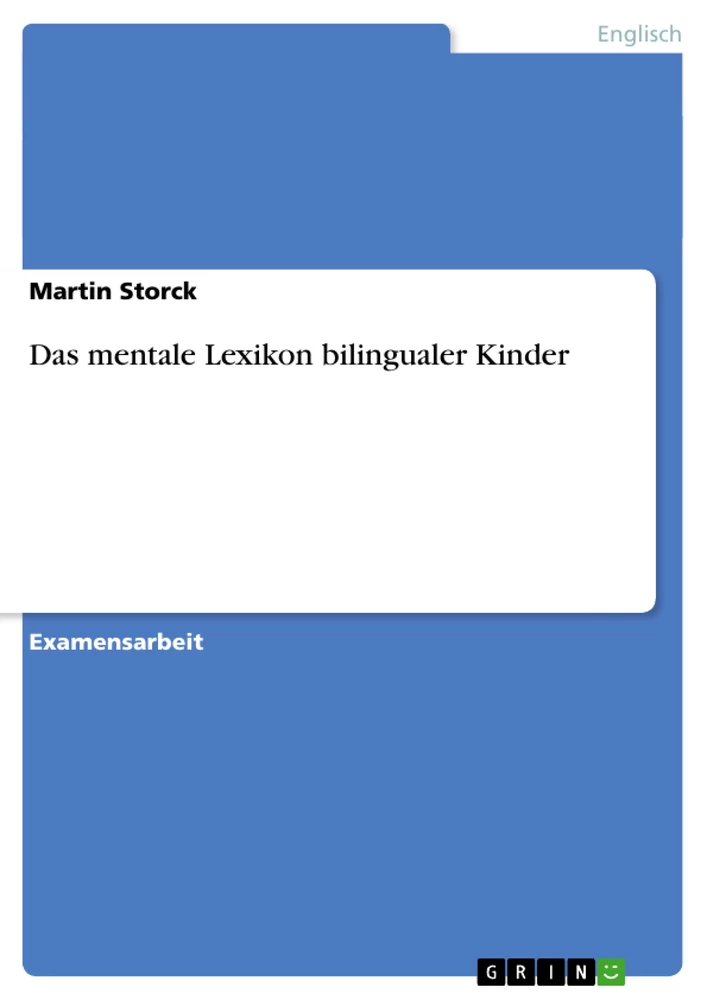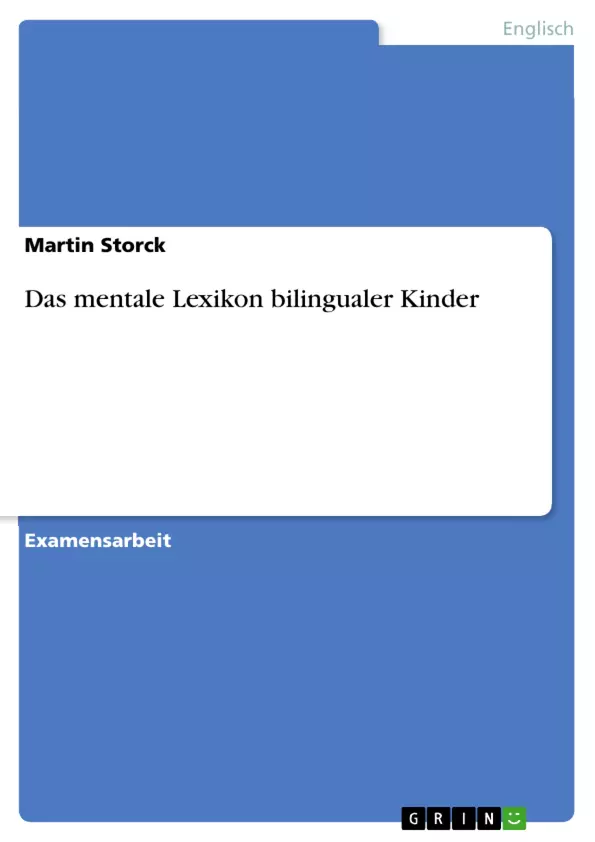Stellen Sie sich vor, Ihr Kind wächst mit zwei Sprachen auf – eine faszinierende Reise, die jedoch unzählige Fragen aufwirft. Ist es ein Vorteil, von klein auf zweisprachig zu sein, oder stellt es eine Überforderung dar? Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine entdeckungsreiche Reise in die Welt des bilingualen Erstspracherwerbs und beleuchtet, wie Kinder zwei Sprachen gleichzeitig meistern. Im Fokus steht dabei die Entwicklung des kindlichen Lexikons, jenes mentalen Netzwerks, in dem Wörter und ihre Bedeutungen gespeichert sind. Wir untersuchen, ob bilinguale Kinder ein gemeinsames Lexikon für beide Sprachen anlegen oder ob von Anfang an zwei separate Systeme entstehen. Dabei werden die frühen Forschungsansätze von Volterra und Taeschner kritisch gewürdigt und die neuesten Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung einbezogen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Strategien, die Kinder anwenden, um neue Wörter zu lernen und sie der richtigen Sprache zuzuordnen. Welche Rolle spielen dabei der Kontext, die grammatikalische Struktur und die Interaktion mit den Bezugspersonen? Wir beleuchten auch den Einfluss des Inputs – also der sprachlichen Umgebung – auf die Entwicklung der Zweisprachigkeit. Welche Erziehungsansätze sind besonders förderlich, und wie können Eltern ihre Kinder optimal unterstützen? Das Buch geht der Frage nach, wann sich ein Kind seiner Zweisprachigkeit bewusst wird und wie sich dieses Bewusstsein auf seine sprachlichen Fähigkeiten auswirkt. Abschließend wird die Interaktion der beiden Sprachsysteme im Gehirn untersucht. Sind die beiden Lexika direkt miteinander verbunden, oder erfolgt die Kommunikation über ein gemeinsames konzeptuelles System? Dieses Buch bietet Eltern, Erziehern und allen Interessierten einen fundierten Einblick in die faszinierende Welt des bilingualen Spracherwerbs. Es ist ein Wegweiser durch den Dschungel der Theorien und Forschungsergebnisse, der praktische Tipps und Anregungen für die Begleitung bilingual aufwachsender Kinder gibt. Keywords: Bilingualismus, Zweisprachigkeit, Spracherwerb, kindliche Entwicklung, Lexikon, mentale Repräsentation, Input, Erziehung, Sprachförderung, Sprachbewusstsein, kognitive Fähigkeiten, Volterra, Taeschner, Sprachmischung, Code-Switching, Bilingualer Erstspracherwerb, mentales Lexikon, Spracherwerbsforschung, Kindererziehung, Familiensprache, Mehrsprachigkeit, frühe Kindheit, Sprachkompetenz, Sprachsysteme, Gehirnentwicklung, Lernstrategien, Sprachförderung, Elternratgeber, Spracherziehung, Sprachen lernen, frühe Bildung, Bilinguale Kinder, Zwei Sprachen, Mentale Lexika, Bilingual aufwachsen, Sprachliche Entwicklung, Zweisprachige Erziehung, Kinder und Sprachen, Sprachliche Kompetenz, Bilinguale Fähigkeiten.
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Bilingualismus
2.1 Versuch einer Definition
2.2 Chance oder Handicap?
3 Die Umstände des doppelten Erstspracherwerbs
3.1 Die Typen des Spracherwerbs
3.2 Die Rolle des Inputs
4 Das mentale Lexikon
4.1 Die Entwicklung des Lexikons
4.2 Der bilinguale Spracherwerb
4.2.1 Erste Forschungsansätze
4.2.1.1 Phase 1: Ein einziges Sprachsystem
4.2.1.2 Phase 2: Die Bildung von Ä quivalenten
4.2.1.3 Der Umfang des Lexikons
4.2.1.4 Kritik an Taeschners Ansatz
4.2.2 Die mentale Organisation zweier Sprachen
4.2.3 Das Erlernen neuer Wörter
4.2.4 Das bilinguale Bewußtsein
4.2.5 Die Interaktion beider Sprachsysteme
5 Schlußbemerkung
Bibliographie
Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Der Mensch ist wahrscheinlich das einzige Lebewesen, das sich durch das Medium der Sprache seinen Artgenossen mitteilen kann. Die Sprache ist ein System unterschiedlicher Laute, die sich nach bestimmten mehr oder weniger komplizierten Regeln zu einer Äußerung formieren. Die Regeln der Anordnung der Laute variieren von Sprachsystem zu Sprachsystem und haben so auch im Laufe der Zeit eine Vielzahl verschiedener Sprachen hervorgebracht.
Als Säugling wird man nun in eine Gemeinschaft hineingeboren und erlernt nach und nach deren Sprache, um dadurch mit den Mitmenschen kommunizieren zu können. Dabei ist es in den meisten Fällen nur ein Zufall, daß dem Kind lediglich eine Sprache präsentiert wird. Eine oft vernachlässigte aber dennoch häufig auftretende Situation ist dann gegeben, wenn das Kind mit zwei Sprachen konfrontiert wird, was zur Folge hat, daß es nicht eine, sondern gleich zwei Muttersprachen lernen muß.
Inwieweit unterscheidet sich der Erstspracherwerb eines bilingualen Kindes von dem eines monolingualen? Die vorliegende Arbeit geht der Frage des bilingualen Erstspracherwerbs nach, wobei der Schwerpunkt auf den Erwerb des Lexikons und dessen mentaler Repräsentation gelegt wird. Beginnend mit unumgänglichen Überlegungen zum Begriff des Bilingualismus‘ (Kapitel 2) und zu den äußeren Voraussetzungen, die zur Zweisprachigkeit führen (Kapitel 3), wird eine Überleitung über die Natur des mentalen Lexikons (Kapitel 4.1) zum Erwerb des bilingualen Lexikons hergestellt (Kapitel 4.2 ff.). Die angestellten Überlegungen gehen dabei stets von einem gleichzeitigen Erwerb beider Sprachen und nicht von einem sukzessiven Erlernen aus.
Aufgrund der umfangreichen Thematik erscheint es sinnvoll, einen Hauptaspekt herauszugreifen, um eine oberflächliche Behandlung des Themas zu vermeiden. Somit werden die Hypothesen von Volterra und Taeschner zur mentalen Organisation der Lexika im bilingualen Gehirn des Kindes als Ausgangspunkt gewählt.
Gibt es eine befriedigende Antwort auf die Frage, ob die Wörter der beiden Sprachen in einem oder in zwei Systemen gespeichert sind? Verän- dert sich die mentale Repräsentation im Laufe der kindlichen Sprachentwick- lung und welche Rolle spielt hierbei die konzeptuelle Wahrnehmung der Umwelt? Was erlaubt es dem Kind, neue Wörter nach Sprachen zu trennen? Aus den Vorgängen, die beim monolingualen Spracherwerb greifen, werden Rückschlüsse auf die Funktionsweise des bilingualen Spracherwerbs gezogen.
Dieser Arbeit liegen keine eigens zu diesem Zweck erhobenen empirischen Daten zugrunde, weshalb jegliche Schlußfolgerungen lediglich auf einer Auswertung bereits vorhandener Untersuchungen basieren und somit als Hypothesen zu verstehen sind. Es sei weiterhin darauf hingewiesen, daß unter dem Begriff „Kind“ in der vorliegenden Arbeit aus- schließlich Kinder gemeint sind, die des Lesens und Schreibens unkundig sind.
2 Bilingualismus
2.1 Versuch einer Definition
Es gibt heute weltweit etwa 3000 bis 4000 Sprachen - und das in nur 150 Ländern. Diese Tatsache macht die meisten Länder zu mehrsprachigen Gebieten, in denen die Menschen oft darauf angewiesen sind, auch die Sprache der „Nachbarn“ zumindest in Grundzügen zu kennen, um ein angenehmes Zusammenleben zu ermöglichen. Besonders deutlich wird dies in vielsprachigen Ländern wie Belgien oder der Schweiz, wo die Menschen der verschiedenen Sprachgemeinschaften so dicht zusammenleben, daß sie der jeweils anderen Sprache unmöglich ausweichen können.1
Es gibt kaum ein Land, welches man als monolingual bezeichnen kann. In vielen Staaten leben Sprachminderheiten, die sowohl ihre eigene Sprache sprechen als auch die Sprache der Mehrheit beherrschen. Hier kann das Beispiel Frankreich angeführt werden, wo neben dem Französischen als Sprache der Mehrheit noch sieben Minderheitssprachen existieren.2 Es wäre jedoch falsch, aus diesen Gegebenheiten ableiten zu wollen, daß die ganze Menschheit bilingual wäre. In der Realität geht man davon aus, daß etwa die Hälfte der Weltbevölkerung zweisprachig ist, wobei die meisten dieser Menschen beide Sprachen als ihre Muttersprache besitzen.3
Ein Land kann als bi- oder multilingual bezeichnet werden, wenn in ihm zwei oder mehrere Sprachgemeinschaften leben. Wann aber kann ein Individuum als bilingual charakterisiert werden? Wen kann man als bilingual bezeichnen? Den 40-jährigen italienischen Arbeiter, der seit einem Jahr in Großbritannien lebt und der aufgrund des neuen Wohnorts nun gezwungen ist, Englisch zu lernen? Die französische Übersetzerin, die auf das Über- setzen spanischer Gebrauchsanweisungen ins Französische spezialisiert ist? Die dänische Hausfrau, die in ihrer Schulzeit ein Jahr Russisch lernte und sich nun noch bruchstückhaft an ein paar Sätze erinnern kann? Oder den zehnjährigen Jungen, der seit seiner Geburt der deutschen und englischen Sprache in gleichem Maße ausgesetzt ist? Um die Antwort gleich vorweg zu nehmen, ist je nach Definition jedem der Personen ein gewisser Grad an Zweisprachigkeit zuzusprechen.
Auf den ersten Blick scheint es nicht schwierig zu sein, Bilingualismus zu definieren, denn jeder hat eine bestimmte Vorstellung, was darunter zu verstehen ist. Doch genau hier liegt das Problem: Jeder, der versucht eine Definition zu formulieren, findet sich in einer schwierigen Situation wieder, da es so viele unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten gibt. Diese beziehen zwar alle den Gebrauch von zwei Sprachen mit ein und unterscheiden sich somit erst einmal nicht grundlegend voneinander, sie setzen aber anderer- seits so unterschiedliche Schwerpunkte, daß zwischen zwei Erklärungen Welten liegen können.
Das Oxford English Dictionary versteht unter Bilingualismus „ the ability to speak two languages [and] the habitual use of two languages colloquially “4, d. h. eine Person muß in der Lage sein, in zwei Sprachen mündlich zu kommunizieren, um als bilingual bezeichnet zu werden. Das Hauptaugenmerk wird hierbei ausschließlich auf die Mündlichkeit gelegt, wobei jedoch offen bleibt, ob schon rudimentäre Kenntnisse der zwei Sprachen ausreichen, um eine Person als bilingual zu charakterisieren, oder ob doch eine profundere Beherrschung der Sprachen nötig ist und wenn ja, wie hoch der Grad dieser Beherrschung sein muß.
Eine andere Definition ist diesbezüglich etwas genauer, denn hiernach ist eine bilinguale Person ausgezeichnet durch „ having or using two languages especially as spoken with fluency characteristic of a native speaker “5. Der bilinguale Sprecher sollte demnach beide Sprachen so beherrschen, als wären sie seine Muttersprachen. Diese Forderung, die ziemlich hohe Ansprüche an den Sprecher stellt, engt somit auch den Kreis der Zweisprachigen sehr ein, da sie eigentlich voraussetzt, daß die betreffende Person von frühester Kindheit beide Sprachen gelernt hat. Je später die zweite Sprache hinzugelernt wird, um so mehr ist davon auszugehen, daß eine Differenz in der Kompetenz zwischen den Sprachen besteht.
Ein anderes Extrem in der Definition gibt Macnamara, der schon Personen als bilingual bezeichnet, die eine minimale Kompetenz in einer der vier Sprachfertigkeiten6 besitzen.7 Hier bleibt jedoch die Frage offen, was unter „minimal“ zu verstehen ist. Es wird nicht klar, ob bruchstückhaftes Verstehen, bzw. fehlerhaftes Sprechen in der Zweitsprache schon „minimal“ ist, oder ob doch eine gewisse Akkuratesse gefordert ist, wobei der Umfang des Wortschatzes zweitrangig bleibt. Macnamaras Definition wirft auch indirekt das Problem auf, das den Unterschied zwischen aktivem und passivem Bilingualismus ausmacht. Ist man schon bilingual, wenn man nur versteht, was in der anderen Sprache gesprochen oder geschrieben wird, was dem passiven Bilingualismus entspräche? Oder muß man fähig sein, in der Zweitsprache aktiv zu kommunizieren, sei es mündlich oder schriftlich? Durch diese Polarität erscheint Macnamaras Definition als etwas zu weit gefaßt, denn somit wäre ein hoher Prozentsatz von Menschen bilingual. Viele kennen zumindest ein paar Worte in einer fremden Sprache, wenngleich sie auch nicht in der Lage sind, sinnhafte Sätze in der jeweiligen Sprache selbst zu bilden. Die Anzahl der passiven Zweisprachigen ist demnach weitaus höher als die der aktiven.8 Nach diesem Ansatz müßte man davon ausgehen, daß allein der Gebrauch des englischen Ausdrucks „OK“ einen Deutschen zum bilingualen Individuum macht, was wohl ohne Bedenken als übertrieben bezeichnet werden darf.
Manche Forscher gehen noch einen Schritt weiter und sehen schon innerhalb einer Sprache eine gewisse Zweisprachigkeit, indem sie zwischen den verschiedenen Registern unterscheiden und diese zu eigenständigen Sprachen aufwerten. Genau wie der Zweisprachige muß der monolinguale Sprecher sein Register der jeweiligen Situation anpassen und auch hier gibt es Interferenzen zwischen Registern. Das gleiche gilt für regionale Varianten einer Sprache oder Dialekte, die mit eigenständigen Sprachen gleichgesetzt werden und somit einen Sprecher von Hochsprache und Dialekt zum zweisprachigen Menschen machen.9 Das hier angesprochene Phänomen wird als sozialer Bilingualismus bezeichnet.10 Da in der vorliegenden Arbeit nur Bilingualismus im Sinne eines Sprechens von zwei verschiedenen Sprachen behandelt werden soll, wird dieser Ansatz im Folgenden vernach- lässigt.
Bis hierhin läßt sich erkennen, daß die Definitionen von Bilingualismus in der Literatur äußerst vielfältig aber auch genauso subjektiv sind. Jeder Autor stellt seine eigenen Maßstäbe zur Bestimmung der Zweisprachigkeit auf. Demgegenüber stehen die objektiv feststellbaren Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Sprachkompetenzen eines Sprechers. Eine ausgeglichene Zweisprachigkeit (balanced bilingualism) liegt dann vor, wenn der Sprecher in beiden Sprachen Fertigkeiten und Kenntnisse besitzt, die es ihm ermöglichen, in jeglichen Situationen mit der gleichen Sicherheit in beiden Sprachen zu kommunizieren. Ist die Kompetenz in einer Sprache höher als in der anderen, so wird der Begriff des dominanten Bilingualismus (dominant bilingualism) benutzt.11 In diese Kategorie fallen dann auch Personen, die eine zweite Sprache später zu ihrer eigenen Muttersprache hinzulernen, wobei die Zweitsprache in den seltensten Fällen die Kompetenz der Muttersprache erreicht. Aufgrund der Dominanz einer Sprache treten hier Interferenzen zwischen den beiden Sprachen auf. Es ist davon auszugehen, daß die Interferenzen um so stärker auftreten, je später die zweite Sprache zur Muttersprache hinzugelernt wird. Diese Interferenzen finden sich auf phonetischer, lexikalischer und syntaktischer Ebene und führen dadurch zu falscher Aussprache, Benutzung von Worten im falschen Kontext und zum fälschlichen Übertragen von grammatikalischen Strukturen von einer Sprache in die andere.12 Bei ausgeglichenen Zweisprachigen sollte man davon ausgehen, daß solche Interferenzen nicht im gleichen Umfang auftreten. Doch auch hier findet man Interferenzen zwischen L1 und L2, die sich beispielsweise in code-mixing oder code-switching äußern.
Spricht man von Bilingualismus, so darf wie gesagt nicht davon ausge- gangen werden, daß wirklich beide Sprachen in exakt der gleichen Ausprägung nebeneinander existieren. Dies läßt sich an dem für diese Arbeit im Vordergrund stehenden doppelten Erstspracherwerb bei Kindern deutlich machen. Ein bilinguales Kind entspricht keinesfalls der Summe zweier monolingualer Kinder, was auf die Tatsache zurückführen ist, daß das Kind seinen Wortschatz in den seltensten Fällen in beiden Sprachen gleichzeitig vermittelt bekommt und somit je nach Situation die Sprache vorzieht, in der das entsprechende Vokabular schon vorhanden ist. Die gleiche Situation wäre zwar auch in der anderen Sprache zu meistern, wobei jedoch größere Anstrengungen von Nöten wären und das Kind eher allgemein gehaltenes Vokabular verwenden würde.13 Das Phänomen, daß sich ein bilingualer Sprecher in manchen Situationen in einer Sprache wohler fühlt, sich besser ausdrücken kann und sie deshalb der anderen Sprache vorzieht, kann man auch bei Erwachsenen beobachten. Die ausgeglichene Zweisprachigkeit ist somit eher die Ausnahme, denn jeder bilinguale Sprecher hat eine dominierende Sprache, was nicht nur auf bestimmte Situationen, sondern auch auf die Einflüsse der sprachlichen Umwelt zurückzuführen ist.14
Dies soll hier am Beispiel eines Kindes verdeutlicht werden, das im französischsprachigen Teil Kanadas zweisprachig englisch und französisch aufwächst und von seinen Eltern in beiden Sprachen angesprochen wird. Es spricht jeden Tag im Kindergarten mit seinen Freunden, Mitschülern und Lehrern und auch sonst mit der Mehrheit seiner Gesprächspartner französisch. Selbst wenn es zu Hause nach wie vor mit der englischen Sprache in Kontakt kommt, diese versteht und auch sprechen kann, so ist doch stark davon auszugehen, daß das Französische aufgrund des Übergewichts an französischen Sprechsituationen in dem Kind dominiert und man nicht mehr von einer ausgeglichenen Zweisprachigkeit sprechen kann.
Bis hierher läßt sich sagen, daß eine Definition von Bilingualismus irgendwo in der Mitte der oben genannten Erklärungen liegen muß. Einerseits darf man sie nicht zu weit fassen und jeden als bilingual bezeichnen, der schon ein einziges Wort in einer fremden Sprache kennt, andererseits sollte man aber auch den Rahmen nicht so eng stecken und nur Sprecher als bilingual klassifizieren, die zwei Sprachen perfekt beherrschen. Perfekt bedeutet in diesem Zusammenhang, daß man in beiden Sprachen eine absolut identische Kompetenz mit der eines Muttersprachlers erwartet, wobei auf alle Bereiche der Sprachbeherrschung Bezug genommen wird.
Nimmt man nun die wichtigsten bisher aufgeführten Aspekte von Zweisprachigkeit zusammen, so kommt man zu einer Definition, die Bilingualismus als die Fähigkeit sieht, zwei Sprachen mit einer dem Mutter- sprachler sehr nahe kommenden Akkuratesse15 zu sprechen, zu schreiben und sie sowohl im gesprochen als auch im geschriebenen Wort ohne Probleme zu verstehen.
Diese Definition ist jedoch unter dem Gesichtspunkt zu modifizieren, daß in der vorliegenden Arbeit vor allem auf den Bilingualismus in Bezug auf den kindlichen Erstspracherwerb eingegangen wird. Somit ist es angebracht, eine Unterscheidung zwischen kindlichem und erwachsenem Bilingualismus vorzunehmen, wodurch aus der obigen Definition die Forderung nach der schriftlichen Beherrschung, was sowohl das Lesen als auch das Schreiben beinhaltet, auszuklammern ist. In Hinsicht auf den kindlichen Bilingualismus darf man außerdem die Grenzen zwischen aktiver und passiver Zwei- sprachigkeit nicht zu streng ziehen, da ein Kind noch bevor es produktive Fertigkeiten in einer Sprache erlangt, das Sprachsystem schon passiv aufnimmt und lernt. Auch wenn Kleinkinder, die konstant zwei Sprachen ausgesetzt sind, anfangs nur eine Sprache zur Kommunikation benutzen, muß davon ausgegangen werden, daß die Entwicklung des Verständnisses beider Sprachen weiter fortschreitet. Diese passiven Kenntnisse in der anderen Sprache können im Falle eines Wechsels der sprachlichen Umgebung leicht aktiviert werden und auch deshalb dürfen die passiven Zweisprachigen nicht vernachlässigt werden, vorausgesetzt, sie sind der schwächeren Sprache nach wie vor regelmäßig ausgesetzt.16 Harding und Riley unterscheiden in ihren Überlegungen zur Zwei- sprachigkeit zwischen verschiedenen Zeitpunkten, zu denen das Individuum zum bilingualen Sprecher wird. Sie schlagen eine Unterteilung in infant, child, adolescent und adult bilingualism vor.17 Die Autoren verstehen unter dem Begriff des infant bilingualism, daß das vorerst „sprachunfähige“ Kleinkind zum bilingualen Menschen18 wird, wenn die Voraussetzung gegeben ist, daß es beiden Sprachen gleichzeitig und von Anfang an ausgesetzt ist, d. h. wenn beide Sprachen als Muttersprachen gelernt werden. Demgegenüber steht die Zweisprachigkeit, die erst im Kindesalter erreicht wird. Sie entsteht dadurch, daß die beiden Sprachen sukzessive erlernt werden, was aber in dieser Altersklasse noch kein Problem darstellt, da Sprachen noch mit einer ziemlichen Schnelligkeit und auch Leichtigkeit aufgenommen werden. Will man die Sprachkompetenz der verschiedenen Altersgruppen vergleichen, so muß man unterscheiden zwischen bilingualen Kleinkindern und Kindern auf der einen Seite und bilingualen Jugendlichen und Erwachsenen auf der anderen. Die Kompetenz der jüngeren Gruppe ist, vor allem was die Aussprache betrifft, von der eines Muttersprachlers praktisch nicht mehr zu unterscheiden, wohingegen Sprecher, die die zweite Sprache erst nach der Pubertät lernen, in den meisten Fällen einen fremden Akzent beibehalten.19
Man kommt abschließend zu der Erkenntnis, daß es eine hundert- prozentig richtige Definition für Bilingualismus nicht gibt oder auch nicht geben kann, da die Facetten der Zweisprachigkeit so weitgefächert sind, daß jede Definition immer mindestens eine Gruppe von zweisprachigen Sprechern ausklammert oder bevorzugt. Den typischen bilingualen Menschen gibt es nicht, da sich die Umstände des Spracherwerbs, die sprachliche Umgebung, die persönliche Einstellung zu beiden Sprachen, sowie der Grad der Sprachbeherrschung von Person zu Person doch erheblich unterscheiden können, ohne daß dem einen oder dem anderen der Anspruch auf Zweisprachigkeit abgesprochen werden darf. Bilingualismus kann als Kontinuum gesehen werden, das von geringer Kompetenz bis zur Perfektion reicht. Die bilingualen Sprecher befinden sich demnach an unterschiedlichen Punkten dieses Kontinuums und nur wenige erreichen das Ideal einer ausgeglichenen muttersprachlichen Kompetenz in beiden Sprachen.20
Für die vorliegende Arbeit soll der Begriff des Bilingualismus als ein gleichzeitiges Erlernen zweier Sprachen von Kindheit an verstanden werden, d. h. er wird im Sinne von „Bilingualismus als Muttersprache“ benutzt, was in beiden Sprachen auch eine muttersprachliche Kompetenz bedeutet.
2.2 Chance oder Handicap?
An die Definition von Zweisprachigkeit schließt sich unmittelbar die Frage an, ob Bilingualismus als Handicap oder doch eher als Chance gesehen werden kann und inwieweit Zweisprachigkeit mit Intelligenz in Zusammenhang zu bringen ist.
Die Meinungen über Bilingualismus haben sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts deutlich zum Positiven hin gewandelt. So wurde die Ein- sprachigkeit am Ende des letzten und zu Beginn dieses Jahrhunderts in höchstem Maße idealisiert. In philosophischen Betrachtungen wurde die Muttersprache mit Religion verglichen und somit als wichtiger Aspekt in der moralischen Entwicklung der Persönlichkeit gesehen. Aus diesen Über- legungen wurde die Schlußfolgerung gezogen, daß die Zweisprachigkeit unnatürlich, persönlichkeitsspaltend und somit am besten zu vermeiden ist. Wissenschaftler waren der Ansicht, daß das menschliche Gehirn nicht dazu geschaffen ist, mehr als eine Sprache zu lernen und deshalb das Erlernen einer zweiten Sprache auf Kosten anderen Wissens und anderer Fähigkeiten geht, was dazu führt, daß das Kind schlechte Leistungen in der Schule zeigt und als Folge der Minderwertigkeitsgefühle frustriert reagiert und entweder aggressiv wird oder sich extrem zurückzieht.21 Der Züricher Pfarrer Eduard Blocher vertrat 1909 die Meinung, daß „die höchsten sprachlichen Leistungen [...] nur dem Einsprachigen möglich“22 seien, wohingegen die Zweisprachigen vielfach an Selbstüberschätzung litten. Die Idealisierung der Einsprachigkeit konnte aber nicht lange aufrecht erhalten werden, da die negativen Eigenschaften wie Faulheit, Oberflächlichkeit oder Hang zum Materialismus, die man den Zweisprachigen bis dahin nachsagte, natürlich genauso gut auch unter monolingualen Sprechern auftreten. Es konnte sowohl der Beweis erbracht werden, daß nicht nur bilinguale Kinder ernsthafte Probleme in der Schule haben, als auch daß nicht nur bilinguale Sprecher ab und zu Schwierigkeiten haben, die richtige Sprache oder das richtige Register zu wählen.23
Forschungsreihen, die zur Jahrhundertwende in Amerika gestartet wurden, um das Leistungsvermögen des Gehirns zu messen und Erkennt- nisse über den Intelligenzgrad einer Person herauszufinden, zogen noch unsinnigerweise Rückschlüsse von physischen Gegebenheiten wie Lungen- volumen, Muskelstärke oder Hörvermögen auf mentale Fähigkeiten.24 Die Testpersonen, die zu den Untersuchungen herangezogen wurden waren außerdem weit vom repräsentativen Durchschnitt entfernt und hatten oft mit Zweisprachigkeit überhaupt nichts zu tun. So wurden einerseits Einwanderer mit schlechten Englischkenntnissen untersucht25 und andererseits Menschen, die hauptsächlich aus den unteren Gesellschaftsschichten kamen, oder die von Hause aus einsprachig waren, wobei nur ihre fremd- klingenden Nachnamen einen Bezug zu einer anderen Sprache suggerier- ten.26 Das Hauptaugenmerk dieser Untersuchungen lag nicht direkt auf der Zweisprachigkeit, aber trotzdem meinten die Forscher herausgefunden zu haben, daß der Bilingualismus zwangsläufig mit einem geringen Grad an Intelligenz einher geht und somit abzulehnen ist. Dabei war ihnen nicht bewußt, daß die angewandte Methodik und die Ausführung zu keinem richtigen Ergebnis führen konnte. Es folgten bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weitere Studien, die alle zu dem Schluß kamen, daß ein Mensch, der mit zwei Sprachen aufwächst, oder der zwei Sprachen spricht, einem monolingualen Sprecher geistig unterlegen ist.27
Die Einstellung gegenüber der Zwei- oder auch Mehrsprachigkeit hat sich entscheidend durch eine von Elizabeth Peal und Wallace Lambert durchgeführte Studie in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts ge- ändert. Die beiden Wissenschaftler arbeiteten im östlichen Teil Kanadas, d.h. in einem Umfeld, in dem die Zweisprachigkeit an der Tagesordnung ist. Peal und Lambert kritisierten an ihren Vorgängern vor allem die Vorgehensweise und die Auswahl der Testpersonen. So wurden nun monolinguale und bilinguale gleichaltrige Kinder ausgewählt, die einen ähnlichen sozialen Hintergrund hatten, wobei bei den bilingualen Kindern darauf geachtet wurde, daß beide Sprachen ähnlich stark ausgeprägt waren. Die Tests ergaben sowohl bessere Resultate in verbalen und nonverbalen Aufgaben bei den bilingualen Kindern als auch eine höhere kognitive Flexibilität der zweisprachigen Sprecher. Peal und Lambert faßten ihre Ergebnisse folgendermaßen zusammen:
[A bilingual child is] a youngster [whom] wider experiences in two cultures have given [. . .] advantages which a monolingual does not enjoy. Intellectually, his experience with two language systems seems to have left him with a mental flexibility, a superiority in concept formation, a more diversified set of mental abilities In contrast, the monolingual appears to have more unitary structure of intelligence which he must use for all types of intellectual tasks. 28
Seit diesen Forschungsergebnissen wurde allgemein davon aus- gegangen, daß zweisprachige Kinder ein höheres Maß an metalinguisti- schem Verständnis aufweisen, da sie beispielsweise stärker als ihre monolingualen Altersgenossen fähig sein müssen, zwischen der signifiant - und signifi é -Seite eines Wortes trennen zu können.29 Die Tests von Peal und Lambert fanden in aller Welt Nachahmer, wobei die gleichen positiven Effekte des Bilingualismus bescheinigt wurden, was bedeutet, daß sich das wissenschaftliche Ansehen der Zweisprachigkeit innerhalb kurzer Zeit ins vollkommene Gegenteil geändert hat.30
Abschließend läßt sich sagen, daß Bilingualismus gerade heutzutage in einer Zeit der Globalisierung und weltweiten Kommunikation unbedingt als Chance gesehen werden muß. Betrachtet man die momentanen sprach- lichen Gegebenheiten in Deutschland, wo mehr und mehr vor allem englische Worte in Werbeslogans, Gebrauchsanweisungen und in den Medien auftauchen, so kann man zynischerweise fast soweit gehen zu sagen, daß eher die Einsprachigkeit zum Hindernis werden kann.
3 Die Umstände des doppelten Erstspracherwerbs
In diesem Kapitel sollen die äußeren Umstände beschrieben werden, die zur Zweisprachigkeit bei Kleinkindern führen. Des weiteren wird auf die Rolle des Inputs31 eingegangen werden.
3.1 Die Typen des Spracherwerbs
Romaine unterscheidet zwischen sechs Typen des kindlichen doppelten Erstspracherwerbs.32 Diese richten sich jeweils nach der Sprache der Eltern, der Sprache der Gesellschaft33 und nach der Art, wie die Sprachen dem Kind präsentiert werden. Es sind sozusagen die verschiedenen Typen von bilingualen Familien.
Typ eins trifft dann zu, wenn beide Elternteile verschiedene Muttersprachen haben, trotzdem aber über eine gewisse Kompetenz in der jeweils anderen Sprache verfügen. Die Sprache eines Elternteils ist gleich- zeitig die dominierende Sprache der Gesellschaft. Vater und Mutter sprechen zu ihrem Kind in ihrer jeweiligen Muttersprache. Diese Situation wird gemeinhin mit dem Schlagwort „ one person - one language “ beschrieben.
Beispiel: Die Familie lebt in England, der Vater ist englischer Muttersprachler, die Mutter ist Deutsche. Die Sprache der Gesellschaft ist Englisch und beide Elternteile sprechen zu ihrem Kind in ihrer eigenen Muttersprache.
Romaine beschreibt als Typ zwei die Situation, in der beide Elternteile verschiedene Muttersprachen haben, wobei wiederum eine davon die dominierende Sprache der Gesellschaft ist. Im Gegensatz zu Typ eins sprechen nun beide Eltern die nicht-dominierende Sprache mit dem Kind, was bedeutet, daß das Kind der dominierenden Sprache nur außerhalb der häuslichen Umgebung, hauptsächlich im Kindergarten, ausgesetzt ist.
Beispiel: Die Familie lebt in Deutschland, der Vater ist englischer Muttersprachler, die Mutter deutsche Muttersprachlerin. Die Sprache der Gesellschaft ist Deutsch und die Eltern sprechen mit ihrem Kind englisch. Das Kind ist der deutschen Sprache nur außerhalb der Familie ausgesetzt.
Der dritte Typ trifft dann zu, wenn beide Elternteile die gleiche Muttersprache haben, die nicht mit der der Gesellschaft identisch ist. Die Eltern sprechen mit ihrem Kind nur ihre eigene Sprache, das Kind wird der zweiten Sprache nur außerhalb der Familie ausgesetzt.
Beispiel: Die Familie lebt in Italien, Vater und Mutter sind deutsche Mutter- sprachler und reden mit ihrem Kind nur deutsch. Das Kind kommt mit der italienischen Sprache nur im Umgang mit anderen Personen in Kontakt.
Der vierte von Romaine genannte Typ wird charakterisiert durch unter- schiedliche Muttersprachen der Eltern. Die Gesellschaft spricht wiederum eine andere Sprache und die Eltern sprechen mit ihrem Kind in ihrer jeweiligen Muttersprache. Hierbei sei angemerkt, daß das Kind nun mit drei Sprachen in Kontakt kommt und damit eher zum trilingualen Sprecher tendiert.
Beispiel: Die Familie lebt in England, die Sprache der Gesellschaft ist demnach Englisch. Der Vater spricht mit seinem Kind in seiner Muttersprache Deutsch, die Mutter in ihrer Muttersprache Spanisch.
Typ fünf bedeutet, daß beide Elternteile die gleiche Muttersprache sprechen, wobei diese mit der dominierenden Sprache der Gemeinschaft identisch ist. Ein Elternteil spricht nun mit dem Kind in der Muttersprache, der andere Elternteil wählt zur Kommunikation eine Fremdsprache, die nicht seine eigene ist.
Beispiel: Die Familie lebt in Frankreich, beide Elternteile sind französische Muttersprachler. Der Vater spricht mit seinem Kind französisch, die Mutter englisch.
Der letzte Typ trifft dann zu, wenn beide Elternteile selbst bilingual sind und in einer zumindest teilweise bilingualen Gesellschaft leben. Die Eltern sind im Umgang mit dem Kind nicht auf eine Sprache festgelegt und die Kommunikation ist durch code-switching und ein Vermischen beider Sprachen gekennzeichnet.
Beispiel: Die Familie lebt einer bilingualen Umgebung in Ostkanada. Sowohl Vater als auch Mutter sprechen mit ihrem Kind sowohl englisch als auch französisch.
3.2 Die Rolle des Inputs
Es ist leicht verständlich, daß die Sprache, in der die Eltern zu ihrem Kind sprechen, einen direkten Einfluß auf die sprachliche Entwicklung des Kindes hat. Andererseits hat die Sprache der Gesellschaft in den ersten Lebensjahren des Kindes nur geringe Auswirkungen, da das Kind mit der Gesellschaft nur punktuell in Kontakt tritt. Die Sprache des Mikrokosmos, in dem sich das Kind bewegt, ist in diesem Zusammenhang um einiges wichtiger. Wächst ein Kind beispielsweise in einem überwiegend französisch- sprachigen Gebiet auf, kann das Französische eine untergeordnete Rolle spielen, wenn die Hauptumgangssprache des Kindes und dessen sprach- lichen Umfeldes eine andere ist.34 Für den bilingualen Spracherwerb ist somit nur die direkte Umgebung des Kindes von Bedeutung, d. h. Eltern, Ge- schwister, Großeltern, Verwandte, Bekannte oder andere Personen, die direkt mit dem Kind kommunizieren.
Zudem spielt das Ausmaß, in dem das Kind beiden Sprachen ausgesetzt ist, eine wichtige Rolle. In einem Umfeld, das dem oben genannten „ one person - one language “ - Modell entspricht, und in dem der Vater als alleiniger Sprecher seiner Sprache nur selten für das Kind zugänglich ist, ist es zweifelhaft, ob die Inputmenge ausreicht, um das Kind zweisprachig werden zu lassen. Des weiteren kommt zur Inputmenge noch die Konsequenz der Eltern bei der Kommunikation mit ihrem Kind als wichtiger Faktor hinzu. Die Konsequenz wird hierbei sowohl seitens der Eltern als auch seitens des Kindes eingefordert. Die Eltern müssen darauf bestehen, daß ihr Kind die „Regeln“ einhält und bei der Kommunikation mit einem Elternteil auch nur die jeweilige Sprache benutzt. Tut es das nicht und sind die Eltern nicht konsequent genug, so kann dies zu einem Problem führen. Dies tritt auf, wenn beispielsweise die Mutter mit ihrem Kind in ihrer Muttersprache Italienisch spricht, mit ihrem Mann und anderen Menschen aber deutsch - der Sprache der Gesellschaft. Wird dem Kind bewußt, daß es mit der Mutter italienisch sprechen muß, diese aber in der Lage wäre, auch die zweite Sprache zu sprechen, mag es keinen Grund mehr darin sehen, die Sprache der Mutter überhaupt noch zu sprechen.35
Wie jedoch folgendes Beispiel schön zeigt, kann das absichtliche Wechseln von einer Sprache in die andere als Mittel benutzt werden, um einer Aussage noch mehr Nachdruck zu verleihen und dem Kind somit die Wichtigkeit der Äußerung zu verdeutlichen. Die andere Sprache kann hier die Sprache des Kindergartens als äußere Autorität, oder die einer anderen Autoritätsperson sein.
Mutter: Philip, viens, ton repas est pr ê t. [„Philip, komm, dein Essen ist fertig.“]
Philip: . . .
Mutter: Phi - lip! Viens ici! [„Phi - lip! Komm‘ her!“] Philip: . . .
Mutter: Philip Harding, come here! [„Philip Harding, komm‘ her!“] Philip: OK, j ’ arrive! [„OK, ich komme!“]36
Die Strategie des „ one person - one language “ impliziert, daß jeder Elternteil ständig nur eine Sprache spricht und sich nie vom Kind beim Sprechen einer anderen Sprache erwischen lassen darf. Ein ständiges Eingreifen in die Sprachwahl des Kindes muß dennoch mit Vorsicht gehandelt werden, da sich das Kind dadurch vielleicht einer Sprache ganz verschließt und den Spaß am Lernen dieser Sprache verliert. Es stellt sich in Studien heraus, daß die sprachliche Entwicklung in beiden Sprachen ganz normal vonstatten geht, auch wenn das Kind nicht ständig zur Verwendung einer Sprache gezwungen wird.37
In diesem Zusammenhang sei das emotionale Verhältnis erwähnt, das das Kind zu einer Sprache aufbaut. Es lernt seine Sprachen immer in einem bestimmten Umfeld, das für das Kind selbst eine individuelle Bedeutung hat. Genauso verhält es sich mit den Personen, die die Sprache sprechen. Schmidt-Mackey berichtet von ihren Töchtern, die dreisprachig englisch, französisch und deutsch in einem hauptsächlich englisch- und französischen Umfeld aufgewachsen sind. Deutsch wurde ausschließlich zu Hause gesprochen. Die ältere Tochter verbrachte drei Sommer bei ihren Großeltern in Deutschland, die jüngere Tochter nur zwei. Sprachlicher Input war bei beiden in ausreichender Menge vorhanden und trotzdem war die jüngere Tochter für die deutsche Sprache nicht zu begeistern. Die ältere Tochter hatte aufgrund ihrer Aufenthalte in Deutschland eine enge emotionale Bindung zum Deutschen aufgebaut und spricht die Sprache weiterhin gern.38 Dies bedeutet, daß sie die Sprache in einem ihr angenehmen Umfeld gelernt hat und eventuell mit manchen Situationen schöne Erinnerungen verbindet. In dieser Situation, in der beide Sprachen gleichberechtigt nebeneinander stehen und sie sich gegenseitig positiv beeinflussen, spricht man von einem additiven Bilingualismus.39
Wird das Kind einer Sprache nur beschränkt ausgesetzt, was in besonderem Maße bei Typ fünf der Fall ist, so führt dies zu einer eingeschränkten Ausdrucksfähigkeit, da die Inputvielfalt, die die andere Sprache auf den Ebenen der Register und des Stils bietet, nicht gegeben ist. Eine unterschiedliche Entwicklung in beiden Sprachen ist somit schon vorprogrammiert. Eine mögliche Folge wäre, daß das Kind aufgrund der Ausdrucksprobleme in einer Sprache diese gar nicht mehr verwendet, da das Sprechen zu anstrengend wird. Die dominierende Sprache hat in diesem Fall einen negativen Einfluß auf die Entwicklung der zweiten Sprache, weshalb man hier von einem subtraktiven Bilingualismus spricht.40
Hoffmann weißt in ihren Ausführungen darauf hin, daß die Erziehung eines zweisprachigen Kindes aufgrund der eben genannten Gründe zu einer ziemlichen Anstrengung und gar Belastung für die Eltern werden kann, versuchten sie, den defizitären Input einer Sprache durch Auslandsaufent- halte, Bücher, Kassetten oder ähnliches wettzumachen.41 Es zeichnet sich zudem ab, daß ein zweisprachiges Aufwachsen für die Eltern ein größeres Problem darstellt als für das betroffene Kind selbst. Dieses besitzt eigene Strategien und Mittel, um aus dem ihm angebotenen Sprachmaterial zwei Sprachsysteme zu entwickeln, wobei es nicht ausdrücklich auf seine Zwei- sprachigkeit hingewiesen werden muß.42 Es gab bisher keine Studie, die von einem Kind berichtet, das in einer totalen sprachlichen Verwirrung gelandet wäre.
Zum Faktor der eben besprochenen unzureichenden Inputmenge kommt hinzu, daß Romaines Typ fünf der oft geäußerten Forderung nach einer authentischen Umgebung nicht gerecht wird. In einem solchen Umfeld des Spracherwerbs ist es von einer ungeheuren Wichtigkeit, daß sich der Elternteil, der dem Kind gegenüber eine für ihn selbst fremde Sprache spricht, sich in dieser Sprache selbst wohlfühlt. Des weiteren muß er die Sprache in einem Maße beherrschen, das nahe an einen Muttersprachler heranreicht. Wäre dem nicht der Fall, so wäre es eher unwahrscheinlich, daß das Kind den nahezu perfekten zweisprachigen Status erreicht. Es erscheint zweifelhaft, daß ein Elternteil durch das bloße Sprechen einer Fremdsprache ein ausreichend authentisches Umfeld für das Kind schaffen kann. Deshalb kann angenommen werden, daß das Kind aufgrund der geringen und auch qualitativ nicht unbedingt einwandfreien Inputmenge die Sprache nur unzu- reichend lernt. Dieses potentielle Problem mag der Grund dafür sein, daß sich einige Eltern im Endeffekt gegen eine zweisprachige Erziehung ent- scheiden, da sie fürchten, eine nicht einwandfreie Sprachpräsentation und eine evtl. falsche zweisprachige Erziehung könnten zu einer defizitären Sprachentwicklung des Kindes führen. Gerade solche Ängste führen dazu, daß die Möglichkeiten zu einer zweisprachigen Erziehung nicht wahrge- nommen werden.43
Es schließt sich hier die von zahlreichen Handbüchern für Eltern zur bilingualen Erziehung behandelte Frage an, ob sich eine bestimmte Strategie der Sprachpräsentation mehr eignet als andere. Wenngleich die Strategie des „ one person - one language “ von vielen favorisiert wird, gibt es in Studien zu den sechs verschiedenen Typen keinerlei Hinweise, daß das „Endprodukt Zweisprachigkeit“ im einen oder anderen Fall besser erreicht wurde. Es konnte auch kein Beweis dafür erbracht werden, daß eine Strategie zu einem etwaigen sprachlichen Rückstand oder anderen Nachteilen führt. Alle Kinder sind nach einer gewissen Zeit44 in der Lage, sich sowohl in der einen als auch in der anderen Sprache zu verständigen und auch beide Sprachsysteme voneinander zu unterscheiden, vorausgesetzt natürlich, daß genügend Input in beiden Sprachen voranden ist.45
Trotz der Tatsache, daß im Endeffekt bei allen Strategien dasselbe Endprodukt entsteht, kann darüber spekuliert werden, ob es nicht eine Methode dem Kind erleichtern kann, zwei Sprachen auf einmal zu lernen. Eine Situation, die durch eine ständige Vermischung beider Sprachen im Input charakterisiert ist, wird zweifelsohne zu einer durch mixing gekenn- zeichneten Sprachproduktion seitens des Kindes führen. Muß demnach eine strikte Sprachtrennung im Input gegeben sein, um das Kind auf einfache Art und Weise zum perfekten zweisprachigen Sprecher werden zu lassen? Diese Vorstellung herrscht jedenfalls traditionell noch als Idealbild vor. Es ist diese Strategie, der der größte und schnellste Erfolg zugeschrieben wird. Grammont geht beispielsweise davon aus, daß das Kind dadurch zwei Sprachen ohne große Anstrengungen lernt und, was ihm noch viel wichtiger ist, beide Sprachen strikt voneinander trennen kann.46
Man muß sich an diesem Punkt klar vor Augen führen, daß eine strikte Trennung nach dem Prinzip „ one person - one language “ in der Wirklichkeit kaum oder nur mit hoher Disziplin seitens der Eltern realisierbar ist. Es wurde immer wieder festgestellt, daß selbst Eltern, die behaupteten, ihr Kind rein nach dieser Maxime aufzuziehen, in ihren eigenen Äußerungen teilweise Elemente aus der jeweils anderen Sprache benutzten. Je älter das Kind wurde und je profunder dessen Kenntnisse in beiden Sprachen wurden, um so häufiger wurde festgestellt, daß die Eltern sogar ganze Äußerungen in der anderen Sprache produzierten.47 Dies weißt wiederum auf das bereits genannte Problem der Konsequenz seitens der Eltern hin. Eine Folge dieser Strategie wäre außerdem ein kontextgebundener und auf eine Person fixierter Wortschatzerwerb, der dazu führt, daß das Kind in jungen Jahren äquivalente Wortpaare in beiden Sprachen nicht sofort als solche erkennt, worauf in Kapitel 4.2.1 noch genauer eingegangen werden wird.
Bis hierher wurde davon ausgegangen, daß das Kind in einer relativ stabilen sprachlichen Umwelt aufwächst. Das bedeutet, daß der Spracher- werb ein Kontinuum ohne Unterbrechungen beschreibt. Es ist jedoch auch in manchen Fällen die Möglichkeit gegeben, daß dieses Kontinuum durch äußere Umstände unterbrochen wird, was mit einer veränderten Zusammen- setzung des Inputs einher geht. Gerade in bilingualen Familien, in denen beide Elternteile unterschiedlichen Nationalitäten angehören, ist ein Wohn- ortswechsel in ein anderes Land durchaus denkbar. Die Folge wäre ein plötz- licher Abbruch des regelmäßigen Kontakts mit einer der beiden Sprachen, was in einer Verschlechterung der Performanz oder gar eines fast totalen Verlusts der Kompetenz resultieren könnte.48 Ein wichtiger Faktor hierbei ist jedoch das Alter und die bis dahin erreichte Sprachkompetenz des Kindes. Ist die Hauptphase des Spracherwerbs abgeschlossen, d. h. besitzt das Kind ein System von bereits fest im Gehirn verankerten grammatikalischen und syntaktischen Strukturen sowie einen umfangreichen Wortschatz, so ist die Gefahr des Sprachverlusts relativ gering. Bei geringer Nutzung einer Sprache wird der aktive Wortschatz zunächst zu einem passiven, der jedoch relativ schnell wieder aktiviert werden kann. Ganz anders sieht es bei Kindern aus, die noch auf eine ausreichende Menge an Input angewiesen sind, um ihr Sprachsystem aufzubauen. Eine geringere Inputmenge führt logischerweise dazu, daß die entsprechende Sprache vom Kind weniger gesprochen wird.
Die Meinung mancher Forscher, die Qualität des Inputs sei wichtiger als die Quantität, ist nicht nachvollziehbar. Ein Kind, das hauptsächlich in einem französisch sprechenden Umfeld aufwächst wird nicht perfekt englisch sprechen, wenn es nur einmal in der Woche für zwei Stunden mit einem englischen Muttersprachler Kontakt hat, auch wenn dieser Input noch so hochwertig wäre.
Ein Defizit im Input wird sich anfangs hauptsächlich auf die pro- duktiven Fähigkeiten auswirken. Die rezeptiven Kompetenzen werden weit- gehend unangetastet bleiben.49 Doch auch hier müssen das Alter und die Länge der Zeitspanne, in der der Input gering ist oder gar fehlt, als wichtige Faktoren berücksichtigt werden. Das Fehlen von Input wirkt sich auf jeden Fall negativ auf die Kompetenz des Sprechers aus. Um für einen Sprecher den Status „bilingual“ aufrecht erhalten zu können, bedarf es eines kontinuierlichen Benutzens beider Sprachen in authentischen Umge- bungen.50
In der Diskussion um die beste Strategie zum Erlangen der Zwei- sprachigkeit steht immer wieder die Hypothese im Vordergrund, daß durch das Modell „ one person - one language “ das Kind seine beiden Sprach- systeme nicht durcheinander bringen kann. Es bleibt aber die Frage offen, wie das Kind die Sprachen tatsächlich aufnimmt und in seinem Kopf organisiert. Aus der Methode des „ one person - one language “ könnte man ableiten, daß beide Sprachen im Kopf des Kindes gleich von Anfang an in zwei strikt voneinander getrennten Systemen gespeichert würden. Die logische Folge davon wäre, daß ein gemischtes Input zu einer Speicherung in einem einzigen System beim Kind führt und demnach eine Trennung in L1 und L2 zumindest am Anfang des Spracherwerbs nicht möglich ist. Die erste These ist nicht ohne Zweifel haltbar, da man nicht erwarten darf, daß das Kind von Geburt an davon ausgeht, zwei verschiedene Sprachen präsentiert zu bekommen, die es dann ohne weiteres in zwei Systemen speichert. Hat ein Säugling überhaupt irgendwelche Erwartungen was Sprachen angeht? Oder muß man vielmehr davon ausgehen, daß ein Verhalten gegenüber einer Sprache, bzw. gegenüber mehreren Sprachen erst im Laufe der Zeit, d.h. mit zunehmenden kognitiven Fähigkeiten entsteht? Diese Frage soll im folgenden Kapitel thematisiert werden.
4 Das mentale Lexikon
Bevor auf die Entwicklung und den Aufbau des mentalen Lexikons bei monolingualen Kindern eingegangen wird, soll geklärt werden, was unter dem Begriff des Lexikons zu verstehen ist.
Das Lexikon ist der Speicher, der alle existierenden Wörter einer Sprache beinhaltet, auf die die Sprecher der Sprachgemeinschaft sowohl bei der Sprachproduktion als auch beim Sprachverständnis zurückgreifen können. Der individuelle sowohl aktive als auch passive Wortschatz jedes Sprechers ist im mentalen Lexikon gespeichert. Dieses enthält für jedes Wort Informationen aus allen linguistischen Gebieten wie Phonologie, Wortklasse, Orthographie, Syntax, Morphologie und Semantik und ermöglicht dem Sprecher dadurch die richtige Auswahl zur grammatikalisch richtigen, der Situation angepaßten Verwendung der Wörter bei der Sprachproduktion. Die Sprecher benutzen die Einheiten des mentalen Lexikons sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption von sprachlichem Material, denn auch beim Hören einer sprachlichen Äußerung einer anderen Person muß das entsprechende Wort im mentalen Lexikon erst gefunden werden, um den Gegenüber auch inhaltlich zu verstehen. Benutzt dieser ein unbekanntes Wort, so wird er von mir nicht verstanden, da mein Lexikon hier eine Leerstelle aufweist.51 Das mentale Lexikon ist ein wohlstrukturiertes System, welches es dem Sprecher ermöglicht, binnen Millisekunden ein bereits gespeichertes Wort zu erkennen oder aus dem Speicher abzurufen.52
4.1 Die Entwicklung des Lexikons
Der Prozeß des Spracherwerbs ist genauso wie die allgemeine kognitive Entwicklung eng an die Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt gekoppelt. Die Nervenzellen des Gehirns bilden lediglich die biologi- sche Grundlage, die sich durch den Dialog mit der Außenwelt ständig weiterentwickelt und sich zu einem engen, kompliziert funktionierenden Netzwerk verbinden.53
Für die vorliegende Arbeit ist diese Auseinandersetzung des Klein- kindes mit seiner Umwelt von großem Interesse, da sie für den Spracherwerb unumgänglich ist. Gerade in den ersten Lebensmonaten treten gehäuft sog. brain spurts (Gehirnspurts) auf. Damit sind Phasen einer beschleunigten Gehirnentwicklung gemeint, die sich nach dem zweiten Lebensjahr in einem drei- bis vierjährigen Abstand bis zum zwanzigsten Lebensjahr wiederholen. Die Zeitpunkte der enormen brain spurts kurz vor Abschluß des zweiten Lebensjahres stimmen überein mit einer hochaktiven Phase der sprachlichen Entwicklung, in der es vor allem zu einem deutlichen Anstieg des Vokabulars kommt und die mit dem Schlagwort des vocabulary spurt benannt wird.54
Vor diesem Wortschatzspurt hat sich das Kind von seinem etwa 10. bis 18. Lebensmonat ein kleines Lexikon von ca. 50 Wörtern aufgebaut. Diese erste Phase des Wortschatzerwerbs ist durch extreme Langsamkeit gekennzeichnet.55 Das hängt unter anderem damit zusammen, daß das Kind nicht nur neue Wörter lernen muß, sondern vorher die Fähigkeit erreichen muß, konkrete Laute zu bilden, um damit die neuen Wörter in immer wieder gleicher, für die Mitmenschen wiedererkennbarer Weise auszusprechen.56 Die Zeit der ersten Wortäußerungen wird zudem charakterisiert durch Ein- Wort-Äußerungen57, wobei dem Kind die Aussprache noch erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Das sprachliche Vorbild der Erwachsenen kann noch nicht exakt reproduziert werden und somit benutzt das Kind Varianten, die leichter auszusprechen sind, was dazu führt, daß der Sinn des Wortes für Zuhörer nicht immer eindeutig erkennbar wird.58 Das Verhältnis von Wörtern mit exakter Aussprache gegenüber solchen mit nur annähernder Aussprache verändert sich innerhalb einer Zeit von acht Monaten seit der ersten EinWort-Äußerung zugunsten der exakten Aussprache.59
Betrachtet man die Art der ersten Wörter, so zeigt sich, daß es sich fast ausschließlich um kontextgebundenes Vokabular handelt. Grund hierfür sind die dem Kind nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehenden kognitiven Fähigkeiten, die nur eine auf bestimmte Situationen begrenzte Verwendung der Wörter zulassen. Erst im zweiten Lebensjahr ist das Kind in der Lage, eine Situation nicht mehr nur als gesamtheitliches Ereignis zu erleben, sondern es als ein Konstrukt aus mehreren Einzelteilen zu sehen.60
Während Clark davon ausgeht, daß es sich beim Neuerwerb von Wörtern anfangs ausschließlich um ein kontextbezogenes und globales Lernen handelt, weisen Meibauer und Rothschild darauf hin, daß diese Hypothese unter dem Gesichtspunkt zu modifizieren ist, daß nicht alle Kinder in ihrer Entwicklung denselben Mustern folgen. Demnach gibt es auch Kinder, die ihr Vokabular nicht kontextbezogen, sondern gleich objektbezo- gen lernen. Sie sind demnach schon früh in der Lage, Dinge und auch Situationen in ihren Einzelteilen wahrzunehmen. Sie sind fähig, einen Begriff nur auf ein bestimmtes Objekt, das lediglich ein kleines Element in einem größeren Zusammenhang darstellt, zu beziehen und auch in anderen Situationen wiederzuerkennen. Solche Kinder, die die gleichen Wörter in verschiedenen Kontexten verwenden, sind nach Rothweiler und Meibauer häufiger anzutreffen als solche, die kontextbezogen lernen.61 Zu dieser Annahme ist jedoch zu sagen, daß das Alter, in dem ein Wort gelernt wird unbedingt eine Rolle spielt, da kognitive Fähigkeiten nicht unbeachtet bleiben dürfen. Diese Fähigkeiten entwickeln sich mit zunehmendem Alter und somit kann man vielleicht davon ausgehen, daß das Kind anfangs kontextbezogen lernt und sich diese Lernform erst mit der zunehmenden Gehirnentwicklung und vor allem kurz vor Vollendung des zweiten Lebensjahres in ein objektbe- zogenes Lernen umwandelt.
Aufgrund des Aufbrechens einer komplexen Situation in ihre Bestandteile und des damit einhergehenden plötzlichen Anstiegs der Anzahl von Konzepten braucht das Kind eine große Menge neuer Begriffe, um diese auch benennen zu können. Das Resultat ist demnach der bereits erwähnte Wortschatzspurt.62 Kinder werden sich zu diesem Zeitpunkt bewußt, daß alles in ihrem Umfeld mit einem Wort bezeichnet werden kann und der Wortschatzspurt ist die Folge des plötzlichen Verlangens, die Dinge beim Namen zu nennen.
Dieser Anstieg bedeutet aber nicht, daß sich der Wortschatz jedes Kindes von heute auf morgen sprunghaft verändert. Es ist vielmehr eine Entwicklung, die sich individuell verschieden äußert. So läßt sich bei einem Kind ein stetiges Anwachsen des Vokabulars feststellen, bei einem zweiten ist es eher ein schubhaftes Wachsen, nach dem wieder eine Stagnations- phase folgt.63 Goldfield und Reznick fanden in ihrer Studie zum vocabulary spurt, daß das Lexikon von Kindern, deren Wortschatz nur langsam aber stetig ansteigt, durch ein ausgeglichenes Repertoire verschiedener Wortklassen gekennzeichnet ist. Im Kontrast dazu besteht das Vokabular von Kindern, deren Wortschatz sprunghaft wächst, zu 80% aus Nomen. Diese Tatsache wird damit erklärt, daß erstere ihre Umwelt in ihrer Differenziertheit und Komplexität sehen und sie auch dementsprechend beschreiben möchten. Aufgrund des differenzierteren Vokabulars verläuft die Kurve des Wortschatzerwerbs weniger steil und die Tatsache eines Wortschatzspurtes im Sinne eines sprunghaften Wachstums des Lexikons wäre nicht gegeben. Zweitere sind hingegen von der neuen Erkenntnis getrieben, daß alles in der Umwelt mit einem Wort benannt werden kann, was dazu führt, daß der Wortschatz eine übermäßige Anzahl von Nomen aufweist und wegen der Einfachheit der Wortklassen dementsprechend schneller wachsen kann. Beide Formen haben jedoch gemeinsam, daß sie dann einsetzen, wenn das Kind über ein Wortschatz verfügt, der ca. 50 Wörter umfaßt.64 Dromi stellt nach der Phase des Wortschatzspurtes eine Phase fest, die wiederum nur durch wenige Neuzugänge gekennzeichnet ist. Sie erklärt dies damit, daß diese Zeit dafür genutzt wird, das neu gelernte sprachliche Material in seiner Bedeutung besser zu verstehen und in bereits vorhandene Strukturen einzuordnen.65
Aufgrund der Tatsache, daß das Kind in dieser Phase des Lexikon- erwerbs in kurzer Zeit eine große Anzahl neuer Wörter lernt, muß es sich einer Strategie bedienen, um die neuen Informationen verarbeiten zu können. Wörter werden schon nach ein- oder zweimaligem Hören in den passiven Wortschatz aufgenommen. Das Kind nimmt jedoch das Wort zunächst noch nicht in seiner vollständigen semantischen Dimension und seiner korrekten phonologischen Realisation auf. Da alles sehr schnell gehen muß, reduziert das kindliche Gehirn das neue Wort in kürzester Zeit auf ein Grundgerüst. Dieses enthält gerade noch die allerwichtigsten semantischen und phonologischen Informationen, damit es dem Kind ermöglicht wird, das Wort später wiederzuerkennen. Da davon ausgegangen werden kann, daß das Kind den - oder zumindest einen - Inhalt des Wortes verstanden hat, bedeutet dies, daß zuerst ein Konzept im Lexikon verankert wird, das langsam mit weiteren Informationen zu Semantik, Grammatik und Phonologie gefüllt wird. Dieser erste Prozeß der Wortaneignung, der das spontane Abbilden des Wortes im mentalen Lexikon beschreibt, wird gemeinhin als fast mapping 66 bezeichnet.67
Für das fast mapping ist zudem wichtig, daß das neue Wort noch nicht aktiv verwendet wird. Es bedarf noch weiterer Präsentationen, damit sich das Kind zusätzliche Informationen aneignen kann, um schließlich in der Lage zu sein, das Wort aktiv zu produzieren. Da die Gedächtnisspanne von Klein- und Vorschulkindern noch relativ begrenzt ist, muß eine erneute Präsentation schon bald nach der ersten erfolgen. Finden zusätzliche Präsentationen nicht statt, wird der schwache erste Eindruck des Wortes bald wieder aus dem Gedächtnis gelöscht.68
Ein Wort ist als ein ganzes Bündel von semantischen Eigenheiten zu sehen, wobei für das Verständnis des Wortes nicht unbedingt alle vom Kind gekannt werden müssen. So ist beispielsweise das Wort <Katze> ein Bündel folgender Merkmale: [+Objekt, +beweglich, +vierbeinig, +Fell, +Schnurrhare, +miauen]. Es sind aber nicht alle Merkmale notwendig, um eine Katze zu charakterisieren. Manche sind hierbei weniger wichtig als andere und können somit bei einer ersten kurzen Betrachtung weggelassen werden. Nach Clarks Hypothese wäre es jedoch falsch anzunehmen, daß das Kind beim ersten Kontakt mit dem Wort <Katze> das Objekt auf seine allgemeinen Grundzüge reduzieren würde und erst später die genauer beschreibenden Merkmale hinzufügt. Nach diesem Denkmodell müßte das Kind zunächst mit dem allgemeinen Merkmalbündel [+Objekt, +beweglich, +vierbeinig] auskommen, was aber genausogut auf andere Tiere wie Hund, Pferd und Schaf zutrifft. Aufgrund dieser Tatsache geht Clark davon aus, daß das Kind zuerst die Katze in ihrer Gesamtheit wahrnimmt und dabei der Bezeichnung <Katze> noch viel mehr Merkmale zuschreibt als ein Erwachsener. Die so entstandene unnötige Überzahl an Merkmalen wird im Laufe der Zeit auf eine den Erwachsenen gleiche Anzahl abgebaut.
Clark verwarf ihre zu Anfang der 70er Jahre aufgestellte Hypothese jedoch wieder, da in Studien die beschriebenen übergroßen Merkmalsbündel erst zu einem späteren Zeitpunkt, d. h. nicht bei der ersten Präsentation eines Wortes, festgestellt wurden.69 Es erscheint auch wenig logisch zu sein, daß das Kind ein Wort sofort in all seinen verschiedenen Bedeutungen aufnimmt, denn wie bereits gesagt, zeichnet sich das fast mapping gerade dadurch aus, daß ein Wort auf seine Grundzüge reduziert wird.
Bei der Sprachproduktion in der frühen Kindheit kann man trotzdem in manchen Fällen eine Übergeneralisierung und damit eine unzulässige Bedeutungserweiterung des Wortes beobachten. Dieses Phänomen wird als Resultat dessen gesehen, daß das Kind noch nicht über ein ausreichend differenziertes Vokabular verfügt, um seine Umwelt richtig benennen zu können. Somit wird ein Wort fälschlicherweise für Objekte oder Sachverhalte benutzt, die nach Meinung des Kindes dem Inhalt des Wortes nahe kommen, oder ihm gar gleichen. Durch diesen Trick wird gewährleistet daß die Kommunikation mit einer anderen Person nicht ins Stocken gerät.70 Als Beispiel kann hier angeführt werden, daß im Englischen das Wort duck auch für einen Pfau (peacock) vom Kind benutzt wird. Einerseits kann man hier argumentieren, daß das Kind das Wort peacock vielleicht schon kennt, aber es noch nicht aussprechen kann und sich deshalb für die leichtere Variante duck entscheidet. Andererseits könnte es auch mit einer nicht differenzierten Wahrnehmung der Umwelt zusammenhängen. Die primären Merkmale von Ente und Pfau stimmen zu einem großen Teil überein: [+Objekt, +beweglich, +zweibeinig, +Federn, +Schnabel]. Eine solch große Übereinstimmung verbunden mit der Tatsache, daß das Wort peacock noch unbekannt ist, mag das Kind zu dem Schluß bewegen, daß beide mit dem gleichen Wort zu benennen sind. Eine weitere Ausdifferenzierung des begrifflichen Inhalts und damit die Entwicklung hin zur Bedeutung, die ein Erwachsener mit dem Wort verbindet, findet im Laufe der Zeit statt.71
Dromi weist jedoch darauf hin, daß es falsch wäre, die Übergeneralisierung eines Wortes mit einer unzureichenden Differenzierung der Umwelt gleichsetzen zu wollen. So wurde beispielsweise nachgewiesen, daß die Übergeneralisierung wohl bei der Sprachproduktion, nicht aber bei der Rezeption auftritt. Das führt zu dem Schluß, daß der durch ein übergeneralisiertes Wort fälschlicherweise benannte außersprachliche Referent nicht auch gleichzeitig im Konzept, das dem Wort zugrunde liegt, eingeschlossen ist. Durch den Trick der Übergeneralisierung wird in Dromis Dafürhalten lediglich gewährleistet, daß die Kommunikation mit einer anderen Person nicht durch Lücken im Wortschatz abgebrochen wird.72
Um die Bedeutung des neu erlernten Wortes zu erschließen, bezieht sich das Kind auf grammatikalische Informationen, wie beispielsweise die Stellung des Wortes im Satz, sowie weitere direkte Hinweise seines Gegenübers. Es ist davon auszugehen, daß dieser stark daran interessiert ist, daß das Kind das neue Wort versteht und somit die nötigen Informationen liefert, um ein erstes Verstehen zu gewährleisten. Man kann demnach hier von einer Verschränkung von sprachlichen und nichtsprachlichen Infor- mationen sprechen.73
Für den Vorgang des fast mapping ist es von Nöten, daß das Kind über bestimmte Methoden verfügt, die es ihm ermöglichen, ein Wort schnell in das mentale Lexikon einzuschreiben. Diese Annahme impliziert gleich- zeitig, daß das kindliche Gehirn sprachliche Informationen in bestimmte Kategorien einordnen kann, um sich nicht selbst in einer mentalen Unord- nung zu verlieren. Ein neues Wort muß gerade in einer Phase des enormen Wortschatzanstiegs mit bereits vorhandenem Material verglichen und entsprechend verknüpft werden. Dieses bereits existierende Material kann einerseits ein Konzept oder ein Konzeptbündel sein, andererseits aber auch ein Lexem direkt. Die Bedeutung eines Wortes kann demnach durch Analogie oder aber auch durch Abgrenzung zu bereits bekannten Elementen erschlossen werden. Carey gibt zur Verdeutlichung folgendes Beispiel:
„ When children hear ‚ Bring me the beige one, not the blue one, ‘ they could realize that beige is an English word, that it refers to a property of an object, that it is a color word, and also know which color it names. Thus by contrasting a novel term with a well-known term, one can provide an enormous amount of information about the meaning of the new term. “ 74
Die meisten Hypothesen zum Spracherwerb messen dem Kind eine hohe linguistische Kompetenz bei. Bei dem erwähnten Beispiel kann das Kind durch das Abgrenzen von der Bedeutung anderer Wörter zur Bedeutung des neuen Wortes kommen. Dies setzt voraus, daß sich das Kind bewußt ist, daß ein Wort nur einen einzigen Sachverhalt beschreibt und somit ein Wort ein anderes in der Bedeutung ausschließt. Das schnelle Eliminieren von abwegigen Wortbedeutungen führt in den meisten Fällen zum richtigen Ergebnis, was Heibecks und Markmans Studien zeigen. Die Bedeutung des Wortes wird demnach durch das Aufstellen von Hypothesen erraten, wobei die Anzahl der Hypothesen einerseits aufgrund der Kürze der Zeit, die zum Nachdenken bleibt, und andererseits wegen der sich noch in der Entwicklung befindlichen Gehirnleistung des Kindes auf eine kleine Anzahl beschränkt bleibt. Dies erleichtert es wiederum, die offensichtlich falschen Hypothesen schnell zu verwerfen, um schließlich ein vages Bild einer Bedeutung im Lexikon zu speichern.75 Man muß sich hier jedoch auch dessen bewußt sein, daß das Kind aufgrund des Bestrebens, Wörter gegeneinander abzugrenzen auch Wörter mit absolut gleicher Bedeutung aber anderer äußerer Form als zwei Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung sehen kann.76
Auf einer anderen Ebene kann das Kind sich auch über grammatikali- sche Informationen Zugang zu einem Wort verschaffen und es aufgrund dessen in bestimmte Kategorien einordnen. Es ist in der Lage, durch die grammatikalische Form des ihm präsentierten Wortes die neu erlernten Elemente nach Wortklassen wie Nomen, Verben oder Adjektive ordnen, was bedeutet, daß das Kind schon im jungen Alter eine hohe analytische Fähig- keit aufweisen muß. Es muß fähig sein, Wortklassen an der Stellung im Satz oder durch Flexionsendungen77 zu erkennen. In diesem Fall ist das Kind in der Lage, einen Rückschluß von der Wortklasse auf die Semantik eines Wortes zu ziehen, was wiederum eine Hilfe beim Lexikonerwerb darstellt. Kategorisiert es beispielsweise ein Wort als Verb, so kann es annehmen, daß dieses Wort nicht zur Benennung eines konkreten Objekts benutzt werden kann, sondern irgendeine Aktivität beschreiben muß. Dieses Phänomen wird als bootstrapping 78 bezeichnet, wobei das Kind einerseits den semantischen Zugang zu einem Wort durch dessen syntaktischen Eigenschaften erlangen kann (syntaktisches bootstrapping) oder anderer- seits syntaktische Eigenschaften aus den semantischen Informationen ableitet (semantisches bootstrapping).79
Kindern ist es, wie bereits erwähnt, schon relativ früh möglich, ein Wort in einer den Erwachsenen sehr nahe kommenden Aussprache zu realisieren. Der Aufbau des Wortschatzes, d. h. das Lernen neuer Wörter, dauert aufgrund der großen Menge von Material erheblich länger. Trotzdem ist der kleine, ca. 100 Wörter umfassende Wortschatz eines Kleinkindes dem eines Erwachsenen in seiner Zusammensetzung ähnlich. So verfügt das Kind wie der Erwachsene über weitaus mehr Bezeichnungen für konkrete Dinge als für Aktivitäten. Aufgrund der geringen Anzahl von Wörtern insgesamt sind die Möglichkeiten für das Kind, Aktivitäten zu benennen, auf ein Minimum reduziert. Aktivitäten werden im englischen Sprachraum zumeist mit den Verben to do, to make, to get und to go ausgedrückt.80 Auf der zu diesem Zeitpunkt dominierenden Seite der Nomen stehen Wörter im Vordergrund, die den Alltag des Kleinkindes bestimmen.81 Der Grund für die Dominanz von Nomen liegt u. a. darin, daß das Kind in der ersten Phase der Sprachaneignung häufig einfach auf etwas zeigt und dieser Gegenstand dann von einem Erwachsenen mit einem Wort benannt wird.82
Hierbei ist es noch bemerkenswert, daß in der Phase der Ein-Wort- Äußerungen zwischen den Wörtern zumeist keine semantische Beziehung besteht. Es werden pro semantischem Feld der Erwachsenensprache lediglich ein oder zwei Wörter gelernt. Erst mit einer zunehmenden Differenzierung des Wortschatzes und dessen stetigem Wachstum besonders in und nach dem Wortschatzspurt werden Lücken in den semantischen Feldern ausgefüllt.83
Trotz seines geringen Wortschatzes, hat das Kind dennoch das Bedürfnis, seine Umwelt mit Bezeichnungen zu versehen. Aus diesem Grund wendet es schon früh bestimmte Wortbildungsverfahren an, die es ermög- lichen, den Wortschatz in sich zu variieren und daraus neue Wörter entstehen zu lassen. Dies setzt aber voraus, daß es die bereits vorhandenen Wörter analysieren kann, um die Wortbildungsmuster daraus abzuleiten. Wenn es nicht erkennt, daß Wörter im Deutschen beispielsweise durch das Aneinanderreihen von Nomen neu gebildet werden können, ist es auch nicht in der Lage, das Wort <Haus-tür> in <Zimmer-tür> umzuwandeln. Ähnlich sieht es bei Wörtern aus, die aus einem Stamm plus Suffix bestehen. Das Kind muß erst die Teile des Wortes erkennen, um nach diesem Muster neue Wörter bilden zu können.84
4.2 Der bilinguale Spracherwerb
Bisher wurde die Aneignung des Lexikons aus der Sicht des mono- lingualen Kindes betrachtet. Bei der Beschäftigung mit dem doppelten Erstspracherwerb drängt sich nun die Frage auf, ob und inwiefern sich der Erwerb von zwei Sprachen von dem einer einzigen Sprache unterscheidet. Es ist eine grundlegende Überlegung herauszufinden, wie sich das gelernte Sprachmaterial im Gehirn organisiert, d. h. ob die beiden Sprachen in einem einzigen System oder in zwei Systemen repräsentiert werden. Bezogen auf die Thematik dieser Arbeit bedeutet dies die Frage, ob die Wörter, die ein Kleinkind lernt, in einem Lexikon zusammengefaßt werden, oder ob jedes Wort sofort im separaten mentalen Lexikon der entsprechenden Sprache gespeichert wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Ein System oder zwei?
Die ersten Forschungen zur Frage, wie das bilinguale Lexikon im Gehirn zweisprachiger Kinder organisiert ist, wurden Ende der siebziger Jahre begonnen und bis heute folgten weitere nach. Leopold hatte zwar bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Überlegungen in diese Richtung angestellt, mehr Beachtung fanden jedoch die Ausführungen von Volterra und Taeschner. Ihr oft zitierter Aufsatz, der 1978 im Journal of Child Language erschien, bildete sozusagen den Ausgangspunkt für ein neues Wissenschaftsgebiet. Taeschner präzisierte ihre Forschungsergebnisse nochmals anfangs der achtziger Jahre. Aufgrund der Wichtigkeit dieses Ansatzes soll dieser zunächst dargestellt werden, um danach auf die heutige Sichtweise der Problematik überzuleiten, die Volterra und Taeschners Ansatz zwar generell respektiert, aber trotzdem nicht unkommentiert und unkritisiert läßt.
4.2.1 Erste Forschungsansätze
Volterra und Taeschner beschreiben in ihren Ausführungen den kindlichen doppelten Erstspracherwerb als dreiphasiges Modell. Demnach ist eine erste Phase gekennzeichnet durch das Bestehen eines einzigen lexikalischen Systems, das Elemente beider Sprachen beinhaltet. In einer zweiten Phase ist das Kind in der Lage, zwischen zwei Systemen zu unterscheiden, wobei es aber dieselben grammatikalischen Regeln auf beide anwendet. Die syntaktischen Regeln müssen dabei nicht unbedingt die der einen oder die der anderen Sprache sein. Es kann nicht immer eindeutig festgestellt werden, ob das Kind nun die Regeln von L1 oder die von L2 benutzt. Es ist vielmehr so, daß es sich eigene Regeln schafft, die es für beide Sprachen verwendet.85 Nach Chomsky verfügt jedes Kind über ein sog. LAD (engl. Language Acquisition Device), das es ihm erlaubt, die Struktur einer Sprache selbst mit minimalem Weltwissen und minimaler Kommunikation zu erkennen. Es existiert demnach eine universelle Grammatik, die jedem Kind schon quasi angeboren ist und die von einem semantischen Wissen und kommunikativen Funktionen unabhängig ist.86
Die dritte Phase wird dann eingeleitet, wenn das Kind fähig ist, zwischen beiden Sprachen vollständig zu unterscheiden, d. h. sowohl in lexikalischer als auch in syntaktischer Hinsicht. Zu diesem Zeitpunkt werden beide Sprachen noch mit der Interaktion mit bestimmten Personen verbunden. Das Kind assoziiert eine Sprache mit einer Person, was ebenfalls unter dem Stichwort „ one person - one language “ zusammengefaßt wird. Nach Volterra und Taeschner ist das Kind erst am Ende der dritten Phase als wirklich zweisprachig zu bezeichnen, da es dann in der Lage ist, die Sprachen unabhängig von seinen jeweiligen Gesprächspartnern zu benutzen.87
Die Forschungen von Volterra und Taeschner beziehen sich auf zwei bilingual italienisch und deutsch in Italien aufwachsende Mädchen - Giulia und Lisa. Das gesammelte Material besteht aus Tonbändern, die seit den ersten Wortäußerungen der beiden Mädchen bis zu deren vierten Lebensjahr alle zwei Monate aufgenommen wurden. Bei den Aufnahmen waren abwechselnd italienische und deutsche Sprecher anwesend, wobei auch die Sprechsituationen mit einer unterschiedlichen Anzahl von anwesenden Personen variierten.88
4.2.1.1 Phase 1: Ein einziges Sprachsystem
Taeschner modifiziert das von ihr mit Volterra entworfene dreiphasige Modell in ein zweiphasiges. Sie geht demnach davon aus, daß in einer ersten Phase des Lexikonerwerbs alle neu erlernten Wörter in einem einzigen Lexikon gespeichert werden, wobei es fast keine Äquivalente zwischen den beiden Sprachen gibt.89 Das bedeutet, daß ein Lexikon mit Material aus beiden Sprachen aufgebaut wird, was die Existenz von Äquivalenten nicht notwendig macht. Trotzdem stellt Taeschner fest, daß ein paar wenige Wörter in beiden Sprachen auftauchen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß bestimmte Wörter in bestimmten Situationen gelernt und auch später nur für diese Situationen benutzt werden. Somit ist der außersprachliche Referent, den das Kind mit dem Wort in Verbindung bringt in beiden Fällen verschieden. Das Kind ist sich nicht bewußt, daß beide Ausdrücke dasselbe Objekt oder denselben Sachverhalt beschreiben, selbst wenn das eigentliche Objekt in verschiedenen Situationen gleich ist.90 Da die Objektumgebungen aber verschieden sein können, stellen sie für das Kind verschiedene Objekte dar, die entweder mit dem Wort aus L1 oder dem aus L2 benannt werden.91
In den Ausführungen Weinreichs, in denen er Unterschiede in der mentalen Organisation der beiden Sprachen beschreibt, würde das Kind in diesem Stadium dem entsprechen, was er mit dem Ausdruck des coordinate bilingual bezeichnet. Im Gegensatz zum compound bilingual hat der coordinate bilingual für zwei äquivalente Wörter zweier Sprachen jeweils verschiedene Konzepte. Weinreich macht dies am Beispiel des englischen, bzw. russischen Wortes für Buch deutlich:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Coordinate and compound bilingualism nach Weinreich (1974)
In Fall (A) hat der bilinguale Sprecher zwei verschiedene Konzepte, ein englisches und ein russisches, die jeweils mit dem entsprechenden englischen oder russischen Wort bezeichnet werden. Um es mit de Saussure auszudrücken, wird einem signifi é jeweils nur ein signifiant zugeordnet. Die beiden Konzepte stehen nebeneinander, weswegen Weinreich von einem coordinate bilingualism spricht. Fall (B), der den compound bilingualism erklärt, geht davon aus, daß nur ein Konzept existiert, das durch zwei verschiedene lautliche Realisationen ausgedrückt werden kann.92
Bezogen auf die Frage der mentalen Repräsentation zweier Sprachen kann der compound bilingualism nun bedeuten, daß der Sprecher über ein schiedlich. So zog sie das englische Wort in formellen Situationen dem deutschen vor, unter familiären Umständen benutzte sie das deutsche Wort. (Vgl. Romaine, S. 188.) einziges Sprachsystem mit zwei unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten verfügt. Das Sprachsystem ist deshalb mit einem System von Konzepten gleichzusetzen, wobei der zweisprachige Sprecher für jedes signifi é zwei signifiants besitzt. Dies legt jedoch den Trugschluß nahe, daß ein bilingualer Sprecher nur einem Typus von Zweisprachigkeit zugeordnet werden kann. Mischformen werden in diesem Modell ausgeklammert, obwohl sie in der Realität durchaus existieren können, denn manche Zeichen können im Gehirn des Bilingualen als compound existieren, während andere als zwei verschiedene Konzepte wahrgenommen werden.93
Das Modell des compound, bzw. coordinate bilingualism muß deshalb als Kontinuum betrachtet werden, wobei sich manche Sprecher mehr zur einen, andere wiederum eher zur anderen Seite entwickeln. Aufgrund der Tatsache, daß der semantische Inhalt eines Wortes mehrere Aspekte beinhaltet, können einige dieser Teilaspekte beider Wörter identisch sein (d.h. compound), während sich andere Teilaspekte nicht miteinander vereinbaren lassen (d. h. coordinate). Der Grad der konzeptuellen Überein- stimmung ist hierbei u. a. von den äußeren Umständen, unter denen die Wörter gelernt wurden, abhängig.94 Des weiteren spielt die Wortklasse eine wichtige Rolle. So weisen Wörter mit konkretem Inhalt eine höhere Übereinstimmung auf als solche mit abstraktem Inhalt. Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß erstere eher mit einer compound Speicherung in Verbindung zu bringen sind, während zweitere zur coordinate Speicherung tendieren.95
Taeschners Studien weisen darauf hin, daß das Kind in der ersten Phase des doppelten Erstspracherwerbs eher als coordinate bilingual zu sehen ist, da sich die Elemente der wenigen existierenden Äquivalenten- paare auf unterschiedliche Konzepte beziehen. Durch das verstärkte Auftreten von Äquivalenten in der zweiten Phase und die damit einher- gehende kognitive Entwicklung des Kindes findet eine Verschiebung hin zum compound bilingualism statt. Das Kind besitzt in dieser Phase die Fähigkeit, das gleiche Konzept, das hinter zwei verschiedenen Wörtern steht, zu erkennen.
Zum Zeitpunkt der ersten Phase ist das Kind in der Lage, zwei Sprachen zu verstehen, kann selbst aber nur eine Sprache produzieren, die sich aus Elementen der beiden präsentierten Sprachen zusammensetzt. Für das Kind bedeutet dies zugleich, daß es sich zunächst nicht bewußt ist, daß die Eltern oder die jeweiligen Kommunikationspartner es in zwei verschiedenen Sprachen ansprechen. Somit repräsentiert das Sprachmaterial im mentalen Lexikon ein einziges System. Volterra nimmt an, „ that the child could not at first be aware of the dual origin of the linguistic input provided by his or her particular social context and [that he] could thus be expected to begin with an undifferentiated lexicon, with words deriving from either language but not yet identified as such by the child. “ 96
Dies legt die Vermutung nahe, daß in dieser Phase des doppelten Erstspracherwerbs ein code-switching, bzw. code-mixing unumgänglich ist. Aufgrund des Fehlens von Äquivalenten können sprachliche Situationen entstehen, die in L1 beginnen und an einem Punkt zum Stoppen kommen, an dem ein bestimmtes Wort in L1 noch nicht vorhanden ist, wohl aber das entsprechende in L2. Das Kind springt in seinen sprachlichen Äußerungen zwischen den beiden Sprachen hin und her, ohne sich dessen bewußt zu sein. Das Mischen von Sprachen tritt gehäuft in der frühen Phase des Spracherwerbs auf, woraus man schließen kann, daß das Kind die lexikalischen Elemente unabhängig von der Sprache des Gesprächspartners oder der jeweiligen Situation wählt. Dieses Phänomen läßt sich einerseits damit erklären, daß dem Kind die nötigen sprachlichen Möglichkeiten fehlen, eine Äußerung ausschließlich in einer Sprache zu formulieren. Andererseits kann es aber auch ein Indiz dafür sein, daß das Kind nicht zwischen seinen beiden Sprachsystemen unterscheiden kann und es als ein einziges System betrachtet.97
Lanza geht in ihren Studien der Frage nach, ob bilinguale Kleinkinder zum code-switching fähig sind. Sie zieht hierbei eine klare Trennlinie zwischen den Begriffen des code-switching und des language mixing. Demnach ist language mixing als jegliche Art der Interaktion zwischen beiden Sprachen zu sehen, was im kindlichen Alter auch von der Problematik be- herrscht wird, ob sich das mentale Lexikon in einem oder in zwei Systemen manifestiert. Die Forscher, die die „Ein-System-Hypothese“ unterstützen, sehen das language mixing als Resultat der Tatsache, daß das Kind noch nicht imstande ist, zwischen beiden Sprachen zu trennen. Language mixing impliziert somit ein gewisses unbewußtes Handeln und ein Unvermögen, beide Sprachen auseinanderzuhalten, während der Begriff des code- switching mehr für das bewußte Wechseln von einer Sprache in die andere benutzt wird. Des weiteren ist das code-switching dadurch gekennzeichnet, daß es mehr oder weniger bestimmten Regeln folgt, d. h. es tritt nur an bestimmten Stellen im Satz auf, ohne dessen Syntax unlogisch und inkorrekt werden zu lassen.98
Als weiteren Faktor sieht Lanza die sprachliche Umgebung, in der das Kind beide Sprachen erlernt. Es kann davon ausgegangen werden, daß ein Kind, das in einer Umgebung aufwächst, die von einem ständigen language mixing gekennzeichnet ist, Probleme haben wird, zwischen beiden Sprachen zu unterscheiden. Seine Sprache wird in den Anfängen auch von einem dauernden Hin- und Herspringen zwischen L1 und L2 determiniert sein. Hier ist demnach das heterogene Input die Ursache für ein Vermischen beider Sprachen. Demgegenüber steht das Kind, welches beide Sprachen strikt voneinander getrennt beigebracht bekommt. In diesem Fall wird die Häufigkeit der Sprachvermischungen deutlich geringer sein.99
Eine phonologische Besonderheit der ersten Phase ist das Auftreten von sogenannten blends, was bedeutet, daß das Kind die Lautketten von zwei Wörtern mit derselben Bedeutung aus beiden Sprachen zu einem einzigen Wort vermischt. Dadurch entstehen Wörter wie beispielsweise ‚shot‘ (Vermischung aus frz. chaud und engl. hot) oder ‚assit‘ (frz. assis und engl. sit). Außer rein phonologischen Vermischungen von Wörtern aus zwei Sprachen treten auch Verbindungen ganzer Wörter mit derselben Bedeutung wie beispielsweise ‚ tack - thank you ‘. Des weiteren unterscheidet das Kind noch nicht zwischen den Lautsystemen der beiden Sprachen und hat somit in beiden einen ähnlichen Akzent, der sich erst im weiteren Verlauf der Sprachaneignung weiter ausdifferenziert.100
Das Phänomen der blends stellt die Hypothese der Nichtexistenz von bereits kognitivierten Äquivalenten während der ersten Phase in Frage. Wäre das Kind nicht in der Lage, in beiden Wörtern denselben Inhalt zu erkennen, so könnte ein blend gar nicht entstehen. Bei der Produktion einer Äußerung und der damit verbundenen „Suche“ im mentalen Lexikon stößt das Kind auf zwei Wortformen, die beide dasselbe bezeichnen und somit gleichzeitig in einer vermischten Form auftreten. Es sei jedoch dahingestellt, ob das Kind sich seiner zwei Sprachsysteme in dieser Phase schon bewußt ist, denn das Aneinanderhängen zweier Wörter aus beiden Sprachen mit der gleichen Bedeutung zeigt zwar einerseits, daß beide Wörter für das Kind dasselbe bedeuten, dieses aber andererseits die Sprachen nicht der Situation angepaßt verwenden kann. Die stete gemeinsame Verwendung zweier Wörter weist darauf hin, daß das Kind hier eventuell beide als eine lexikalische Einheit wahrnimmt und diese erst mit der strikten Trennung der Sprachsysteme in zwei eigenständige Lexeme aufspaltet. Eine bewußte Trennung kann in der ersten Phase noch nicht beobachtet werden.
4.2.1.2 Phase 2: Die Bildung von Ä equivalenten
Taeschner beschreibt eine zweite Phase des bilingualen Erstsprach- erwerbs, die dann beginnt, wenn in der Sprache des Kindes erstmals gehäuft Äquivalente zu bereits gelernten Wörtern auftauchen.101 Diese Äquivalente werden entweder in verschiedenen Situationen gelernt, oder gleichzeitig mit dem Wort, das ein neues Objekt oder einen neuen Zusammenhang beschreibt. Werden sie unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen ge- lernt, kann es zunächst in manchen Fällen sein, daß sie vom Kind nicht als solche erkannt werden. Dies ist der Fall in der ersten Phase, in der man demnach nicht von richtigen Äquivalenten sprechen kann, da es sich für das Kind um zwei Wörter mit unterschiedlichen Bedeutungen handelt.102 Hier schließt sich die Frage an, wann ein Äquivalent vom Kind als ein solches erkannt wird. Wie bereits im Beispiel mit dem Spiegel beschrieben, ist jedes neue Wort für das Kind ein Bündel von verschiedenen Merkmalen. Eines dieser Merkmale, nämlich der Prototyp, steht über allen anderen. Das ist im Spiegel-Beispiel die Tatsache, daß es sich um einen das Bild des Betrachters reflektierenden Gegenstand handelt. Erst wenn das Kind in der Lage ist, den Prototyp aus den Merkmalbündeln der Wörter aus L1 und L2 zu extrahieren und auf einer abstrahierenden Ebene als gleich zu erkennen, kann man von einem äquivalenten Wortpaar sprechen.103
Nun ist bereits in Phase eins die Rede von Äquivalenten, die noch nicht als solche erkannt werden. Dem Kind mag zwar bewußt sein, daß beide Gegenstände oder Sachverhalte auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, es ist ihm jedoch aufgrund des kognitiven Entwicklungsstandes noch nicht möglich, die anderen Merkmale des Wortes so weit zu verdrängen, daß ein Wiedererkennen des Prototyps beider Wörter möglich ist. Grund dafür ist, daß beide Wörter mit unterschiedlichen pragmatisch-semantischen Feldern in Verbindung gebracht werden. Bezogen auf das Spiegel-Beispiel bedeutet dies, daß das Kind sowohl das italienische als auch das deutsche Wort mit einem reflektierenden Gegenstand in Verbindung bringt, wobei in der ersten Phase das Merkmal „reflektierend“ jedoch nur eines unter vielen ist, dem noch keine dominierende Stellung beigemessen wird.104
Das Kind ist in Phase zwei in der Lage zu erkennen, daß ein Wort nicht untrennbar mit nur einem einzigen Gegenstand oder Sachverhalt verbunden ist. Das Konzept hinter dem Wort wird klar und dem Kind wird bewußt, daß dieses Konzept mehrere phonologische Ausdrücke haben kann, nämlich die der beiden Wörter in L1 und L2. Die Folge dieser Entwicklung ist, daß aus dem ursprünglich einheitlichen Lexikon zwei getrennte Systeme werden.105 Um Konfusionen zwischen beiden Sprachen zunächst zu vermeiden, hilft sich das Kind damit, daß es die Verwendung der Sprachen an bestimmten Personen festmacht.106 Es besteht in dieser Phase darauf, eine Sprache nur mit einer Person zu sprechen. Benutzt ein Sprecher nach Meinung des Kindes die „falsche“ Sprache, so wird er darauf hingewiesen.107
Die Tatsache, daß das Kind am Ende der zweiten Phase in der Lage ist, zwischen den beiden Sprachen zu unterscheiden, kann auch an der Fähigkeit zum metasprachlichen Denken und zur bewußten Übersetzung von einer Sprache in die andere festgemacht werden.108 Levy beschreibt in seiner Studie ein bilinguales zweijähriges Kind, das in der Lage ist, ein Wort von einer in die andere Sprache zu übersetzen. Dies setzt voraus, daß es erstens seine Sprachen unabhängig vom Gesprächspartner benutzen kann und zweitens beide Wörter als gegenseitig austauschbar und völlig äquivalent ansieht.109
Der Beginn der zweiten Phase läßt sich nicht an einem Alter fest- machen, da jedes Kind andere kognitive Fähigkeiten besitzt und somit der Zeitpunkt des vermehrten Auftretens von Äquivalenten individuell variiert. Er hängt unter anderem davon ab, wann das Kind zu sprechen anfängt. Taeschner geht davon aus, daß die erste Phase ca. 6 Monate dauert, was sie an ihren Beobachtungen an den beiden bilingualen Mädchen festmacht. Des weiteren ist das Auftauchen von Äquivalenten noch abhängig von der Wortart, da beispielsweise Artikel, Konjunktionen und Präpositionen in der ersten Phase nur spärlich - wenn überhaupt - vom Kind benutzt werden.110
Die Anzahl der Äquivalente steigt in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie die Anzahl der neu erlernten Wörter. Trotzdem lernt das Kind mehr neue Wörter als Äquivalente. So kann man zum Aufbau des Lexikons sagen, daß das Kind in den meisten Fällen zuerst ein neues Wort in einer der beiden Sprachen lernt. Erst wenn dieses Wort in seiner Bedeutung beherrscht wird, wird das entsprechende Wort in der jeweils anderen Sprache hinzugelernt. Somit bleibt die Anzahl der Äquivalente immer unter der Anzahl der Wörter, die gelernt werden, um neue Dinge oder Sachverhalte zu bezeichnen. Die Äquivalente machen so insgesamt ca. ein Drittel des gesamten Wortschatzes aus, die übrigen zwei Drittel verteilen sich auf Wörter, die nur in einer der beiden Sprachen existieren.111
4.2.1.3 Der Umfang des Lexikons
Abschließend zu Taeschners Überlegungen steht die Frage, ob und inwiefern sich der Umfang des Lexikons eines bilingualen Kindes von dem eines monolingualen unterscheidet. Wie bereits erwähnt, besitzt ein nor- males monolinguales Kind nach Abschluß des zweiten Lebensjahres einen Wortschatz, der ca. 50 Wörter umfaßt. Das gleiche Ergebnis erzielten die Kinder aus Taeschners Studien. Im weiteren Verlauf, d. h. mit Einsetzen des Wortschatzspurtes, nimmt sowohl das Lexikon des monolingualen als auch das des bilingualen Kindes rapide an Umfang zu. Man mag nun denken, daß monolinguale Kinder ihren bilingualen Altersgenossen bald weit voraus sind, da man davon ausgeht, daß die zweisprachigen Kinder alle Wörter doppelt lernen müssen. Richtig ist, daß ein zweisprachiges Kind sein kognitives Potential beim Lernen neuer Wörter auf zwei Sprachen aufteilen muß, während das monolinguale Kind sich hundertprozentig auf eine Sprache konzentrieren kann. Betrachtet man aber die Versuchsergebnisse, so läßt sich ein ähnlich rapider Anstieg der Wortanzahl feststellen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das bilinguale Kind das Lernen gänzlich neuer Wörter dem Bilden von Äquivalenten vorzieht. Es hat sich somit eine Strategie entwickelt, um dem Drang zum Lernen neuer Wörter standhalten zu können.112
Hier läßt sich der Schluß ziehen, daß das bilinguale Lexikon im Kleinkindalter noch nicht doppelt so umfangreich sein kann, wie das monolinguale, da die Anzahl der Äquivalente erst langsam der Anzahl der neu erlernten Wörter folgen muß. Vergleicht man den Umfang des monolingualen Lexikons von Kleinkindern mit dem der dominierenden Sprache von zweisprachigen Kindern, so stellt man einen leichten Vorsprung des monolingualen Lexikons fest, wobei die Sprachbeherrschung auf Seiten der zweisprachigen Kinder besser ist. Das Existieren von Äquivalenten verschafft den bilingualen Kindern jedoch einen Vorsprung im Umfang des Gesamtwortschatzes.113 Zudem werden bilingualen Kindern rezeptive Fähigkeiten in beiden Sprachen zugesprochen, die denen von monolingualen Kindern in nichts nachstehen.114
Der unterschiedliche Umfang des Wortschatzes von monolingualen und bilingualen Kindern ist nach Abschluß der Pubertät, einem Zeitpunkt zu dem sich jeder Mensch ein festes Repertoire an Wörtern geschaffen hat, absolut vergleichbar. Eventuelle Variationen können dann nur noch mit der von Mensch zu Mensch - d. h. sowohl von einsprachigem zu einsprachigem als auch von zweisprachigem zu zweisprachigem Menschen - unterschied- lichen Sprachbeherrschung und dem von Mensch zu Mensch variierenden Wortschatzumfang erklärt werden.115
4.2.1.4 Kritik an Taeschners Ansatz
Taeschners Ansatz zur Frage, ob sich zwei Sprachen im Gehirn in einem einzigen oder in zwei Systemen organisieren, wird in der Forschung oft zitiert. Manche akzeptieren die Ergebnisse, andere sehen sie mehr unter einem kritischen Licht. Es folgten bis heute weitere Studien und Über- legungen, die Taeschners Frage umdrehen und herauszufinden wollten, inwieweit ein bilinguales Kind zwischen seinen beiden Sprachen unter- scheiden kann.
Ein häufig geäußerter Kritikpunkt an Taeschners Studie ist, daß sie schon rein aufgrund des Umfangs der gesammelten Daten als nicht reprä- sentativ gesehen werden kann.116 Die Beobachtungen an zwei bilingualen Kindern lassen keine verallgemeinernden Aussagen über die Art und Weise des bilingualen Erstspracherwerbs zu. Sie sind vielmehr als Vermutungen zu betrachten, die durch fortführende Studien entweder bestärkt oder abge- schwächt werden können.
Das Fehlen von ausreichendem Material und die teilweise falsche Interpretation wird von de Houwer bemängelt. Sie beginnt mit ihrer Kritik an der Hypothese einer ersten Phase, die dadurch gekennzeichnet ist, daß keine Äquivalente vorhanden sind. In einer zweiten Auswertung von Taeschners Daten stellte sich heraus, daß in dieser ersten Phase doch eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Äquivalenten im Wortschatz von Lisa und Giulia vorhanden war.117 Auch weitere Untersuchungen konnten das Nichtvorhandensein von Äquivalenten nicht bestätigen. Mikes beobachtete in ihren Forschungen an drei dreisprachigen Kindern ein häufiges Auftreten von Äquivalenten in der ersten Phase, wobei die Anzahl über der bei den von Taeschner beobachteten Kindern liegt. Sie führt dies auf eventuelle Unter- schiede im soziolinguistischen Umfeld der Kinder zurück, woraus eine Lücke im Input resultieren kann.118 Wenn dem Kind ein entsprechendes Äquivalent von seinen Gesprächspartnern nicht dargereicht wird, kann es dieses Wort auch nicht erlernen. Es lassen sich außerdem daraus keine Folgerungen ziehen, die erklären, ob das Kind seine Sprache als ein oder als zwei Systeme wahrnimmt.119
Was wird unter dem Begriff des Äquivalents überhaupt verstanden? Ist es ein für den außenstehenden Erwachsenen feststellbares Wortpaar mit derselben Bedeutung oder sollte man n diesem Zusammenhang eher den Schwerpunkt darauf legen, daß dieses Wortpaar auch vom Kind selbst als Übersetzungsaquivalent gedeutet werden muß? Die Kritik an Taeschner berücksichtigt hier nicht das Problem der unterschiedlichen konzeptuellen Wahrnehmung des Kindes. Das Vorhandensein eines Äquivalentes heißt noch lange nicht, daß beide Wörter für das Kind wirklich zu einhundert Prozent dasselbe bedeuten, worauf Taeschner auch ausdrücklich hinweist.
Weitere Kritikpunkte werden an einer unlogischen Argumentationsweise festgemacht.120 Diese beziehen sich jedoch nicht direkt auf den Erwerb des Lexikons und werden deshalb hier ausgeklammert.
4.2.2 Die mentale Organisation zweier Sprachen
Trotz der Tatsache, daß Taeschners zwei-Phasen-Modell in Teilen kritisiert wird, muß festgehalten werden, daß zahlreiche Studien ein starkes Vermischen beider Sprachen bei Kleinkindern unter zwei Jahren feststellen, was als Beweis für die Hypothese gewertet wird, daß beide Sprachen zunächst in einem einzigen System gespeichert werden. Das Vermischen beider Sprache auf phonologischer, lexikalischer, morphologischer, syntak- tischer, semantischer und pragmatischer Ebene nimmt mit wachsendem Alter der Kinder in allen Studien ab. Dies legt den Schluß nahe, daß dem Kind eine Differenzierung der Sprachen erst mit zunehmendem Alter möglich ist. Auf der anderen Seite darf daraus jedoch nicht geschlossen werden, daß das Kind sein gesamtes sprachliches Material zunächst in einem System speichert, um dieses ab ca. seinem zweiten Lebensjahr in zwei autonome Systeme zu trennen.121
Aitchison entwickelt für den Aufbau des mentalen Lexikons bei monolingualen Kindern zwei bildliche Hypothesen.122 Nach der ersten befin- den sich im Gehirn nach der Geburt viele verschiedene kleine „Regale“, die durch ständigen Input langsam gefüllt werden. Jedem „Regal“ ist dabei ein semantisches Feld, eine Funktion oder eine Struktur zugeordnet, weswegen jedes neu gelernte Wort schon seinen fest zugeschrieben Platz im Kopf hat. Bezogen auf den bilingualen Spracherwerb bedeutet dies, daß das Kind über die doppelte Ausführung jedes einzelnen „Regals“ verfügt und beide Sprachen schon in zwei „Regalsysteme“, d. h. zwei separate Sprachsysteme ordnet. Dies setzt eine relativ differenzierte Sprachwahrnehmung schon von Anfang an voraus, denn wenn ein Wort einer Sprache nicht richtig zugeordnet werden kann, ist es auch nicht möglich, es in das entsprechend korrekte „Regal“ einzuordnen. Es kann hier allerdings die Frage aufgeworfen werden, ob das Kind den ersten Eindruck eines Wortes im Prozeß des fast mapping in einer Art Zwischenspeicher ablegt und es erst bei wiederholter Präsentation und der damit einhergehenden Verdeutlichung des Wortinhalts und seiner weiteren Eigenschaften der einen oder anderen Sprache exakt zuordnet. Bei der Kommunikation würde das zweisprachige Kind auf Elemente aus seinen Regalen zurückgreifen und bei eventuellen Leerstellen in einer Sprache auf das entsprechende Element der anderen Sprache ausweichen.
Die Hypothese der zwei bereits existierenden Regalsysteme setzt voraus, daß das Kind von Anfang an ein zweisprachiges Input erwartet. Da es allerdings in eine unvorhersehbare Umgebung hineingeboren wird, macht es keinen Sinn, von einer bereits festgelegten Gehirnstruktur auszugehen.
Das Bild der zweiten Hypothese ist so zu sehen, daß anfangs nur ein „Regal“ vorhanden ist, das nach und nach mit dem gesamten Input un- differenziert gefüllt wird, was früher oder später dazu führt, daß ein großes Durcheinander entsteht. Es ist nicht mehr möglich, zwischen einzelnen Elementen eine Verbindung herzustellen, oder sie gar überhaupt wiederzu- finden. Daraus wächst letztlich die Notwendigkeit, das gesamte Material neu zu ordnen. Wieder auf den bilingualen Spracherwerb angewandt, entspricht dieses Modell der Hypothese Taeschners, d. h. das gesamte Sprachmaterial beider Sprachen wird zunächst in einem „Regal“ verstaut, um erst später in unterscheidbare, nach Sprachen geordnete „Regale“ sortiert zu werden. Das Resultat wäre dasselbe wie im ersten Fall, denn auch hier sind dann in einer ersten Phase die sprachlichen Äußerungen durch Vermischungen charakteri- siert, was darauf zurückzuführen ist, daß der Wortschatz in beiden Sprachen anfangs noch sehr lückenhaft ist und diese Lücken sich erst im Laufe der Zeit schließen.
Die Geschwindigkeit, in der die Wortschatzlücken gefüllt werden, hängt stark mit der Qualität des Inputs zusammen, denn dreht sich dieser immer nur um einen beschränkten Themenkreis, führt dies beim Kind zwar einerseits zu einer Festigung des bereits vorhandenen Lexikons, anderer- seits bleiben aber viele Lücken in den „Regalen“ weiterhin leer. Das unaus- gewogene Lernen von Wörtern beider Sprachen und das damit einher- gehende Herausbilden einer starken und einer schwachen Sprache zieht unweigerlich nach sich, daß der Sprecher einem code-switching nicht aus dem Wege gehen kann.
Wie das mentale Lexikon nun letztenendes wirklich aufgebaut ist, läßt sich wahrscheinlich nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Taeschners Ansatz erscheint zwar einerseits plausibel, andererseits stellt aber die Existenz oder Nichtexistenz von Äquivalenten keinen ausreichenden Beweis für den Aufbau des Lexikons dar. Diese Äquivalente können entweder in einem oder in zwei „Regalen“ - um bei der Metapher zu bleiben - gespei- chert werden. Wie bereits gesagt, treten Äquivalente schon in der frühen Kindheitsphase auf. Der wichtige Unterschied ist hier, daß die Äquivalente vom Kind anfangs als zwei völlig verschiedene Wörter, d. h. Wörter mit unterschiedlicher Form und - noch wichtiger - mit unterschiedlichem Inhalt, aufgefaßt werden und erst später die bewußte Zuordnung zu zwei verschiedenen Sprachen stattfindet. Frühestens wenn diese bewußte Trennung in zwei „Regalsysteme“ beendet ist und das Kind sich somit der Tatsache bewußt geworden ist, daß es zwei Sprachen sprechen kann, ist es in der Lage zu sehen, daß beide Wörter des Äquivalentenpaares überhaupt denselben Sachverhalt beschreiben können.
Diese Kognitivierung hängt weiterhin mit einem Phänomen der allgemeinen Sprachentwicklung zusammen: Ein monolinguales Kind lernt in seiner ersten Sprechphase, d. h. vor dem Wortschatzspurt, noch keine Synonyme. Ein Paar von Äquivalenten stellt für das bilinguale Kind in Wirk- lichkeit nichts anderes dar als quasi-synonyme Wörter, die zufällig aus zwei Sprachen kommen. Dies bedeutet, daß das Kind ein neues Wort nach dem Prinzip des Kontrastes als neue, bisher im Lexikon noch nicht vorhandene Sinneinheit betrachtet. Für die Zweisprachigkeit des Kindes bedeutet dies, daß der Teil eines äquivalenten Wortpaares, der zuerst gelernt wird, auch ausschließlich mit einer bestimmten Bedeutung aufgeladen wird, die das im Prinzip identische Übersetzungsäquivalent der anderen Sprache nicht mehr haben kann. Dies zieht den Schluß nach sich, daß das Kind beide Wörter unweigerlich als Wörter mit verschiedenem Inhalt sehen muß, auch wenn sie in Realität dasselbe bezeichnen.123 Aus diesem Grund sollten Studien, die das Auftauchen von Übersetzungsäquivalenten bei zweisprachigen Klein- kindern, d. h. bei Kindern vor dem Wortschatzspurt, untersuchen, kritisch gesehen werden. Die Existenz solcher Wortpaare wird hier zwar nachgewiesen, es bleibt jedoch letztlich offen, ob diese auch bewußt im Kopf des Kindes als solche existieren. Es ist damit nicht als Gegenbeweis dafür zu sehen, daß in diesem Alter Synonyme vermieden werden. Hier sei nochmals auf Taeschners „Spiegelbeispiel“ verwiesen: Das Kind produzierte zwar einerseits das Wort sowohl auf deutsch als auch auf italienisch, andererseits waren die hinter den Wörtern stehenden Konzepte verschieden.
Die erste Phase des bilingualen Spracherwerbs, d. h. die Zeit ab dem Moment da das Kind Mehr-Wort-Äußerungen produziert, ist noch viel stärker als die darauffolgenden durch gemischtsprachliche Äußerungen gekenn- zeichnet. Hieraus darf allerdings nicht der Schluß gezogen werden, daß alle Wörter oder Satzstrukturen aus einem großen undifferenzierten „Regal“ genommen werden. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß das Leihen eines Wortes aus der anderen Sprache als Zeichen für eine Wortschatzlücke in der Sprache, mit der die Äußerung begonnen wurde, zu bewerten ist. Vihman macht diese Beobachtung bei ihrem zweisprachig englisch und estnisch aufwachsenden Kind Raivo. Sie beschreibt, daß dessen gemischtsprachliche Äußerungen ab dem Zeitpunkt mengenmäßig abnehmen, da seine beiden Lexikonsysteme komplett sind.124 Das bedeutet, daß beide Sprachen gleich weit ausgeprägt sind. Vihman unterstützt jedoch trotz mancher Vorbehalte nach wie vor Taeschners Hypothese eines anfänglich einzigen Sprachsystems, welches sich später in zwei eigenständige Systeme differenziert.125
Mit dem Wortschatzspurt, d. h. etwa ab dem zweiten Lebensjahr, setzt ein komplexer Vorgang im kindlichen Gehirn ein, der die kognitive Entwick- lung stark beschleunigt und sich gleichzeitig auf die sprachlichen Fähigkeiten auswirkt. Dieser Vorgang der verstärkten Vernetzung im Gehirn erlaubt es dem Kind, seine bisher erworbenen sprachlichen Formen und Elemente neu zu analysieren und eventuell neu zu strukturieren. Bezogen auf die mentale Repräsentation bedeutet dies, daß sich das Kind seiner Zweisprachigkeit bewußt wird und nun auch beide Sprachen in getrennten Systemen gespeichert sind, oder daß das Kind zumindest fähig ist, ungemischte Äußerungen zu produzieren.
Gegen alle stark vorherrschenden Meinungen, meldet Genesee Zweifel an der Hypothese eines anfänglich einzigen Sprachsystems und der damit verbundenen Unfähigkeit zur Sprachdifferenzierung an.126 Seine Argu- mentation fußt auf den Beobachtungen von Sprachmischungen, die für ihn selbst noch kein Beweis für eine undifferenzierte Sprachwahrnehmung sind, da auch bilinguale Erwachsene Mischungen innerhalb einer Äußerung produzieren. Diese sind einerseits geprägt von Situation und Gesprächs- partner, andererseits werden sie aus funktionalen Zwecken benutzt. Die gleiche Motivation wird bei Kindern festgestellt, die nach Taeschners Modell bereits in Phase zwei sind.
Erklärungen für Mischungen vor dieser Phase werden von Genesee allerdings angezweifelt, da nach seiner Ansicht eine zweckgebundene Verwendung schon vorher möglich ist, was bedeutet, daß zwischen den Sprachen schon unterschieden werden könnte. Er mag hier jedoch nicht berücksichtigen, daß Wörter immer in einem bestimmten Kontext und in Verbindungen mit bestimmten Personen gelernt werden. Das Kind wird demnach eben in diesen Situationen oder mit den entsprechenden Personen jeweils eine bestimmte Sprache wählen. Ein Mischen, das aufgrund von Lücken im Lexikon entsteht, kann nach Genesee nicht als Beweis dafür gesehen werden, daß lediglich ein einziges Sprachsystem existiert. Das mixing ist eine Folge des Bedürfnisses des Kindes, sich auch in Situationen, in der die nicht dominierende Sprache gesprochen wird, verständlich machen zu können. Im umgekehrten Fall, d. h. bei der Existenz eines Wortes in beiden Sprachen, kann sich das Kind im Einzelfall für die Verwendung des im Kontext falschen Wortes entscheiden, da dieses vielleicht eine leichtere Form aufweist. Genesee bleibt den Beweis dafür schuldig, daß Kinder in diesem Alter wirklich schon zwischen den Sprachen unterscheiden können.
Das Auftreten von Sprachvermischungen vor Vollendung des zweiten Lebensjahres kann demnach keinen Aufschluß über die mentale Repräsen- tation der beiden Sprachen geben. Genesees Argumentation kann aus diesem Grund als Bestärkung der bereits formulierten Behauptung verstan- den werden, daß weder die Ein-System-Hypothese noch die Zwei-System- Hypothese zu einhundert Prozent nachgewiesen werden kann und die Forschung auf diesem Gebiet beim Aufstellen von Hypothesen stehen bleiben muß.
4.2.3 Das Erlernen neuer Wörter
In diesem Zusammenhang schließt sich die interessante Frage an, ob und inwieweit das Kind bei neuen Wörtern zwischen den Sprachen unterscheiden kann. Wie trifft das Kind eine Entscheidung über die Sprachzugehörigkeit eines neuen Wortes? Grundlegende Voraussetzung für folgende Ausführungen ist die Annahme, daß das sprachliche Material in zwei getrennten Systemen organisiert ist.
Bei der Zuordnung zu einer der beiden Sprachen muß man zwischen zwei verschiedenen Phänomenen unterscheiden. Einerseits werden äquivalente Wörter gelernt, die in beiden Sprachen eine völlig andere phonologische Realisation aufweisen und andererseits existieren - wenn auch nur wenige - homonyme Formen. Man sollte davon ausgehen, daß gerade diese zweite Gruppe ein besonderes Problem darstellt. Ich möchte mit der Beschreibung dieser Gruppe beginnen und hier wieder zunächst vom monolingualen Spracherwerb ausgehen.
Es sei zu Beginn angemerkt, daß jede Sprache durch ein äußerst polysemes Vokabular ausgemacht wird. Sowohl Nomen, als auch Verben oder Adjektive zeichnen sich dadurch aus, daß sich ihre Bedeutung oft nicht nur auf einen einzigen Sachverhalt bezieht, wobei die Mehrdeutigkeit allerdings stets nur einen Bildbereich abdeckt.127 Schwerer wird es bei Wörtern, die sich in ihrer phonologischen Form gleichen, die aber Dinge bezeichnen, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Für die englische Sprache können folgende Beispiele genannt werden: meet - meat, knight - night oder pair - pear. Studien an monolingualen Kindern haben ergeben, daß gegen jegliche Erwartungen weder die Homonymie von zwei Nomen, noch die von Nomen und Verb ein großes Problem beim Spracherwerb darstellen. Sie werden vom Kind nicht vermieden und es wird davon ausgegangen, daß die Bedeutung der Homonyme recht schnell verstanden wird.128
Das Phänomen, daß sich zwei Wörter in ihrer Schreibung oder ihrer phonologischen Realisierung gleichen oder ähneln ist zwar häufiger innerhalb eines Sprachsystems anzutreffen, es gibt sie aber auch zu einem geringeren Maße sprachübergreifend. Als Beispiele seien hier die Wortpaare129 (1) engl. house / dt. Haus, (2) engl. finger / dt. Finger. Was hilft dem Kind, die Wörter der richtigen Sprache zuzuordnen?
Die Elemente des ersten Wortpaares sind in den grundsätzlichen Merkmalen ihrer Artikulation identisch, was zur Folge hat, daß bei einem ersten Hören für das Kind kein Unterschied zwischen den Sprachen feststellbar ist und eine richtige Zuordnung nicht gleich möglich zu sein scheint. Wortpaar (2) unterscheidet sich lediglich in der Opposition /§g/ - /§/, wobei eine schnelle, undeutliche Aussprache zu einem ähnlichen Klang führen kann. Da ein Wort nicht losgelöst von einem Kontext gelernt wird und schon durch die sprachliche Äußerung der Eltern oder jeweiligen erwachsenen Sprechers ein Hinweis auf die benutzte Sprache gegeben wird, wird es dem Kind einfacher gemacht, für sich selbst eine Zuordnung vorzunehmen. Das neue Wort wird im Satz des Erwachsenen umgeben von anderen Wörtern, die dem Kind unter Umständen schon bekannt sind, wodurch es einen Schluß auf die Sprache des neuen Elements ziehen kann. Im Zusammenhang mit dem Phänomen des fast mapping wurde bereits darauf hingewiesen, das die Bedeutung ein neues Wortes - zu der auch die Sprachzugehörigkeit zählt - zunächst nur in groben Zügen aufgenommen und im Kopf gespeichert wird. Dies bedeutet, daß bei einer ersten Präsentation des Wortes noch nicht unbedingt eine hundertprozentige Zuordnung zu L1 oder L2 stattfinden muß. Im Laufe der Zeit und durch häufigere Präsentationen des Wortes wird dessen Bedeutung klarer und damit die Zuordnung leichter. Somit ist es auch zu erklären, wie Kinder, die in einem durch Sprachmischung charakterisierten Umfeld aufwachsen, letztlich die Wörter einer Sprache zuordnen können. Es mag zwar etwas länger dauern als bei Kindern, die in einer „ one person - one language “ - Umwelt ihre Sprachen erlernen, trotzdem wird das Kategorisieren auch hier durch häufige Präsentation und der damit einhergehenden Verdeutlichung des Inhalts möglich sein.
Das beschriebene Phänomen soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Sprachzuordnung von Homophonen130
Das neue Wort < house> wird in einer rein englischen Äußerung präsentiert und es ist davon auszugehen, daß sowohl vorangegangene als auch nachfolgende sprachliche Äußerungen in der gleichen Sprache erfolgten, bzw. erfolgen werden. Das Kind muß deshalb davon ausgehen, daß < house > in das englische Lexikon einzuschreiben ist. Etwas anders verhält es sich beim deutschen Äquivalent <Haus>, das hier in der ge- mischtsprachlichen Äußerung „Look, Lisa. What’s this? Das ist ein Haus!...) präsentiert wird. Eine eindeutige Zuordnung ist demnach nicht sofort möglich. Das Kind mag hier vielleicht eine vorläufige Zuordnung vornehmen, wobei noch eine oder mehrere weitere Präsentationen (wie im Beispiel „Hast du mit deinen Legosteinen ein Haus gebaut?“) nötig sind, um die Sprachzuordnung eindeutig werden zu lassen.
Zum Erklärungsversuch der Sprachzuordnung durch die Auswertung der sprachlichen Umgebung eines Wortes bedarf es eines Kommentars dazu, wie das Kind diese Umgebung deutet und danach einer seiner beiden Sprachen zuordnet. Die Aneignung des mentalen Lexikons ist von einem nicht zu vernachlässigenden Problem überschattet, denn das Kind muß in der sprachlichen Äußerung eines Erwachsenen einzelne Teile erkennen können, um diesen dann Bedeutung zuordnen zu können.131 Dabei ist es nicht vorrangig wichtig, daß das Kind jedes einzelne Lexem versteht, denn das mentale Lexikon enthält nicht nur Lexeme, die dem geschriebenen Wort eins zu eins entsprechen. Es speichert ebenso ganze Phrasen, idiomatische Ausdrücke und Wortteile (beispielsweise Wortstämme oder Prä-, bzw. Suffixe). Die Folge dessen ist, daß einzelne Wörter mehrfach im Lexikon gespeichert sein können, d. h. einmal als eigenständiges Lexem und einmal als Bestandteil eines idiomatischen Ausdrucks oder einer Phrase. Das sprachliche Material, mit dem ein Kind in Kontakt kommt, ist gewöhnlicher- weise eine Menge von Mehr-Wort-Äußerungen und es ist eher die seltene Ausnahme, daß dem Kind einzelne Wörter „vorgeworfen“ werden. Da die gesprochene Sprache dadurch charakterisiert wird, daß sie syntaktisch simplifiziert, inkomplett ist oder im Zuge von Assimilationen und Aus- lassungen eine starke Vereinfachung auf phonologischer Ebene aufweist, wird es schwierig, einzelne Phrasen oder Wörter überhaupt wahrzunehmen und mit Bedeutung zu füllen. Gerade phonologische Vereinfachungen machen das Erkennen von Wortgrenzen nicht einfach.
Aus diesem Grunde sind weitere Hilfen notwendig, um den Satz in seine Einzelteile zu segmentieren. Oft diskutiert wird in diesem Zusammen- hang der Satzrhythmus, der nicht in allen Sprachsystemen der gleiche ist und somit für das bilinguale Kind von Wichtigkeit beim Erkennen der jeweils gesprochenen Sprache ist. Die in obigem Beispiel dargestellte Opposition zwischen dem Deutschen und dem Englischen mag hier nicht die nötige Klarheit aufweisen, da es sich hierbei um zwei germanische Sprachen mit Stammsilbenbetonung handelt. Auf phonologischer Ebene läßt sich allerdings feststellen, daß das Englische viel mehr die Wortgrenzen verwischt als das Deutsche, wo Wörter weniger gebunden werden und vokalische Wortanfänge klar durch einen Knacklaut markiert sind. Dieser Knacklaut erleichtert das Segmentieren in hohem Maße. Studien zur Segmentation im Englischen haben ergeben, daß sich der Sprecher in den meisten Fällen am Auftreten von betonten Silben orientieren kann, da diese in ca. ¾ der Fälle den Beginn eines neuen Wortes anzeigen. Außer dem Rhythmus, der hauptsächlich beim Finden von Wortgrenzen hilft, kann weiterhin die sprachspezifische Satzmelodie bei der Identifikation der Sprache helfen.
Das Wortpaar reality / realidad, fällt nicht mehr in die Kategorie der Homophonie, wenngleich die äußere Gestalt beider Wörter ähnlich ist. Die phonologische Realisation macht sie relativ leicht unterscheidbar, trotzdem muß auch hier eine Entscheidung über die Zugehörigkeit entweder zum Englischen oder zum Spanischen vorgenommen werden. Es kann hier ein anderer Mechanismus einsetzen, der jedoch voraussetzt, daß das Lexikon schon einen gewissen Umfang aufweist. Durch den Prozeß des boot- strapping kann sich das Kind über die grammatikalische Struktur eines Wortes Zugang zu dessen Bedeutung und gleichzeitig zur Sprachzuge- hörigkeit schaffen. Wenn sich das spanisch-englisch-bilinguale Kind bereits dessen bewußt wurde, daß beispielsweise das Suffix {-dad} mit spanischen Nomen untrennbar und ausschließlich verbunden ist, kann es daraus schließen, daß ein neues Wort mit eben diesem Suffix nur dem Spanischen zuzuordnen ist, da eine entsprechende Endung im Englischen nicht existiert. Dies bedeutet, daß einerseits durch Analogien und andererseits durch Abgrenzungen zu bereits Bekanntem auf die Sprachzugehörigkeit eines Wortes geschlossen wird. Hier soll der Mechanismus wieder an einem Schema erläutert werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Sprachzuordnung durch syntaktisches bootstrapping
Bei der Präsentation des neuen spanischen Wortes < realidad > wird ein Vergleich mit bereits vorhandenem Material im spanischen Lexikon vorgenommen, wobei festgestellt wird, daß dort bereits Wörter mit demselben Suffix {-dad} existieren (1). In einem zweiten Schritt wird aufgrund der Analogie das neue Wort ebenfalls im spanischen Lexikon verankert (2). Das englische Wort < reality > hingegen endet auf das Suffix {-ity}, das bei einem Vergleich mit dem spanischen Lexikon dort nicht gefunden werden kann (3). Es wird demnach durch Abgrenzung vom Spanischen mit dem englischen Lexikon verglichen, wo das Suffix existiert und das Wort somit dem Englischen zugeordnet werden kann (4).
Die mentale Repräsentation der Sprachen ist aufgrund der Tatsache, daß alle Vorstellungen zum selben Ergebnis - nämlich dem der im Endeffekt getrennten Sprachsysteme - führen, eher zweitrangig. Zudem können dazu nur Hypothesen aufgestellt werden, da eine eindeutige Klärung des Sachverhaltes nicht möglich ist. Die Auslegung und die Deutung von Hypothesen zu den zu diesem Zwecke gesammelten Daten kann von Studie zu Studie verschieden sein. Da die Überlegungen zum mentale Aufbau des bilingualen Lexikons aber eng damit verbunden ist, wie sich der zwei- sprachige Sprecher selbst wahrnimmt, kann umgekehrt der Schluß gezogen werden, daß es sich spätestens dann um zwei völlig getrennte Systeme handelt, wenn der Sprecher selbst sich seiner Zweisprachigkeit bewußt wird.
4.2.4 Das bilinguale Bewußt sein
Es stellt sich nun die Frage, wie sich ermitteln läßt, ob bilinguale Klein- kinder in der Lage sind, zwischen zwei Sprachsystemen zu trennen und inwieweit das Mischen beider Sprachen als Zeichen für eine undifferenzierte Sprachwahrnehmung zu deuten ist. Wann ist sich das Kind darüber klar, daß es über zwei Sprachsysteme verfügt? Es wurde bereits gesagt, daß das Mischen der Sprachen nicht als Indiz für ein Unvermögen der Sprach- differenzierung gesehen werden darf. Es kann aber im Umkehrschluß auch nicht als Beweis für die Existenz zweier - dem Kind bewußten - Sprach- systeme gewertet werden. Um das bilinguale Bewußtsein festzumachen, muß man sich demnach mit beobachtbaren eindeutigen Verhaltensweisen beschäftigen.
Es gibt Beweise dafür, daß eine der Situation oder dem Gesprächs- partner angebrachte Verwendung beider Sprachen schon im Alter von ca. drei Jahren möglich ist. Dies stimmt mit Taeschners Hypothese überein, die besagt, daß das Kind mit der Aneignung von Äquivalenten zwei getrennte Sprachsysteme ausbildet und somit auch in der Lage ist, diese voneinander zu trennen. Vor diesem Alter wird eine Sprache noch relativ fest mit einer Person verbunden, um die Sicherheit in der Verwendung der Sprache zu festigen. Danach ist das Kind in der Lage, bei der Kommunikation mit einer fremden Person die entsprechend richtige Sprache bewußt zu wählen.132
Das Kind besitzt die Fähigkeit, einen Satz in die andere Sprache zu übersetzen, um ihn für andere Menschen verständlich zu machen, was der Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen einem Vater und seiner Tochter zeigt:
Vater: Right, Kat, we ’ re going to eat. Have you washed your hands ?
Katja (zu ihren französischen Freunden): H é ! On va manger. Il faut se laver les mains! [„He! Wir essen. Wir müssen die Hände waschen!“]133
Da kaum davon auszugehen ist, daß eine Sprache in einem eins zu eins Verhältnis in eine andere übertragen werden kann, muß das Kind hier bewußt in ein anderes Sprachsystem mit seinen lexikalischen, syntaktischen und phonologischen Eigenheiten und Feinheiten umschalten. Es handelt sich hierbei um ein sog. natürliches Übersetzen, das sich vom professionellen Übersetzer dadurch unterscheidet, daß das Kind lediglich auf die ihm bereits bekannten Strukturen zurückgreifen kann.134 Im Beispiel wird deutlich, daß Katja deutlich zwischen englischen und französischen Strukturen unter- scheidet, was auf eine klare Trennung beider Sprachen im Kopf hinweist.
Eine exakte Bezeichnung der benutzten Sprache und die damit einhergehende Fähigkeit, den Denkprozeß auf ein abstraktes Niveau anzu- heben, ist dem Kind allerdings erst später, d. h. je nach Entwicklungsstand des Kindes ab dem vierten oder fünften Lebensjahr, möglich.135 Vor dieser richtigen Benennung der jeweiligen Sprache stehen Ausdrücke wie „ So wie ich jetzt spreche “ oder „ so wie Mama spricht “.136 Im Vergleich zu monolingu- alen Altersgenossen haben bilinguale Kinder, was ihr metasprachliches Denkvermögen angeht, einen enormen Vorsprung, was folgender Ge- sprächsausschnitt zwischen einem vierjährigen monolingualen Kind und seiner Mutter illustriert:
Kind: Mommy, why does Mario speak that way? Mutter: He ’ s speaking another language. Kind: I want to speak a language too.
Mutter: But you do speak a language. Everybody speaks a language.
Kind: No, I want to speak like Mario. 137
Das Kind kann in diesem Fall nicht nachvollziehen, daß andere Menschen auch andere Sprachen sprechen können. Dies mag auf den einfachen Grund zurückzuführen sein, daß das Kind sich in seinem normalen sozialen Umfeld nicht mit der Thematik der Mehrsprachigkeit auseinander- setzen muß und diese somit einen unbekannten Sachverhalt darstellt. Das zweisprachige Kind ist gewissermaßen gezwungen, sich mit seinen beiden Sprachen zu beschäftigen und sich die beiden Sprachsysteme bewußt zu machen. Des weiteren kann das monolinguale Kind im vorliegenden Beispiel mit dem abstrakten Wort ‚Sprache‘ nichts verbinden.
Das endgültige Bewußtsein der Zweisprachigkeit ist dann erreicht, wenn aus dem unmotivierten Mischen der Sprachen ein bewußtes, der Situation angepaßtes Wechseln wird. Es ist evident, daß ungewollte Inter- ferenzen zwischen beiden Sprachen ab und zu immer wieder auftauchen, sie sind jedoch einerseits eher die Ausnahme und andererseits werden sie vom Sprecher selbst in den meisten Fällen als „Fehler“ erkannt. Auch hier wieder ein Beispiel: Nachdem einer seiner Hasen aus dem Käfig ausgebrochen ist, kommt der französisch-deutsch-bilinguale dreijährige Jens aufgeregt zu seiner Mutter gerannt und sagt: „ Vite, vite le Hase est weg ! “ [„Schnell, schnell, der Hase ist weg !“]. Nach wenigen Sekunden verbessert er sich selbst in: „ Le lapin est parti! “. Es zeigt sich hier, daß die Mischung im ersten Satz nicht durch das Fehlen von Wörtern im Französischen zustande kam, sondern durch den Druck, schnell eine Information loswerden zu müssen. Jens ist sich aber sehr wohl dessen bewußt und produziert deshalb gleich danach die verbesserte Version des Satzes.138
4.2.5 Die Interaktion beider Sprachsysteme
Nachdem nun davon ausgegangen wird, daß L1 und L2 in zwei sepa- raten Systemen im Gehirn gespeichert sind, stellt sich die Frage, auf welche Weise beide Sprachen interagieren, denn der zweisprachige Sprecher muß schließlich in der Lage sein, beide Sprachen zu koordinieren, um mit seiner Umwelt sinnvoll in Kontakt zu treten. Die Systeme bestehen nicht als autonome Konstrukte im Gehirn, sondern stehen beide offensichtlich in einem Verhältnis zueinander, was u. a. beim Phänomen des code-switching deutlich wird.
Über den Aspekt der Konzepte läßt sich ein Zugang zu diesem Problem finden. Ist ein Konzept fest mit einem Wort verbunden, was bedeutet, daß der bilinguale Sprecher bei zwei getrennten Sprachsystemen auch über zwei getrennte Konzeptsysteme verfügen muß, oder existiert lediglich ein Konzept, das mit zwei Wörtern verbunden ist?
Das Augenmerk soll nun auf das bilinguale Kind gelenkt werden, das sich seiner Zweisprachigkeit bereits bewußt ist. Die mentale Organisation der Konzepte dürfte sich in dieser Phase nicht von der ersten unterscheiden, wenn davon ausgegangen wird, daß am Anfang des bilingualen Spracherwerbs das gesamte sprachliche Material mit den entsprechenden Konzepten in einem einzigen System gespeichert wird. Mit der Kognitivierung der Zweisprachigkeit werden die beiden Lexika voneinander getrennt. Diese Entwicklung ist jedoch nicht mit einer Veränderung der systematischen Organisation der Konzepte gleichzusetzen. Die Folge ist, daß das Kind nun über zwei Lexika und ein Konzeptsystem verfügt.
Für die Überlegungen ist demnach eine Differenzierung des Begriffes „Lexikon“ in ein „phonologisches Lexikon“ einerseits und ein „semantisches Lexikon“ andererseits nötig. Ersteres enthält nichts als die pure phonetische Form des Wortes, während zweiteres die semantischen Informationen speichert.139 Die Existenz eines semantischen Lexikon wird dadurch belegt, daß in manchen Fällen ein Sprecher bereits eine Idee im Kopf hat, aber vielleicht im ersten Moment noch keinen Zugang zur entsprechenden phone- tischen Form findet. Die Folge davon ist, daß die Idee mittels anderer Wörter umschrieben wird, um einerseits den Kommunikationsfluß nicht zu unter- brechen und andererseits vom Gesprächspartner die momentan nicht vorhandene phonetische Form genannt zu bekommen.140 Das semantische Lexikon kann ohne das phonologische existieren, es muß jedoch umgekehrt davon ausgegangen werden, daß die phonetische Form eines Wortes nicht autonom, d. h. ohne Inhalt, bestehen kann. Spricht man nun von einer Ver- bindung zwischen beiden Sprachen, so muß geprüft werden, ob diese zwischen den phonetischen Lexika direkt besteht, oder ob sie über das den beiden Sprachen gemeinsame System der Konzepte hergestellt wird.
Unterschiedliche Ergebnisse in Studien, in denen das Mittel der Übersetzung von einer Sprache in die andere dem spontanen Benennen von Objekten oder Bildern gegenübergestellt wurden, legen den Schluß nahe, daß beide phonetische Lexika in den meisten Fällen über das Konzept- system verbunden werden. Die Argumentation stützt sich hierbei auf verschieden lange Antwortzeiten: Das Benennen eines Objekts in beiden Sprachen funktioniert etwas schneller als das Übersetzen, das sozusagen einen „Umweg“ über das semantische Lexikon nehmen muß.141
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Lexikalische und konzeptuelle Repräsentation nach Kroll und Stewart (1994)
Kroll und Stewart gehen in ihrem Modell davon aus, daß L1 die dominierende Sprache ist. Sie verfügt über eine größere Menge sprachlichen Materials, was in der Darstellung durch einen größeren Kasten verdeutlicht wird. Nach ihrem Dafürhalten ist die Übersetzungskompetenz asymmetrisch: Aufgrund der stärkeren Präsenz von L1 funktionieren Übersetzungen von L2 in L1 nachweislich schneller als umgekehrt von L1 in L2. Kroll und Stewart stellen die Hypothese auf, daß deshalb bei der Übersetzung von L2 in L1 eine direkte lexikalische Verbindungen zwischen den phonetischen Lexika besteht, wohingegen im umgekehrten Falle der Weg von L1 zu L2 über das semantische Lexikon findet. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Feststellung, daß die Existenz einer direkten Verbindung zwischen beiden phonetischen Systemen nicht ausgeschlossen wird.142
Eine solche Verbindung setzt allerdings voraus, daß die phonetische Form eines Wortes ganz losgelöst vom Inhalt bestehen kann. Um eine Übersetzung von einer Sprache in die andere gewährleisten zu können, muß jedoch der arbiträren Form des Wortes unbedingt ein semantischer Sinn gegeben werden, um das Wort mit demselben oder mit einem ähnlichen Sinn in der anderen Sprache finden zu können. Selbst wenn Kroll und Stewart davon ausgehen, daß Wörter in L2 oft in direktem Bezug zu ihrem Äquivalent in L1 gelernt werden, wird das neue Wort gleich mit semantischen Informationen gefüllt, die fortan mit diesem Wort untrennbar verbunden sind. Wird beispielsweise das neue Wort <Katze> durch den Satz „‘Katze‘ means ‚ cat ‘ “ gelernt, so wird das deutsche Wort einerseits zwar mit dem englischen auf eine Stufe gestellt und dadurch eine lexikalische Verbindung hergestellt, andererseits bekommt das neue Wort auch gleichzeitig eine Bedeutung und existiert nicht mehr als bloße Folge von Lauten.
Es wurde bereits in Kapitel 4.2.1.1 angesprochen, daß ein Wort in einem bestimmten Kontext erlernt wird. Auch wenn angenommen wird, daß beide Wörter vom Sprecher als Äquivalentenpaar betrachtet werden, so ist nicht gewährleistet, daß beide Wörter in ihrer konzeptuellen Repräsentation zu einhundert Prozent übereinstimmen. Das Finden eines Übersetzungsäqui- valents bedeutet demnach eine Suche im semantischen Lexikon nach einem gleichen oder ähnlichen Konzept, das in der anderen Sprache wiederum mit einer phonetischen Form verbunden ist. Hierbei ist eine annähernde bis exakte Deckungsgleichheit der Konzepte fast nur bei konkreten Nomen gegeben. Abstrakte Wörter können in ihrer konzeptuellen Wahrnehmung in L1 und L2 recht unterschiedlich sein, was dazu führt, daß sich beide Konzepte nur in Teilbereichen überschneiden.143 Das Finden des Konzeptes eines abstrakten Wortes im semantischen Lexikon wird dadurch erschwert und somit ist eine konzeptuelle Verbindung im Fall von abstrakten Wörtern eher unwahrscheinlich.
Kroll weist in ihren Ausführungen, die sich auf die Verbindung zweier Sprachen bei sukzessivem Spracherwerb beziehen, darauf hin, daß eine Verschiebung von einer anfänglich lexikalischen Verbindung hin zu einer konzeptuellen bei fortgeschrittener Kompetenz in L2 stattfindet.144 Geht man nun davon aus, daß beim kindlichen doppelten Erstspracherwerb beide Sprachen ähnlich stark ausgebildet sind, so kann man folgern, daß hier die phonetischen Lexika schon von Anfang an, d. h. mit der Trennung in zwei selbständige phonetische Lexika, konzeptuell verbunden sind.
Aufbauend auf die Überlegungen zur Beziehung zwischen phonetischer Form eines Wortes und dessen Konzepts, kann zu dem Schluß gekommen werden, daß das von Kroll und Stewart bereits diskutierte Modell der Concept Mediation 145 in den meisten Fällen als wahrscheinlicher in Betracht zu ziehen ist. Darin besteht die Verbindung von L1 zu L2 ausschließlich über das semantische Lexikon. Untersuchungen von Potter et. al. ergaben, daß zur Übersetzung von einer Sprache in die andere geringfügig mehr Zeit benötigt wird als zur reinen Benennung eines Gegenstandes, was als Beweis für die Verbindung beider phonetischen Lexika über das semantische Lexikon gewertet wird.146
5 Schlußbemerkung
„ Language is not a cultural artifact that we learn the way we learn to tell the time or how the federal government works. Instead, it is a distinct piece of the biological makeup of our brains. Language is a complex, specialized skill, which develops in the child spontaneously, without conscious effort or formal instruction, is deployed without awareness of its underlying logic, is qualitatively the same in every individual, and is distinct from more general abilities to process information or behave intelligently. “ 147
Es ist eine naturgegebene Fähigkeit des Kindes, eine oder auch mehrere Sprachen zu erlernen und auch gleichzeitig das Sprachmaterial unbewußt im Kopf zu organisieren. Die Entwicklung eines Kindes hin zum bilingualen Sprecher ist demnach ein natürlicher Prozeß, der ohne jeglichen Zwang ablaufen kann. Dieser natürliche Prozeß kann jedoch durch günstige äußere Bedingungen, wie beispielsweise eine „ one person - one language “ - Umgebung, positiv beeinflußt werden. Der sprachliche Input ist deshalb ein wichtiger Aspekt bei der Ausbildung der Zweisprachigkeit.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Prozesse gezeigt, die es dem bilingualen Kind ermöglichen, zwei Sprachen im Gehirn zu organisieren. Dabei zeigte sich, daß die konzeptuelle Wahrnehmung der Umwelt durch das Kleinkind eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielt, da sich diese in Ver- bindung mit der Art und der Situation, in der ein Wort gelernt wird, auf die Einschreibung in das mentale Lexikon auswirkt. Durch deren Veränderung kommt es auch zu einer Änderung der mentalen Organisation der beiden Sprachen. Ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres ist festzustellen, daß sich beide Sprachen im Bewußtsein des Kindes zu zwei eigenständigen Sprachsystemen ausbilden. Der Zeitpunkt des Bewußtwerdens ist dabei stark an die biologische Entwicklung des kindlichen Gehirns gekoppelt.
Es wurde darauf hingewiesen, daß von außen beobachtbare Phäno- mene wie beispielsweise das code-mixing noch keine Rückschlüsse auf die mentale Repräsentation der Sprachen zulassen. Wichtige Aspekte sind in diesem Zusammenhang die konzeptuelle Wahrnehmung der Umwelt und der lückenhafte kindliche Wortschatz. Die Forschung, die sich mit dem Aufbau des bilingualen Lexikons in der ersten Phase des Spracherwerbs beschäftigt, konnte bisher weder für das „Ein-System-Modell“ noch für das „Zwei- Systeme-Modell“ einen einleuchtenden Beweis bringen und muß letztlich beim Aufstellen von Hypothesen stehenbleiben.
Weiterhin wurden mögliche Mechanismen beschrieben, die neue Wörter entweder L1 oder L2 zuordnen. So hilft dem Kind einerseits die sprachliche Umgebung eines Wortes in der Äußerung eines Erwachsenen bei der Sprachzuordnung und andererseits werden Wörter durch Abgren- zung, bzw. durch Analogie mit L1 oder L2 in das entsprechende Lexikon eingeschrieben. Die Wörter eines Äquivalentenpaares stehen nach dem Erlernen über ein beiden Sprachen gemeinsam zur Verfügung stehendes semantisches Lexikon in Verbindung.
Diese Arbeit konnte aus dem komplexen Forschungsgebiet des kindlichen bilingualen Erstspracherwerbs nur einen kleinen Teilbereich herausgreifen und besprechen. Es existieren zu dieser Thematik zahllose Studien und Daten, deren Auswertung auch noch weiterhin eine Grundlage für Spekulationen und Diskussionen bieten wird.
Bibliographie
Aitchison, Jean. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: Blackwell. 1995.
Albert, Martin L. / Obler, Loraine K. The Bilingual Brain: Neuropsychological and Neurolinguistic Aspects of Bilingualism. New York: Academie Press. 1978.
Barrett, Martyn. „Early Lexical Development“. In: Fletcher, Paul / MacWhinney, Brian (Hrsg.). The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell. 1996. S. 362-392.
Brunner, Jerome. Wie das Kind sprechen lernt. Bern: Huber. 1993.
Clark, Eve V. The Lexicon in Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 1993.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 1987.
Cutler, Anne. „Segmentation Problems, Rhythmic Solutions“. In: Gleitman, Lila / Landau, Barbara. The Acquisition of the Lexicon. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1994. S. 81-99.
de Groot, Annette. „Word-Type Effects in Bilingual Processing Tasks“. In: Schreuder, Robert / Weltens, Bert (Hrsg.). The Bilingual Lexicon. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 1993. S. 27-51.
de Houwer, Annick. The Acquisition of two Languages from Birth: A Case Study. Cambridge: Cambridge University Press. 1990.
de Houwer, Annick. “Bilingual Language Acquisition”. In: Fletcher, Paul / MacWhinney, Brian (Hrsg.). The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell. 1996. S. 219-250.
Döpke, Susanne. One Parent, One Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. 1992.
Dromi, Esther. Early Lexical Development. Cambridge: Cambridge University Press. 1987.
Dromi, Esther. Language and Cognition: A Developmental Perspective. Norwood: Ablex Publishing Corporation. 1993.
Garman, Michael. Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 1990.
Genesee, Fred. "Early Bilingual Development: One Language or Two?". In: Journal of Child Language. 16/1989. S. 161-179.
Genesee, Fred / Nicoladis, Elena / Paradis, Johanne. "Language
Differentiation in Early Bilingual Development". In: Journal of Child Language. 22/1995. S. 611-631.
Goldfield, Beverly A./ Reznick, J. Steven. „Early Lexical Acquisition: Rate, Content, and the Vocabulary Spurt“. In: Journal of Child Language. 17/1990. S. 171-183.
Grosjean, François. Life with Two Languages. Cambridge: Harvard University Press. 1982.
Hakuta, Kenji. Mirror of Language - The Debate on Bilingualism. New York: Basic Books. 1986.
Hamers, Josiane / Blanc, Michel. Bilinguality & Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press. 1989.
Harding, Edith / Riley, Philip. The Bilingual Family. Cambridge: Cambridge University Press. 1986.
Harris, Margaret et al. „Symmetries and Asymmetries in Early Lexical Comprehension and Production“. In: Journal of Child Language. 22/1995. S. 1-18.
Heibeck, Tracy / Markman, Ellen. „Word Learning in Children: An
Examination of Fast Mapping“. In: Child Development. 58/1987. S. 1021-1034.
Hoffmann, Charlotte. An Introduction to Bilingualism. London: Longman. 1996.
Kielhöfer, Bernd / Jonekeit, Sylvie. Zweisprachige Kindererziehung. Tübingen: Stauffenburg-Verlag. 1995.
Kroll, Judith. „Accessing Conceptual Representation for Words in a Second Language“. In: Schreuder, Robert / Weltens, Bert (Hrsg.). The Bilingual Lexicon. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 1993. S. 53-81.
Kroll, Judith / Stewart, Erika. „Category Interference in Translation and Picture Naming Evidence For Asymmetric Connections Between Bilingual Memory Representations“. In: Journal of Memory and Language. 33/1994. S. 149-174.
Lanza, Elizabeth. "Can Bilingual Two-Year-Olds Code-Switch?". In: Journal of Child Language. 20/1992. S. 633-658.
Lewandowski, Theodor. Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: Quelle&Meyer. 1994. Bd.1.
Malakoff, Marguerite / Hakuta, Kenji. „Translation Skill And Metalinguistic Awareness in Bilinguals“. In: Bialystok, Ellen (Hrsg.). Language Processing in Bilingual Children. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. S. 141-166.
Meibauer, Jörg / Rothweiler, Monika (Hrsg.). Das Lexikon im Spracherwerb. Tübingen: Francke. 1999.
Mikes, Melanie. "Some Issues of Lexical Development in Early Bi- and Trilinguals". In: Conti-Ramsden, G. / Snow, C. E. (Hrsg.). Children's Language. Hillsdale: Erlbaum. 7/1990. S. 103-120.
Oxford English Dictionary. Oxford: Clarendon Press. 1991. Bd. 2.
Pinker, Steven. The Language Instinct. London: Penguin Books. 1995.
Porsché, Donald C. Die Zweisprachigkeit während des primären Spracherwerbs. Tübingen: Narr. 1983.
Quay, Suzanne. "The Bilingual Lexicon: Implications for Studies of Language Choice". In. Journal of Child Language. 22/1995. S. 369-387.
Romaine, Suzanne. Bilingualism. Oxford: Blackwell. 1995.
Schmidt-Mackey, Ilonka. „Language Strategies of the Bilingual Family“. In: Mackey, William (Hrsg.). Bilingualism in Early Childhood. Rowley: Newbury House Publishers. 1977.
Schreuder, Robert / Weltens, Bert. „The Bilingual Lexicon: An Overview“. In: Robert Schreuder / Bert Weltens (Hrsg.). The Bilingual Lexicon. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 1993. S. 1-10.
Taeschner, Traute The Sun is Feminine: A Study on Language Acquisition in Bilingual Children. Berlin: Springer, 1983.
Tracy, Rosemarie. „Vom Ganzen und seinen Teilen: Überlegungen zum doppelten Erstspracherwerb“. In: Sprache und Kognition. 15/1996. Heft 1-2. S. 70-92.
Vihman, Marilyn M. "Language Differentiation by the Bilingual Infant". In: Journal of Child Language. 12/1985. S. 297-324.
Volterra, Virginia / Taeschner, Traute "The Acquisition and Development of Language by Bilingual Children". In: Journal of Child Language. 5/1978. S. 311-326.
Webster ’ s Third New International Dictionary of the English Language. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc. 1981. Bd. 1.
Weinreich, Uriel. Languages in Contact. The Hague: Mouton. 1974.
Zangl, Renate. Dynamische Muster in der sprachlichen Ontogenese. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 1998.
Zurer Pearson, Barbara / Fernandez, Sylvia / Oller, D. K. "Cross-Language Synonyms in the Lexicons of Bilingual Infants: One Language or Two?" In: Journal of Child Language. 22/1995. S. 345-368.
Erklärung
Ich erkläre, daß ich die Arbeit selbständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe und daß alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach anderen Werken entnommen sind, durch Angabe der Quellen als Entlehnungen kenntlich gemacht worden sind.
Ludwigshafen am Rhein, den 23. Dezember 1999
[...]
1 Vgl. François Grosjean, Life with two languages, Cambridge: Harvard University Press, 1982, S. 4.
2 Vgl. Grosjean, S. 5.
3 Vgl. Annick de Houwer, „Bilingual Language Acquisition“, in: Paul Fletcher / Brain MacWhinney (Hrsg.), The Handbook of Child Language, Oxford: Blackwell, 1996, S. 220.
4 Vgl. Oxford English Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1991, Bd. 2, S. 189. Anm.: Es wird hier bewußt kein Fachwörterbuch zitiert, um ein Beispiel für eine allgemei- ne, der breiten Meinung angemessene Definition zu geben. Gleiches gilt bei der nächsten Fußnote.
5 Vgl. Webster ’ s Third New International Dictionary of the English Language, Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc., 1981, Bd. 1, S. 215.
6 Die vier Sprachfertigkeiten sind Hörverständnis, Sprechen, Lesen und Schreiben.
7 Vgl. Josiane Hamers / Michel Blanc, Bilinguality & Bilingualism, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, S. 6.
8 Vgl. Suzanne Romaine, Bilingualism, Oxford: Blackwell, 1995, S. 11.
9 Vgl. Donald Porsché, Die Zweisprachigkeit während des primären Spracherwerbs, Tübingen: Narr Verlag, 1983, S. 25.
10 Vgl. Theodor Lewandowski, Linguistisches Wörterbuch, Heidelberg: Quelle&Meyer, 1994, Bd. 1, S.189.
11 Vgl. Grosjean, S. 235 und Hamers / Blanc, S. 8.
12 Vgl. Martin Albert / Loraine Obler, The Bilingual Brain, New York: Academic Press, 1978, S. 5.
13 Vgl. Rosemarie Tracy, „Vom Ganzen und seinen Teilen: Überlegungen zum doppelten Erstspracherwerb“, in: Sprache und Kognition, 15/1996, Heft 1-2, S. 74.
14 Vgl. Susanne Döpke, One Parent, One Language, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1992, S. 2.
15 Dies schließt sowohl syntaktische, als auch semantische und phonetische Gesichts- punkte ein.
16 Vgl. Döpke, S. 3.
17 Vgl. Edith Harding / Philip Riley, The Bilingual Family, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, S. 39-42.
18 Das Wort „Sprecher“ wird hier absichtlich vermieden, da das bilinguale Kleinkind beide Sprachen zunächst nur passiv lernt und erst später in der Lage ist, sie auch aktiv zu produzieren.
19 Vgl. Harding / Riley, S. 42.
20 Vgl. David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, S. 362.
21 Vgl. Döpke, S. 3.
22 Vgl. Porsché, S. 27.
23 Vgl. Porsché, S. 24.
24 Vgl. Kenji Hakuta, Mirror of Languages, New York: Basic Books, 1986, S. 18.
25 Vgl. Hakuta, S. 15.
26 Vgl. Döpke, S. 4.
27 Vgl. Hakuta, S. 24-33.
28 Vgl. Peal und Lambert zitiert nach: Hakuta, S. 15. Änderungen in Klammern vom Verfasser hinzugefügt.
29 Vgl. Döpke, S. 6.
30 Vgl. Hakuta, S. 35.
31 Unter Input wird das sprachliche Material verstanden, das dem Kind beim Spracherwerb präsentiert wird.
32 Zu folgenden Ausführungen vgl. Romaine, S. 183-185.
33 Unter Gesellschaft sind hier die anderen Sprecher im Land zu verstehen, oder in Spezial- fällen, wie beispielsweise in Québéc, die Sprecher einer größeren Sprachgemeinschaft, in der die Familie lebt.
34 Vgl. de Houwer, 1996, S. 224.
35 Vgl. Charlotte Hoffmann, An Introduction to Bilingualism, London: Longman, 1996, S. 45.
36 Vgl. Harding / Riley, S. 59, deutsche Übersetzungen vom Verfasser hinzugefügt.
37 Vgl. Ilonka Schmidt-Mackey, „Language Strategies of the Bilingual Family“, in: William Mackey (Hrsg.), Bilingualism in Early Childhood, Rowley: Newbury House Publishers, 1977, S. 142.
38 Vgl. Schmidt-Mackey, S. 140.
39 Vgl. Marguerite Malakoff / Kenji Hakuta, „Translation Skill And Metalinguistic Awareness in Bilinguals“, in: Ellen Bialystok, Language Processing in Bilingual Children, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, S. 141.
40 Vgl. Malakoff / Hakuta, S. 141.
41 Vgl. Hoffmann, S. 45.
42 Vgl. Schmidt-Mackey, S. 143.
43 Vgl. de Houwer, 1996, S. 230.
44 Diese Zeit ist von Individuum zu Individuum verschieden und kann auch von Strategie zu Strategie leicht variieren.
45 Vgl. Annick de Houwer, The Acquisition of Two Languages From Birth: A Case Study, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, S. 54.
46 Vgl. Grammont zitiert nach: Schmidt-Mackey, S. 133.
47 Vgl. de Houwer, 1996, S. 225.
48 Vgl. de Houwer, 1996, S. 227.
49 Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, das jedem Fremdsprachenlernenden bekannt sein dürfte: Die rezeptiven Fähigkeiten sind in den meisten Fällen besser als die produkiven.
50 Vgl. de Houwer, 1996, S. 227.
51 Vgl. Robert Schreuder / Bert Weltens, „The Bilingual Lexicon: An Overview“, in: Robert Schreuder / Bert Weltens (Hrsg.), The Bilingual Lexicon, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993, S. 4.
52 Vgl. Jean Aitchison, Words in the Mind, Oxford: Blackwell, 1995, S. 7.
53 Vgl. Renate Zangl, Dynamische Muster in der sprachlichen Ontogenese. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1998, S. 8.
54 Vgl. Zangl, S. 12.
55 Während das Kind anfangs nur ein Wort alle 2-3 Tage lernt, nimmt es nun mehrere Wörter an einem Tag in seinen Wortschatz auf. (Vgl. Rothweiler / Meibauer, „Das Lexikon im Spracherwerb - Ein Überblick“, In: Jörg Meibauer / Monika Rothweiler (Hrsg.), Das Lexikon im Spracherwerb, Tübingen: A. Franke Verlag, 1999, S. 16.)
56 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S. 13.
57 Die Dauer der Phase von Ein-Wort-Äußerung ist von Kind zu Kind verschieden. Einige Kinder durchlaufen diese Phase über einen Zeitraum von mehreren Monaten, wo- hingegen andere schon früher in das Stadium von Mehr-Wort-Äußerungen übergehen.
58 Vgl. Eve Clark, The Lexicon in Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, S. 21.
59 Vgl. Clark, S. 26.
60 Vgl. Clark, S. 50.
61 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S. 14.
62 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S.13.
63 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S.16.
64 Vgl. Beverly Goldfield / J. Steven Reznick, „Early Lexical Acquisition: Rate, Content, and the Vocabulary Spurt“, in: Journal of Child Language, 17/1990, S. 180.
65 Vgl. Esther Dromi, Language and Cognition: A developmental Perspective, Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1993, S. 36.
66 Der Begriff des fast mapping wurde 1978 von Carey geprägt.
67 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S. 19-20.
68 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S. 20.
69 Vgl. Martyn Barrett, „Early Lexical Development“, in: Paul Fletcher / Brian MacWhinney (Hrsg.), The Handbook of Child Language, Oxford: Blackwell, 1996, S. 376-377.
70 Vgl. Esther Dromi, Early Lexical Development. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, S. 41.
71 Vgl. Aitchison, S. 173.
72 Vgl. Dromi, 1987, S. 41-42.
73 Vgl. Aitchison, S. 173.
74 Vgl. Carey zitiert nach:Tracy Heibeck / Ellen Markman, „Word Learning in Children: An Examination of Fast Mapping“, in: Child Development, 58/1987, S. 1021.
75 Vgl. Heibeck / Markman, S. 1033.
76 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S. 24, die hier das Beispiel „fünfzig“ / „fuffzig“ angeben.
77 Beispielsweise Pluralendungen a cat - two cats) oder Verbendungen, bzw. Verbformen (I sing - he sings - they sang - you are singing - we have sung)
78 Bootstraps sind im ersten Sinne Stiefelschlaufen, die das Aufsteigen auf ein Pferd erleichtern sollen. Im Übertragenen Sinne dienen sie hier zum leichteren Umdenken von einer Kategorie in eine andere.
79 Vgl. Clark, S. 48.
80 Vgl. Clark, S. 28-30.
81 Beispielsweise mummy, daddy, baby, dog, bird, nose, eye, cup, spoon, light.
82 Vgl. Margaret Harris et al. „Symmetries and Asymmetries in Early Lexical Comprehension and Production“, in: Journal of Child Language, 22/1995, S. 15.
83 Vgl. Dromi, 1993, S. 38.
84 Vgl. Rothweiler / Meibauer, S. 23.
85 Vgl. Virginia Volterra / Traute Taeschner, „The Acquisition and Development of Language by Bilingual Children“, in: Journal of Child Language, 5/1978, S. 324.
86 Vgl. Jerome Brunner, Wie das Kind sprechen lernt, Bern: Huber, 1993, S. 26.
87 Vgl. Volterra / Taeschner, S. 312.
88 Vgl. Traute Taeschner, The Sun is Feminine, Berlin: Springer-Verlag, 1983, S. 18-20.
89 Zu folgenden Ausführungen vgl. Taeschner, S. 24-28. Aufgrund der verallgemeinernden Aussagen Taeschners, werden im Folgenden ähnlich allgemeingültige Aussagen getroffen, ohne ständig auf den exemplarischen Charakter der Studie hinzuweisen.
90 Leopold kam bei der Beobachtung seiner zweisprachigen Tochter Hildegard zu ähnlichen Ergebnissen. Sie wuchs in einem deutsch-englischen Umfeld auf und benutzte die Wörter des äquivalenten Wortpaares please / bitte je nach äußerem Umstand unter-
91 Taeschner führt hier das Beispiel von Spiegeln an. Das Kind hat das deutsche Wort <Spiegel> anhand eines Badezimmerspiegels gelernt; das entsprechende italienische Wort < specchio > wurde ihm mittels eines Spiegels im Schlafzimmer beigebracht. Da das Kind noch nicht zur Dekontextualisierung fähig ist, bedeutet das Wort <Spiegel> für es ein Ding, in dem man sich sehen kann und das eine bestimmte Form hat, umgeben von den Kacheln eines Badezimmers. Im Gegensatz dazu ist < specchio > zwar auch ein reflektierender Gegenstand, wobei aber sowohl die Form als auch die räumliche Umgebung von der des <Spiegels> abweichen und somit für das Kind einen anderen Sachverhalt darstellen, der seinen eigenen sprachlichen Ausdruck besitzt. (Vgl. Taeschner, S. 40.)
92 Vgl. Uriel Weinreich, Languages in Contact, The Hague: Mouton, 1974, S. 9.
93 Vgl. Weinreich, S. 10.
94 Vgl. Annette de Groot, „Word-Type Effects in Bilingual Processing Tasks“, in: Robert Schreuder / Bert Weltens (Hrsg.), The Bilingual Lexicon, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993, S. 35-36.
95 Vgl. de Groot, S. 37-41.
96 Vgl. Volterra zitiert nach: de Houwer, 1996, S. 234. Ergänzungen in Klammern vom Verfasser hinzugefügt.
97 Vgl. Suzanne Quay, „The Bilingual Lexicon: Implications For Studies of Language Choice“, in: Journal of Child Language. 22/1995, S. 370.
98 Vgl. Elizabeth Lanza, „Can Bilingual Two-Year-Olds Code-Switch?“, in: Journal of Child Language, 20/1992, S. 633-634.
99 Vgl. Lanza, S. 635.
100 Vgl. Harding / Riley, S. 51-52.
101 Vgl. Taeschner, S. 28.
102 Vgl. Taeschner, S. 34.
103 Vgl. Taeschner, S. 39-40.
104 Vgl. Taeschner, S. 41.
105 Vgl. Taeschner, S. 42.
106 Vgl. Taeschner, S. 44.
107 Ein solches Verhalten ist jedoch nur zu beobachten, wenn sich die Eltern selbst an eine strikte Trennung der Sprachen halten. Sind ihre Äußerungen durch Sprachmischungen gekennzeichnet, so ist es dem Kind auch nicht möglich, eine Sprache an einer Person festzumachen.
108 Vgl. Harding / Riley, S. 52.
109 Vgl. Levy zitiert nach: Romaine, S. 188.
110 Vgl. Taeschner, S. 29-30. Anmerkung: Grund für das seltene Auftauchen dieser Wortklassen ist die noch einfach gehaltene Satzstruktur.
111 Vgl. Taeschner, S. 33.
112 Vgl. Taeschner, S. 54.
113 Vgl. Taeschner, S. 55.
114 Vgl. Romaine, S. 190.
115 Vgl. Taeschner, S. 56.
116 Vgl. de Houwer, 1996, S. 231.
117 Lisas Wortschatz von 64 Wörtern wies sechs äquivalente Paare auf, der von Giulia (73 Wörter) gar 14. (Vgl. de Houwer, 1996, S. 232.)
118 Vgl. Melanie Mikes, „Some Issues of Lexical Development in Early Bi- and Trilinguals“, in: Children ’ s Language, 7/1990, S. 113.
119 Vgl. de Houwer, 1996, S. 232.
120 Vgl. de Houwer, 1996, S. 233-234.
121 Das metalinguistische Denken der Kinder beginnt ebenfalls zu diesem Zeitpunkt, d.h. sie können ab der Zeit, in der auch der Wortschatzspurt stattfindet, bewußt zwischen beiden Sprachen unterscheiden, worauf in Kapitel 4.2.4 näher eingegangen werden wird.
122 Vgl. Aitchison, S. 169-170 zu beiden Hypothesen.
123 Vgl. Barbara Zurer Pearson / Sylvia Fernández / D. K. Oller, „Cross-language Synonyms in the Lexicons of Bilingual Infants: One Language or Two?“, in: Journal of Child Language, 22/1995, S. 346.
124 Ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres.
125 Vgl. Marilyn M. Vihman, „Language Differentiation by the Bilingual Infant“, in: Journal of Child Language, 12/1985, S. 302.
126 Vgl. Fred Genesee, „Early Bilingual Development: One Language or Two?“, in: Journal of Child Language, 16/1989, S. 161-174.
127 Beispielsweise das deutsche Wort <Flügel>.
128 Vgl. Clark, S. 113.
129 Wortpaare, die lediglich homograph sind, werden hier absichtlich ausgeklammert, da sie in Bezug auf den kindlichen Spracherwerb mangels Lese- und Schreibfähigkeiten nicht von Bedeutung sind. Zudem unterscheiden sich homographe Wörter oft in der Aus- sprache (Beipspielsweise engl. reunion - /rÀ‘j+nj•n/ und span. reunion - /³eun’jon/).
130 Die Darstellung ist stark vereinfacht. Es soll hier lediglich ausgedrückt werden, daß für die unterstrichenen Satzelemente bereits eine Entsprechung im mentalen Lexikon der beiden Sprachen existiert. Die „Schnittmenge“, in der sich der Name „Lisa“ befindet, stellt den nicht sprachspezifischenTeil des Wortschatzes dar.
131 Zu folgenden Ausführungen vgl. Anne Cutler, „Segmentation Problems, Rhythmic Solutions“, in: Lila Gleitman and Barbara Landau, The Acquisition of the Lexicon, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994, S. 81-99. Auch: Michael Garman, Psycholinguistics, Cambridge:Cambridge University Press, 1990, S. 240.
132 Vgl. Fred Genesee / Elena Nicoladis / Johanne Paradis, "Language Differentiation in Early Bilingual Development", in: Journal of Child Language, 22/1995, S. 623.
133 Vgl. Harding / Ripley, S. 55, deutsche Übersetzung vom Verfasser hinzugefügt.
134 Vgl. Malakoff / Hakuta, p. 144.
135 Vgl. Harding / Ripley, S. 56.
136 Vgl. Romaine, S. 192.
137 Vgl. Romaine, S. 194.
138 Vgl. Bernd Kielhöfer / Sylvie Jonekeit, Zweisprachige Kindererziehung, Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1995, S. 29.
139 Vgl. Garman, S. 244.
140 Vgl. Garman, S. 245.
141 Vgl. Judith Kroll / Erika Stewart, „Category Interference in Translation and Picture Naming: Evidence for Asymmetric Conenctions between Bilingual Memory Represen- tation“, in: Journal of Memory and Language, 33/1994, S. 150-151.
142 Vgl. Judith Kroll, „Accessing Conceptual Representation for Words in a Second Language“, in: Robert Schreuder / Bert Weltens, The Bilingual Lexicon, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993, S. 70.
143 Vgl. de Groot, S. 38.
144 Vgl. Kroll, S. 74.
145 Vgl. Kroll / Stewart, S. 150.
146 Vgl. Potter zitiert nach: Kroll / Stewart, S. 151.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Textes?
Dieser Text behandelt den bilingualen Erstspracherwerb bei Kindern, insbesondere den Erwerb des Lexikons und dessen mentale Repräsentation.
Wie definiert der Text Bilingualismus?
Der Text erörtert verschiedene Definitionen von Bilingualismus und kommt zu dem Schluss, dass es sich um die Fähigkeit handelt, zwei Sprachen mit einer dem Muttersprachler sehr nahe kommenden Akkuratesse zu sprechen, zu schreiben und sie sowohl im gesprochenen als auch im geschriebenen Wort ohne Probleme zu verstehen. Für Kinder wird die Forderung nach schriftlicher Beherrschung ausgenommen.
Welche Typen des doppelten Erstspracherwerbs werden unterschieden?
Der Text beschreibt sechs Typen des kindlichen doppelten Erstspracherwerbs nach Romaine, die sich nach der Sprache der Eltern, der Sprache der Gesellschaft und der Art, wie die Sprachen dem Kind präsentiert werden, richten. Dazu gehören: "one person - one language", Eltern sprechen nicht-dominierende Sprache, Eltern sprechen die gleiche Sprache (nicht die der Gesellschaft), Eltern sprechen verschiedene Sprachen, ein Elternteil spricht eine Fremdsprache, und Eltern sind bilingual und vermischen die Sprachen.
Welche Rolle spielt der Input beim bilingualen Spracherwerb?
Der Text betont die Bedeutung des Inputs durch Eltern und direkte Umgebung. Die Menge und die Konsequenz der Eltern bei der Kommunikation in ihrer jeweiligen Sprache sind entscheidend. Es wird auch auf die emotionale Bindung des Kindes zu einer Sprache und die möglichen Folgen von subtraktivem Bilingualismus hingewiesen.
Was ist das mentale Lexikon?
Das Lexikon ist der Speicher, der alle existierenden Wörter einer Sprache beinhaltet. Das mentale Lexikon enthält für jedes Wort Informationen aus allen linguistischen Gebieten wie Phonologie, Wortklasse, Orthographie, Syntax, Morphologie und Semantik.
Wie entwickelt sich das Lexikon bei monolingualen Kindern?
Die Entwicklung des Lexikons ist eng an die Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt gekoppelt. Es gibt eine langsame erste Phase des Wortschatzerwerbs, gefolgt von einem Wortschatzspurt (vocabulary spurt). Neue Wörter werden durch fast mapping erworben, wobei das Wort zunächst auf ein Grundgerüst reduziert wird.
Was sind die Hauptthesen von Volterra und Taeschner zum bilingualen Spracherwerb?
Volterra und Taeschner beschreiben den bilingualen Erstspracherwerb in einem dreiphasigen Modell, modifiziert in ein zweiphasiges. Zunächst nehmen sie an, dass die Sprachen sich nicht trennen lassen und alle Wörter in einem einzigen Lexikon gespeichert werden, bevor das Kind dann langsam lernt zu differenzieren. Die spätere Sichtweise von Taeschner besagt, dass zunächst alle neu erlernten Wörter in einem einzigen Lexikon gespeichert werden, wobei es fast keine Äquivalente zwischen den beiden Sprachen gibt.
Welche Kritik gibt es an Taeschners Ansatz?
Die Kritik an Taeschners Ansatz bezieht sich hauptsächlich auf die geringe Anzahl der untersuchten Kinder, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Zudem wird das Fehlen von Äquivalenten in der ersten Phase in Frage gestellt.
Wie ordnen bilinguale Kinder neue Wörter einer Sprache zu?
Bilinguale Kinder verwenden verschiedene Mechanismen, um neue Wörter entweder L1 oder L2 zuzuordnen. Dies geschieht über die sprachliche Umgebung eines Wortes (Kontext), den Satzrhythmus, die Satzmelodie, und durch Abgrenzung oder Analogie zu bereits bekannten Wörtern und grammatikalischen Strukturen (syntaktisches bootstrapping).
Wann entwickelt ein Kind ein bilinguales Bewusstsein?
Ein bilinguales Bewusstsein entwickelt sich, wenn das Kind in der Lage ist, bewusst zwischen den Sprachen zu wechseln, Sätze von einer in die andere Sprache zu übersetzen und die Sprachen richtig zu benennen. Dies geschieht in der Regel ab dem vierten oder fünften Lebensjahr.
Wie interagieren die beiden Sprachsysteme im Gehirn?
Obwohl L1 und L2 in separaten Systemen gespeichert sind, interagieren sie über das semantische Lexikon, das die Konzepte enthält, die mit den Wörtern verbunden sind. Dies ermöglicht das code-switching und das Übersetzen von einer Sprache in die andere.
- Citar trabajo
- Martin Storck (Autor), 2000, Das mentale Lexikon bilingualer Kinder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97802